Wer viel Geduld und eine brauchbare Internetverbindung hat, kann sich die ursprüngliche Seite, oder zumindest einen Großteil davon auf
![]() archive.org ansehen.
archive.org ansehen.
 Das Buch
Das Buch
![]() Mein kühner Entschluß
Mein kühner Entschluß
"Sexy Hexi sagt der Joh zu mir" dröhnt am 28. August 1958 der aktuellste "West"-Hit aus den offenstehenden Fenstern des Internates der Seefahrtschule Wustrow. "Na dann bin ich ja hier richtig" denke ich und aste meine zwei Koffer hinein. Ich hatte beschlossen zur See zu fahren.
Im Autobus vom Bahnhof Ribnitz-Damgarten zum Ostseebad Wustrow sehe ich das große Meer zum ersten Mal. Das große Meer ist aber nur der Saaler Bodden, wie sich später herausstellt.
Ich habe nach dem Abitur schon zwei Semester Baustofftechnologie abstudiert, als mich im thüringischen Apolda die See ruft.
Aber in Apolda läßt man mich nicht gehen.
Irgend ein Fachschulgesetz verbietet das. Mein Zimmerkumpel Nuff sagt am nächsten Montag in der Bildungsstätte bescheid: "Flegel können Sie im Klassenbuch streichen, der kommt nicht mehr!"
Nach dem ich in Wustrow schon drei Monate zum Seefunkoffizier ausgebildet werde und im Morsealphabet auch ein "E" schon leidlich von einem "O" unterscheiden kann, ereilt mich der Fluch der bösen Tat.
Der Schuldirektor faßt vom Berliner Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen ganz herb einen ab! "Hätten wir gewußt, daß sie aus einem Studienverhältnis zu uns gekommen sind, .....sie haben uns da vielleicht etwas eingebrockt. Aber jetzt, nach einem viertel Jahr, haben sie ja in ihrer Bauschule auch den Anschluß verloren. Bleiben sie hier, es bleibt ja nichts anderes übrig!" sind die Schlußworte der Anklage.
Der Beschluß findet meine Zustimmung.
In Wustrow geht es wesentlich lockerer zu als in Apolda.
Im Internat regiert die Schüler-Selbstverwaltung.
"Sexy-Hexi" dröhnt nach meinem Eintreffen aber nur noch wenige Wochen aus den Lautsprechern. Mein Mitstudent im Semester F1A ist Egon. "Grimmi-Egon" weil er ein Grimmiger ist. Er ist schon über 30 Jahre alt. "Ich war Hauptmann beim Ministerium für Staatssicherheit" erzählt er uns allen beim ersten kennen lernen am ersten Studientag.
Von seinem alten Job kann er sich nicht trennen. Er wird Parteiorganisator und führt nahezu das Kommando an der Schule. "Sexy-Hexi" ist ein dekadenter Titel von Radio Luxemburg, womit der Sender einzig und alleine das Ziel verfolgt, das Proletariat vom aufrechten Klassenkampf abzuhalten.
"Das haben wir so gefälligst zu glauben" bestimmt Egon, das ergab schließlich seine frühere geheimdienstliche Ermittlungstätigkeit. Fürderhin sind Tonbandaufnahmen und das Abhören von Radio Luxemburg im kurzwelligen 49-Meter-Band an der Seefahrtschule Wustrow verboten. Als zwei Kameraden meiner Studiengruppe von Egon beim Feindsenderhören ertappt werden, werden sie exmatrikuliert!
Egon spukt zwei Jahre als Student und partei-politischer Inquisitor an der Schule.
Von anfänglich 16 Mann geht mein Semester dann mit 6 Mann in die Abschlußprüfung. Egon ist unter den sechsen, hat aber erstmals seine Schwierigkeiten. Er kann nicht "Hören" und nicht "Geben", jedenfalls nicht in dem hohen geforderten Prüfungsniveau. Das verlangt von dem angehenden Seefunkoffizier eine fünfminütige fehlerfreie Schreibmaschinenaufnahme von 140 Morsezeichen pro Minute. Das nennt man "Hören". "Geben" heißt, einen vorgelegten Text mit 125 Morsezeichen pro Minute zu senden. Fünf Minuten lang fehlerfrei. Das ist ordentlicher Streß. Ich hatte vor dieser Prüfung auch ganz mörderischen Muffengang. Den diesbezüglichen Prüfungsvorgang überwacht die Deutsche Post, Hpt.-Abteilung Seefunk. Diese gestrengen Herren zeigen sich im Gegensatz zum Lehrkörper der Schule völlig unbeeindruckt von Egons Mythos. Sie lassen ihn kalt durch die Prüfung rauschen.
Allerdings wiederholt er diese dann nach ein paar Monaten irgendwie und wohl "unter vier Augen". Den frisch gebackenen Schiffsoffizier Egon sägt dann aber die Schiffsleitung gleich auf seiner ersten Reise ab. Das diesem Blender vorauseilende Mythos nützt ihm nun auch hier nichts mehr, nachdem er für seine früheren Brotherrn dem MfS anscheinend nicht mehr von Interesse ist.
Von old Egon abgesehen, sind wir ca. 100 "Seefahrt-Schaulers" und der uns schlau machende Lehrkörper eine recht familiäre Truppe, Nautiker, Fischer und Funker. Das Betriebsklima an dieser Schule ist in Ordnung.
Unsere Studienergebnisse unterliegen, wie auch die Ausbreitung der Funkwellen, sehr starken jahreszeitlichen Schwankungen. Das Ostseebad Wustrow schmort in der kalten Jahreszeit im eigenen Saft. Die wenigen mannbaren Maiden des Fischlandes können nicht durchgreifend die "Schaulers" vom Büffeln abhalten. Schon wesentlich größeren ungünstigen Einfluß auf die Wissensanhäufung haben dagegen die in sechsunddreißiger Reihen einfallenden hübschen weiblichen Badegäste während der Sommermonate. Die Sachsenmädels fahren auf die kernigen Sprüche der angehenden Schiffsoffiziere total ab, auch wenn so mancher Sprücheklopfer noch kurz vorher den Bodden mit der Ostsee verwechselt hatte.
Die uns natürlich bekannten Kellnerinnen der "Reuterschänke", des "Fischlandkaffees"oder bei "Schröder Franz" schmunzeln schon immer verschmitzt, wenn ich am Dienstag mit meinem blonden Kurschatten aus einem Seppelhosen-Portemonnaie die zwei Schoppen "Grauer Mönch" für mein Mädel und die siebzehn Bier für mich bezahle. Nahezu die gleiche Zeche begleiche ich am Freitag abend für meine dunkelhaarige Begleitung aus einer niedlichen roten herzförmigen Geldbörse.
Gleich im ersten Studentensommer mache ich einen gravierenden Fehler in der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen.
Das erste Fischlandmädel, das ich nach dem Knapperwerden der Sommergäste in der Nachsaison im "Fischlandkaffee" zum Tanze bitte, kommentiert mein Verhalten: "Na Felix, sind die Kurgäste wieder weg!?"
In den zwei folgenden Sommern flechte ich immer auch ein Tänzchen mit den Dorfschönen der kleinen Fischlandgemeinde ein. Das zahlt sich während der Trockenperiode der kalten Jahreszeit aus.
Andersartig ist der studentische Sommer nicht zu überstehen. Mein monatliches Stipendium beträgt 120,-DM. Davon behält die Bildungsstätte für Unterbringung und Vollverpflegung 64,- DM ein.
Die Kombüse der Seefahrtschule Wustrow ernährt uns voll-powernde junge Männer früh, mittags und abends täglich zu einem Verpflegungssatz von 2,20 DM. (Damals brachte ich 73 studentische Kilogramm auf die Waage. Heute sind es 82 vorruheständliche.) Die kurioseste Variante der Zusatzversorgung entwickelt "Kneppel". Er brät sich in einer Aluminium-Seifenschale ein Spiegelei auf dem Bügeleisen!
Wenn die Paketpost Mutters Griebenschmalz anlieferte, zieren meine zwei Zimmergenossen und mich wieder eine Weile rote Pausbacken.
Wir führen ein Studentenleben wie es sich gehört.
Im "Helgoland" ist Sommernachtsball. Die "Schaulers", wie uns die Eingeborenen nennen, sind mit einer Abordnung von 16 Mann an drei oder vier Tischen vertreten.
Auf der Bühne läuft ein Quiz ab. Ich bin einer von drei befragten Kandidaten. Der erste Preis ist ein Bildband über Fischland und Darß, der zweite eine Flasche Rotwein.
Meine Kumpels drohen von unten mit den Fäusten zu mir herauf: "Wag dich ja nicht mit dem komischen Buch zu uns herunter, trag gefälligst die Flasche Wein ab!"
Ich stehe vor der letzten Frage des Quiz-Masters und hauchdünn vor dem "komischen Buch" und die letzte Frage lautet: "Nennen sie ein Musikinstrument aus Ton!" Ich sage vorsichtshalber "Tonband", der Saal jodelt und ich ergattere die Flasche Wein.
Das ist Grund zum Zusammenrücken der vier Tische, die sich fest in der Hand der "Schaulers" befinden. Wir trinken zu sechzehntens die Flasche Wein aus.
Die Kapelle versucht zum Tanzauftakt den River-Quai-Marsch mit der darin enthaltenen Pfeifeinlage. Wir pfeifen allesamt diese Passage mit, aber so herzzerreißend falsch, daß sich draußen der Hund mit der Hütte schüttelt. Die Kapelle kommt völlig aus der Tonlage, da die Bläser unserer Partitur folgen. Statt die Dussels nun ersatzweise ein anderes Stück zur Aufführung brächten, so brechen sie vier oder fünfmal den besagten Marsch ab, um ihn kurz darauf neu zu intonieren. Und immer fallen wir 16 Pfeifen, mit unseren eigenen Interpretationen ein, wie die Türken in Wien. Der Leiter des gepflegten Hauses bittet uns zu gehen, dazu verspürten wir aber noch keine rechte Lust.
Am nächsten harten Studientag erfolgt die Lautsprecherdurchsage. Der stellvertretende Direktor bittet: Die Herren zu sich, die gestern im "Helgoland" beim Sommernachtsball zugegen waren.
Alle treten an. Ist doch Ehrensache.
Herr Knauf zückt als Notizblock seine Zigarettenschachtel der Marke "Jubilar" und notiert für den Vorrats-Zeitraum seiner 15 Zigaretten die Namen der Angeklagten: "Pflaume", "Maul", "Draht", "Übel" "Flegel" (als wie ich), um nur fünf Kuriositäten zu nennen. Ermahnend meint er abschließend, daß wir unwahrscheinliches Schwein hätten, daß der Chef, Direktor Schirdewahn, gerade nicht zugegen sei.
Die "Schaulers" haben daraufhin wieder ein halbes Jahr Hausverbot im "Helgoland". Das haben sie umschichtig in einer der Wustrower Gastronomitäten ständig.
Im Dachgeschoß der Reuter-Schänke schläft eine Kurgästin. In dieser lauen Sommernacht bei offenem Fenster. Wir umschiffen als Spätheimkehrer einen zum günstigen Sommerpreis hier abgekippten Briketthaufen.
Nur um die Wirkung der genossenen berauschenden Getränke zu testen, werfen wir ein wenig von den Kohlen in das offene Fenster und treffen die Öffnung bemerkenswert gut. Die Urlauberin bemerkt das auch, obwohl wir generell nur halbe Brikett verwenden.
Auf dem weiteren Heimweg zum Internat ziert ein in Bronze gegossener Jüngling auf einem Sockel ein bemerkenswertes Grundstück mit schönem Rohrdach-Katen. Der Jüngling ist unbekleidet und hält in vorgestreckter Hand eine Schale in die Landschaft. In diese kacken wir hinein, obwohl sie sich ca. 1,80 Meter über der Erde befindet. Das ist artistisch sehr schwierig zu bewältigen und geht nur mit Räuberleiter, wobei der Untermann auf die Treffsicherheit des Obermannes vertrauen muß.
Jetzt steht es fest, der Wirt muß vorher unsere geistigen Getränke heftig verdünnt haben.
Das kleine bronzene Pimmelchen des Jünglings verzieren wir mit einem Kondom aus "H. Kästners diskretem Versand."
Die diensthabende Studentenabordnung, die allmorgendlich beim Bäcker Dähn die Brötchen für die Seefahrtschule im Wäschekorb abholt, schmettert die Neuigkeit morgens in die volle Mensa.
Eines schönen Studientages haben sich per Lautsprecheranordnung alle Seefahrtschüler, die den Vornamen Klaus tragen, auf dem Hof einzufinden und in Reihe aufzustellen. Diese Formation von über einem Dutzend "Kläusen" schreitet jetzt "Pistole" (der Wustrower ABV) und eine dickliche Kurgästin ab. Die Dame ist diesbezüglich bei "Pistole" vorstellig geworden, weil sie angeblich von einem Seefahrtschüler namens Klaus unsittlich oder unbefriedigend behandelt worden wäre.
Aber auch dieser Lokaltermin verläuft für die Urlauberin unbefriedigend und "Pistole" kann ihr auch nicht weiterhelfen. Der mutmaßliche Sexualverbrecher kann unter den angetretenen "Kläusen" nicht gestellt werden. Diese dürfen daraufhin mit deplaziertem Grinsen wieder einrücken.
Jeden Montag ist für alle Studenten aber ausrücken unumstößliche Pflicht:
Antreten zur vormilitärischen Ausbildung.
Der ganze Zivilistenhaufen eiert dann, bewaffnet mit einem Spaten, in hirschlederner Seppelhose, in Jeans oder Knickerbockern, wie es ein jeder für angebracht hält, auf dem Fischland umher, um mit den dabei antrainierten Fähigkeiten den Klassenfeind und den Bonner Ultras das Fürchten zu lehren. Patenschaftlich betreut wird für diese Aufgabe unsere Schule von dem Leutnant nebst 10 Mann, die auf der Ahrenshooper Signalstation von ihrer Steilküste aus ständig die aggressiven Machenschaften des Klassenfeindes auf Fehmarn und Bornholm im Auge haben.
Wir bitten die Genossen innerhalb der patenschaftlichen Betreuung um einheitliche Klamotten, abgelegte Bordpäckchen oder Kieler Knabenanzüge, damit wir bei unseren militärischen Aufmärschen nicht daherkommen, wie der "Warneminner Ümgang".
"Das geht seinen sozialistischen Gang, Genossen!" versprechen die Genossen und unser bunter Haufen dackelt Montag für Montag weiterhin als solcher über das flache übersichtliche Fischland.
Die Genossen unserer "Pateneinheit" interessieren sich wohl mehr für die nicht vorhandene Bekleidung der Badenixen am Effi-Strand unter ihrem Ausgucksturm, als die ebenfalls nicht vorhandene Kleidung bei uns.
Wir bilden eine Selbsthilfegruppe.
Diese bestellt in der Buchhandlung Möller für unsere zwei Funkerkompanien 35 Kieler Knabenmützchen in kreppapieriger Faschingsausgabe mit zwei Bändern und dem Aufdruck "Marine" auf dem Stirnband. Nach dem Eintreffen der bestellten Sendung stehen zwei Kompanien im herrlichen Einheits-Look mit Spaten und Kieler Knabenmütze besonders akkurat aufgereiht vor dem Schulgebäude. Bereit zum Befehlsempfang und Abmarsch. Bereit zur Verteidigung des Vaterlandes und unserer Errungenschaften. Selbst Egon steht stramm, mit Händen an der Lederhosen-Naht.
Wenn die expandierende Flotte in zwei Jahren uns bis dahin ausgebildete Kader nicht so dringend nötig hätte, wir hätten schon am nächsten Dienstag alle samt unsere studentische Karriere an der Wustrower Kaderschmiede beenden dürfen. Die Reaktion auf unsere hübschen Bändermützchen ist beeindruckend. Die berufsmäßigen Beschützer der zu verteidigenden Errungenschaften verstehen gemäß des Ernstes der zu bewältigenden Aufgabe keinen Spaß.
![]() In the army now
In the army now
Kurz vor den Sommerferien rücken die seeseitigen Landesverteidiger in Wustrow an.
Mindestens fünfzigtausend Mark Gehalt sitzen mit geflochtenen Schulterstücken in der Mensa. Die Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" der Volksmarine in Stralsund, volksmündlich "Schwedenschanze" genannt, nimmt sich nun in den Semesterferien so richtig unserer an und wir sollen nun, in der Mensa zusammengetrommelt, uns darüber in Heiterkeitsausbrüchen erkenntlich zeigen und vor Freude auf die Schenkel schlagen. Statt dessen läßt ein lautes Murren die Stralsunder Admiräle die Augenbrauen heben. "Genossen, wir sind Seeleute und sie sind Seeleute, wir werden uns gut verstehen" konstatiert eine hohe Charge im Präsidium. Bei: "Wir sind Seeleute" intensiviert sich das Raunen im Studentenpulk und die militärischen Gesichter im Präsidium verfinstern sich. Die christliche Seefahrt war sich doch mit der kaiserlichen, seit der Erfindung des Einbaums, noch nie ganz grün.
Zu Ferienbeginn werden hundert "Schaulers" mit Sonderbussen zum Bahnhof Ribnitz-Damgarten gebracht. Die Reichsbahn bringt uns nach Stralsund, zur einmonatlichen Einweisung in die Geheimnisse des seeseitigen Schutzes des Vaterlandes.
Unsere Vorbereitungen für dieses wichtige Ereignis beschränken sich vor dem viel lieber gehabten Ferienbeginn, in der Beschaffung eines "Persil"-Karton. "ATA", "WOK", "GENTHINA" werden auch akzeptiert, aber Waschmittel-Aufdruck muß. Ferner als Anzugsordnung Jeanshose und Lederjacke, Stoffturnschuhe für 6,30 DM. Wenn nicht im Besitz, borgen! Weiß der Teufel, wer diese Anordnung heraushaut, aber sie wird von 100 Seefahrtstudenten einhellig befolgt, von den Fischern (den B-Patenten), den Nautikern (den A-Patenten) und den Funkern, (den F-Patenten), den einjährigen, den zweijährigen und den schon fertig Studierten. Von Egon diesmal nicht, der kommt gar nicht erst mit, der ehemalige Hauptmann befreit sich selbst und widmet sich seiner 350-iger Jawa.
In den zusätzlich von der Reichsbahn angehängten Sonderwagen, die uns nach Stralsund bringen, schmunzelt schon der Schaffner über die beeindruckende Ausstaffage seiner Passagiere. Jeder dieser Reisenden führt als Reisegepäck einen mit Bindfaden verschnürten Waschmittelkarton am Mann. Jeder Passagier ist mit blauer Jeanshose, Lederjacke und Stoffturnschuhen bekleidet.
Nur einige Kästen Bier lockern das monotone Bild der Einheitsbehältnisse auf.
Um unsere Ranger-Einheit noch werbewirksamer ins rechte Licht zu setzen, empfängt uns auf dem Stralsunder Bahnhof die Militärkapelle der Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" der Seestreitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik.
Dem letzten Waggons entsteigt jedoch ein gut organisierter Einheitshaufen, der es doch offensichtlich darauf angelegt hat, die Seeleute der NVA mit ihren Kampfblechen nicht so tierisch ernst zu nehmen, oder genauer gesagt, zu verscheißern. Ich hätte als Kommandierender in dieser Situation diesen Haufen in gedeckter Truppenführung auf Schleichwegen klammheimlich die fünf Kilometer bis zu "die Objekt" am Strelasund geleitet. Statt dessen lockt deftige Marschmusik jeden Stralsunder an die Fenster und den Straßenrand, um diese Werbeveranstaltung der DDR-Waschmittelhersteller zu begrinsen.
Der erste Stich geht voll an uns, einige weitere auch noch, aber das Spiel gewinnen die Kampfblech-Kommandeure. Die machen uns im Gegenzug auf der Schwedenschanze mit Heimvorteil ordentlich die Hacken warm. Jeden morgen früh um sechse:" Komm'se hoch, die Sonne lacht ihn' an!" beschließt unser pfiffiger Spieß, als Mutter der Kompanie. " Auf, auf, ihr müden Leiber, die Pier steht voller nackter Weiber!" und das evt. noch als Tatsachenbericht, wäre uns lieber gewesen.
Bei der Armee, Genossen, ist die Anrede: "Genosse....Dienstgrad " erfahren wir von besagtem Spieß im PAZ (Politisches Aufklärungs-Zimmer) zum erstmaligen Laufenlernen in Kieler Knabenuniform. Sofort nach dieser ersten Unterweisung, haut Kohli den Spieß an: "Gestatten sie Genosse Dienstgrad austreten zu dürfen!" "Solche Blöden wie ihr, sind mir in meiner langjährigen Laufbahn bei der NVA noch nie untergekommen." beteuerte der Spieß täglich dreimal, während er sich förmlich das Futter aus dem Kulani reißt, um aus uns wenigstens annähernd solche Koniferen zu formen, wie er eine ist.
Ich möchte hier die NVA nicht lächerlich machen oder schlechter als sie war. Ein großes Glück für Deutschland, daß die kämpfende Truppe nie eine ernsthafte Kostprobe ihres Könnens abgeben mußte. Nur in diesem speziellen Fall, der Einberufung von 100 Gleichgesinnten, die sich alle mit Vornamen kennen und eisern zusammenhalten gegen die ungeliebte Befehlsgewalt, überfordert das Latein der Armee-Pädagogen.
Ihre bisher immer greifenden Mechanismen funktionieren nun unverständlicherweise nicht mehr. Das gespannte Verhältnis zwischen der christlichen Seefahrt und der Kriegsmarine verstärkt auch noch die Disharmonie.
Unsere Ausbilder prägte der Umgang mit den ihnen unterstellten Offiziersschülern der Seestreitkräfte, die während ihrer vierjährigen Ausbildung an der Schwedenschanze zum Leutnant zur See, entweder die Möglichkeit haben, blind zu gehorchen oder sich zu erschießen! Wir nutzen unsere außergewöhnlichen Möglichkeiten, erzeugen damit einen Druck, der natürlich erheblichen Gegendruck provoziert. Daher haben Durchschnitts-Wehrpflichtige in der NVA positivere Erfahrungen gesammelt, als sie meine Schilderungen jetzt wiedergeben:
Oberleutnant Häher ist der Oberkommandierende unseres Reservistenhaufens und wieder einmal ungehalten, das drückt sich darin aus, daß er uns schon vor dem zehnstündigen Unterricht statt um 06.00 Uhr um 04.30 Uhr per Alarm aus den Feldbetten scheucht und vorher vorsorglich zur Desorientierung die Sicherungen für die Beleuchtung herausdreht. Volle feldmarschmäßige Ausrüstung ist erwünscht und furchtbare Eile geboten, als ob der Klassenfeind schon vor den Toren Stralsunds stände. Vor dem Tor von "die Objekt" glotzt unser Oberbefehlshaber vergrämt auf seine Armbanduhr und meint, nach sieben Minuten hätte nach Schulstandard auch der phlegmatischste Offiziersschüler bereits nach der ersten Ausbildungswoche in Reih und Glied und voller Montur gestanden und bei ihnen trudelt der Erste so nach zwölf Minuten ein.
Oberleutnant Häher und sein Politoffizier sind vergnatzt und befehlen jetzt, nachdem sich der Haufen gesellt hat, einen verschärften Geschwindmarsch.
Ich schleppe neben zwei Decken auf dem Affen, Gasmaske, Zeltbahn, Gamma-Ausrüstung, Feldspaten, Kochgeschirr und dem halt nötigsten für solch einen Männerulk durch das Gelände. Dazu eine handliche Kolaschnikov. Viele meiner Leidensgenossen aber Granatwerfer und MG's. Längst ausrangiert, dennoch fünfzigtausendmal geölt und poliert und nur wegen des üppigen Gewichtes bei Übungen noch hochinteressant. Oberleutnant Häher trägt nur ein leichtes "Makarov"-Pistölchen und ist dementsprechend wesentlich mobiler.
Während eines Kontrollganges entlang der Truppe zuckt er zusammen: "Warum fährt denn das Schwein nicht gleich mit dem Fahrrad?" wird ihm hier aus der Masse und dem Morgengrauen heraus geboten. Die Fronten haben sich schon so verhärtet, weil nur noch gegenseitiges Maßnehmen unseren Tagesablauf bestimmt. Die standardisierte Frage: "Wer war das?" hätte sich der Genosse Oberleutnant wirklich kneifen können, aber er stellte sie stereotyp immer wieder. "Na gut" folgt dann nur noch und die Entdeckung eines Manöverteilnehmers, der zwar in vollster nur möglicher Montur und Staffage marschiert, aber ansonsten nicht in unseren second-hand Knobelbechern, sondern in seinen schönen weichen
Turnschuhen. Das schmälert natürlich enorm die Verteidigungsfähigkeit der Armee. "Sie melden sich umgehend nach Ankunft im Objekt bei mir" befiehlt Genosse Häher. (In "die Objekt" hätte jetzt der Spieß gesagt, aber der durfte in "die Objekt" noch abruhen um diese Zeit.)
Wir robben im bewachsenen Gelände um die Knochenmühle herum. Die Sechser-Reihen der Straße lösen sich auf schmalen Pfaden zwangsläufig zum Gänsemarsch auf.
Die Lage wird aus Kommandeursicht recht unübersichtlich.
Der Turnschuhträger wird nach ganz vorne delegiert, während hinten gewaltig gebremst wird. Wie zum Beispiel beim Taktieren während der Tour de France.
Nach dem Eintrudeln auch des letzten Geschwindmarschteilnehmers wartet Oberleutnant zur See, Genosse Häher auf die Meldung eines angeblich von ihm aufgebrachten Turnschuhträgers. Einem solchen, kaum vorstellbar das es ihn geben soll, schlägt prophylaktisch die ehrliche Entrüstung der gesamten Truppe entgegen.
"Wer rückt denn, wenn feldmarschmäßig befohlen ist, in Turnschuhen aus. Das ist ja unerhört!" ist die einheitliche Truppenmeinung.
"Na gut, erstes Glied vier Schritt vor, zweites Glied zwei Schritt vor!" heißt das Kommando.
Na, das hatten wir schon öfter.
Unsere Empörung ebbt ab. Ein Turnschuhträger wird bei der intensiven Kontrolle des Schuhwerkes zwischen den gelichteten Reihen nicht aufgebracht. Ein jeder trägt nach Dienstvorschrift 0815 die Knobelbecher, in denen sich vorher schon mehrere gepeinigte arme Schweine deftige Blasen verschafften.
"Na gut" tönt Oberleutnant Häher nach der für ihn unbefriedigend ausgefallenen Schuhwerkskontrolle. "Na gut" ist zwar kein militärisches Kommando, aber erfahrungsgemäß folgt dieser von ihm strapazierten Redewendung ein solches, meist unangenehmes. In diesem Falle: "Abrücken zum Exerzierplatz."
Der Schulrekord des bisher besten Offizierschülers läge bei 42 Sekunden für die dort aufgebaute Sprintstrecke, mit Eskaladier- und Hauswand und dem Drahtverhau, der robbend zu unterkriechen ist. Viel Zeit bis zum Waschen und Einrücken in die Unterrichtsräume bleibt nicht mehr, somit wird befohlen, daß jeder der tauben Geschwindmarschteilnehmer unter 50 Sekunden zügig und Schlag auf Schlag über die Sturmbahn zu hetzen hat.
Genosse Häher baut sich am Start breitbeinig auf, entblößt seine Armbanduhr und schickt den angehenden Funkoffizier Rosenthal, genannt "Kohli" der F1B als ersten in die Spur. Ausgerechnet den, denken wir, aber dessen Mentalität kennen eben auch nur wir. "Kohli" ist nicht so wie ich mit der leichter zu händelnden Kolaschnikov verteidigungsmäßig bestückt, sondern mit dem alten Karabiner K98 der deutschen Wehrmacht und dieses Gerät hat Überlänge. Damit fuhrwerkt "Kohli" sofort nach dem Startkommando übermotiviert in den über ihm kreuz und quer verdrahteten Verhau, weil das lange Gewaff auf seinem Rücken sich darin sofort recht kompliziert und unlösbar verfängt.
"Kohli" bemüht sich redlich, auf der Sturmbahn eventuell sogar den Schulrekord zu brechen, aber leider vergeudet er alleine schon über 3 Minuten auf den ersten zwei Metern im Drahtverhau. Schließlich schaut sein Stahlhelm neben dem langen Karabiner oben aus den Spanndrähten heraus, wo ihn letztendlich seine Kumpels nach Abnahme des Helms und Lösen des Gewehrriemens und Entwaffnung befreien müssen.
"Na gut, die Übung ist beendet, Fertigmachen zum Unterricht" lautet das offizielle Kommando und: "Solche Blödmänner hatte ich noch nie in meiner Truppe" der private Kommentar von Oberleutnant Häher.
Ab zwei Mann wird in "die Objekt" marschiert, befiehlt unser Lieblingskommandeur, der Spieß. Eine Zweimann-Marschiereinheit bildet z. B. die tägliche Backschaft, die vor jeder Mahlzeit in der Kantine den entsprechenden Tischdienst zu realisieren hat. Der längste unserer Hundertmann-Truppe mißt ca. zwei Meter, der kürzeste etwas über eineinhalb Metern. Die Organisierung der Backschaft obliegt unserer eigenen Befehlsgewalt. Der längste und der kürzeste werden zum Tischdienst abkommandiert. Das ergibt sich rein zufällig so.
Oberleutnant Häher liest uns nach dem Mittagessen angetreten vor "die Objekt" die Leviten. Das tägliche Ritual während jeder Mittagspause zur bewußt gewollten Verkürzung derselben. Danach geht's wieder bis 18.00 Uhr zum Hydro-Akustik-Unterricht und der Ableitung der vierundzwanzigsten Formel der Schallausbreitung unter Wasser. Während einer 14-jährigen Schulzeit bekommt man eine Menge hohlsinnigen Ballast eingehämmert, den man sofort nach bestandener Prüfung getrost zur Entlastung der grauen Gehirnzellen darin löschen kann. Die Armee setzte dem Ballast aber das Sahnehäubchen auf. Hydroakustik, abfällig auch Schlammhorchen genannt, in mehreren 10-stündigen Vorträgen am Stück, in 24 Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung unter Wasser pädagogisch ganz pfiffig und anschaulich rübergebracht. Ich bin angehender Seefunkoffizier und an Wellen interessiert, die sich in Höhen von 12 Kilometern über dem Wasser und nicht unter Wasser ausbreiten. Sollte mein Dampfer absaufen, kommt der Funkverkehr doch ohnehin zum erliegen. Zur Verbesserung der Aufnahmefähigkeit für die Ableitung der 24. Schlammhorcher-Formel hält uns während der Mittagspause also Oberleutnant Häher vor "die Objekt" hellwach. Plötzlich erklingen harte, exakt militärische Kommandos, die des Hähers auch nicht zu überhörende belehrende Worte noch übertönen. Die Zwei-Mann-Backschaft kehrt nach Erledigung ihrer Aufgabe zurück. Vorn der Niedrige, hinter ihm der Hohe, beide mit bunter Bestecktasche, im Gleichschritt marschierend, wie befohlen. "Zug" kommandiert der Niedriggewachsene, während die marschierende Zwei-Mann-Einheit zwischen dem in seinen belehrenden Ausführungen unterbrochenem Oberleutnant und uns aufgereihten Stillgestandenen im Stechschritt durchdefiliert.
"Vordermann, Seitenrichtung, Ruhe im Glied", befiehlt dann abschließend noch der Kurze dem Langen, bis auf das exakte "Halt" auf dem richtigen Fuß das "Nach links weggetreten" folgt.
Wir schlagen angesichts dieser bewundernswerten Leistung vor, die Truppe in 50 Zweierzüge zu splitten, zur Verbesserung unserer sonst recht miesen Marschierleistungen.
Auch im nächsten Jahr und somit den nächsten, aus unserer Sicht geklauten Semesterferien, albere ich zusammen mit den anderen duften Kumpels wiederum in "die Objekt" herum. Ich habe es bereits zum Obermaat gebracht. Mein Rangabzeichen, so einen modifizierten Anker, befestige ich mit ein paar Stichen an meiner Kieler Knabenbluse.
Eigentlich bin ich nur von der Backbord-Seite aus als höherer Dienstrang, als der eines Matrosen zu identifizieren. Aber das ist nicht mein Problem.
Ich habe das unlukrative Amt des VS-Verantwortlichen. Befehl ist Befehl.
VS wie Verschlußsache. Ich hole in einer eigens dafür konzipierten Aktentasche, je nach Unterrichtsbedarf, im Hochsicherheitstrakt der "Schwedenschanze" die Schlüsselunterlagen für die codierten Funksprüche zur Führung der Kampfbleche, die in der Regel allerdings die Ostsee-Hoheitsgewässer der Deutschen Demokratischen Republik nur zu Freundschaftsbesuchen in die Nachbarhäfen der polnischen und sowjetischen Waffenbrüdern verlassen. Vorausgesetzt, der Wind bläst nicht stärker als Windstärke sechs. Da fallen der Seekrieg und auch die Freundschaftsbesuche aus.
Ich bringe meine gegen Empfangsquittung und Sonderausweis empfangenen Verschlüsselungs-Unterlagen zum Hochsicherheitstrakt zurück, als eine herbe Kommandostimme mein Vorhaben vorübergehend unterbricht: "Genosse Obermaat, Genossen Matrosen, zu mir!" Nachdem ich auf dem Hacken eineinhalb Vollkreise drehe, entdecke ich den ziemlich Hohen, baue mein Männchen und melde: "Genosse Korvettenkapitän, Obermaat Flegel mit GKDOS-Unterlage zum Stabsgebäude unterwegs." Die zwei Matrosen, die mich angeblich grußlos passierten und ich werden an die weiß getünchte Wand der Kantine gestellt und mit einer "Penti" fotografiert. Die goldfarben beblechte "Penti" ist nun wirklich der lächerlichste Fotoapparat der Warschauer Vertragsstaaten. Beim Losknipsen fliegt rechts ein Knüppel aus dem Apparat, beim Hineindrücken desselben, wird dann der Film weiter transportiert.
Derart ausgerüstet, werden wir drei Missetäter also lichtbildnerisch von dem Flottenadmiral abgelichtet und unsere Konterfeie am nächsten Tag auf der Wandzeitung zur Verbesserung der Mißstände in "die Objekt" aufgehängt. Ich, weil ich als Obermaat nicht auf die Ehrenbezeugung meines, an der Backbordseite meiner Bluse angehefteten Ankers bestanden habe und die beiden Matrosen, weil sie diesen an meiner Steuerbordseite nicht gesehen haben.
Jeder Tag ist schön!
Ich habe nur 60 solche Tage in "die Objekt" verbracht, und auf Grund meiner mittlerweile auch kriegstauglichen Kenntnisse einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Nach diesem werde ich wegen "aufsässigem Verhalten" aber wieder degradiert. Von den 60 Tagen hätte ich auch ohne meinen Kumpel Jochen etliche im betriebseigenen Knast der Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" verbracht. Nach dem der Spieß mit seinem IQ von etwa 3,5 meinen Spind umgekippt hat, weil der Pfalz eines Taschentuches um o,5 Millimeter nicht auf Kante mit dem darüber liegenden bündig lag. Ich vertrete als jugendlicher Heißsporn die Meinung, daß derjenige, der meinen Spind umkippte, diesen auch wieder einräumen müsse.
Jochen räumt ihn ein, normgerecht.
So, daß die Erfinder dieses Männerulkes, nach dem Pappstreifen in den auf Zehntelmillimeter auf Kante gelegten Taschentüchern die Gefechtsbereitschaft erhöhen sollen, nichts mehr zu meckern haben.
Ohne meinen Kumpel Jochen hätte ich jetzt, den evt. interessierten Lesern, das Innenleben des Armee-Knastes nach 6 Tagen "Dicken" geschildert.
Später dann fege ich bei der Waffenausbildung an irgendeiner Zwillingsflak dem Spieß die Obermeister-Mütze vom Kopf, weil ich mit dem Drehmechanismus ganz rasant die Rohre ihm entgegen, statt von ihm wegschwenke. Das ist meinerseits aber ein reiner Bedienfehler!
Die aufregenden Erlebnisse während meiner lumpigen 60-tägigen Armeezeit würden locker 100 Seiten dieses Buches füllen, denn jeder Tag dort war enorm aufregend.
Morgens um 06.00 Uhr Alarm. Ausrücken in voller Staffage. Vier Tage Feldlager, Schießausbildung.
Wir wandern durch ebenes Land über Wiesen und Felder, zwischendurch immer mal simulativ angegriffen durch Tiefflieger von rechts oder auch von vorn. Auch Atomares hält unseren Marsch nicht auf, denn wir verkriechen uns bombensicher in unsere am Mann geführten Gammapäckchen und erhalten somit unsere Kampfkraft.
Meiner Gasmaske fehlt das Gummi-Flatterventil, das haben meine Vorbenutzer schon entfernt. Ich nehme das begrüßend in Kauf und muß vor Anstrengung keuchend, die Atemluft nicht durch den Filter und Schlauch saugen, sondern kann sie leicht und ausreichend der Außenluft entnehmen. Tage später dann kommen mir aber heftige Bedenken, wir müssen mit unserer Ausrüstung in die Tränengaskammer. Ich borge mir eine Maske von den schon Drangewesenen und sehe mich im Kreis mehrerer ebenfalls Bedürftiger.
Unser Wanderweg zum Feldlager führt jetzt über eine Kuhkoppel. In mitten dieser liegt ein kleiner Tümpel, von Kühen ziemlich zertrampelt. Rund herum dehnt sich die endlose Wiese. Die linke Wegmarkierung am Ufer bildet Oberleutnant Häher, die rechte sein Politoffizier. Zwischen beiden hindurch führt unser Weg direkt hinein in das Feuchtbiotop. Dabei ist einzig und alleine darauf zu achten, daß die Waffe nicht naß wird. Die ersten Züge der Nautiker sacken lediglich bis zum Koppelschloß weg, die letzten Truppenteile der 100 Mann, die Funker, retten nur mit erhobenen Händen trocken ihre Bewaffnung zum gegenüberliegenden Ufer des kleinen, aber nun vollends zertrampelten Tümpels.
Hastig geht es blasenbildend weiter, hastig müssen nach Ankunft die Zelte aus den Dreiecksbahnen konstruiert werden, aber keiner hat davon eine blasse Ahnung. Als wir den Campingplatz schnucklig in die Landschaft drapiert haben, müssen wir wieder abreißen, da ein militärisches Zeltlager, auf Wunsch des Genossen Häher, in U-Form erstellt werden muß. So einen Scheißhaufen habe er noch nie gesehen, läßt er uns lautstark wissen.
Wir bauen um und hasten zum Schießen. Besser zum Danebenschießen, weil jetzt nur noch Biathlon-Profis etwas treffen würden.
Der Leiter des Schießens, Oberleutnant Häher, überblickt in Badehose mit Sonnenbrille vom oberen Rand des Schießstandes auf einem Gartenstuhl die Szenerie und meckert herzzerreißend über unsere ausbleibenden Einschläge. Wir schießen zu dritt, liegend auf drei Pappkameraden. Kolaschnikov, Einzelfeuer 9 Schuß im Magazin und treffen nichts. Als die jetzt diensthabende Dreierformation das Gemecker des Erholungsuchenden zu sehr nervt, kommt vom rechten Flügelmann der Schützenkette leise zischend das Kommando: "Alle auf den linken". Der linke Klassenfeind hat dann 13 Volltreffer, während die andern beiden unversehrt davon kommen. Das befriedigt den Genossen Oberleutnant auch wieder nicht, zumal die drei Schlumpschützen die natürlich falsche Auffassung vertreten, es könne jeder auf einen der drei Pappkameraden schießen, den er für besonders gefährlich hält. Keiner hat uns das vorher anders erklärt!
Wir dallern und ballern vier Tage in der Gegend umher und kacken hinter die Büsche. Nur Reinlichkeitsfanatiker schlagen sich zur gelegentlichen Körperreinigung zum ziemlich entfernten Strelasund durch, aber dessen Ufer sind von dichtem Schilf gesäumt, verkrautet und verschlammt.
Beim nächsten Schießen hoppelt ein kleiner heuriger Hase durch die Talsohle des Schießstandes. Oberleutnant Häher schreit hektisch nach einem vollen Magazin für die diensthabende Kolaschnikov und entlädt selbiges dann auf das kleine Häschen zu Füßen der Pappkameraden. Eine Abordnung wird zum Herbeischaffen des Wildbrets abkommandiert.
Diese kehrt mit leeren Händen und der Meldung zurück: "Genosse Oberleutnant, keinen erschossenen Hasen angetroffen." "Na dann hab ich den pulverisiert" kommentiert der Wilddieb diese Meldung.
Nach zwei Stunden haben die gerade diensthabenden Schützen die strahlend weiße Blume des hoppelnden Häschens erneut vor den Visieren. Sie unterbrechen das Schießen und machen umgehend Meldung: "Genosse Oberleutnant, pulverisierter Hase wieder anwesend."
Vier erlebnisreiche Tage gehen zu Ende. Wir brechen die Zelte ab, die Natur atmet hörbar auf.
Der erlebnis-pädagogische Ausflug lief aus Sicht des Kommandierenden anscheinend wieder nicht optimal. Er ist ungehalten.
Weil von drei mitzuführenden Decken aber wirklich am Mann nur noch zwei Platz finden, darf jeder Kämpfer, wie schon beim Anmarsch, eine per LKW zurücksenden. Statt diesen vom Kommandierenden gereichten kleinen Finger dankend entgegen zu nehmen, reißen wir ihm fast beide Hände ab, in dem statt der einen zugestandenen Decke, generell zwei, ja teilweise drei Decken im Seesack auf dem LKW verstaut werden.
Das entgeht dem wachsamen Auge der Kompanieführung nicht.
Eigenhändig prüft der Oberleutnant das Gewicht des Marschgepäcks der ihm am nächsten stehenden, abmarschbereiten Kopfglieder. Da er die ersten fünf Rucksäcke allesamt für zu leicht befindet, verbessert er mit Zuhilfenahme des Feldspatens deren Gewicht, durch Hinzugabe des reichlich verfügbaren Aushubs unserer Zeltgräben. Danach beschleunigt er diesen Prozeß flächendeckend durch Pärchenbildung und jeder schaufelt dann unter Aufsicht seinem Partner ein paar mehr Kilogramm auf den Rücken.
Wie sich in "die Objekt" beim Ausschütteln unserer Klamotten herausstellt, leistete auch eine fette Kröte bei der Mehrbelastung ihres ahnungslosen Trägers ihren Beitrag. Diese zusätzliche Trainingseinheit bleibt unsererseits natürlich nicht unkommentiert.
Ich stehe im Zug F1a, am Ende der Kompanie. Aus dem Glied heraus beschimpfe ich per Zwischenruf die "doofe Kompanieleitung". Genosse Häher schaut genau in meine Richtung und mir fast in die Augen und ....er fragt nicht, wie üblich: "Wer war das?", er befiehlt: "Vortreten!"
Ich zucke mit der linken Hand, um meinen Vordermann zur Ausführung dieses Befehls zur Seite zu schieben. Dieser ist Parteisekretär meiner Parallelklasse und zischt, meine Reaktion bemerkend: "Stehen bleiben!" durch die Zähne.
Es folgt eine bedrohliche Stille.
100 Mann stehen diesmal wirklich "stillgestanden".
Vor meinem Vordermann steht, herausgetreten Meister Witt, mein Zugführer und Klassenkamerad. "Meister Witt, wer war das?" fragt jetzt bedrohlich der von mir so herb beleidigte Kommandeur. "Ich habe nichts gehört" beantwortet Ali Witt ohne zu zögern in seiner ruhigen Art diese Frage.
Im Objekt wird er dann von einem Gremium hochrangiger Führungspersönlichkeiten heftig zur Lüftung dieses Geheimnisses bedrängt.
Hundert Mann und Ali schweigen wie ein Grab.
"Felix reiß dich am Riemen, du bringst mich und uns alle bei diesem Verein hier in Teufels Küche!" ist Alis wohlgemeinter Rat, nach seinem standhaften Verhör. Alfred Witt war ein prima Kumpel, starb aber nach unserer Armeezeit bereits nach zehn Jahren Seefahrt an einem Krebsleiden.
Nachdem auf unserem abgebrochenen Campingplatz Meister Witt keinen Beitrag zur Aufklärung des schwerwiegenden Disziplinarvergehens leistet, kommt das übliche inoffizielle Kommando: "Na gut". Eingeweihte wissen jetzt, daß diesem stets ein offizielles und generell äußerst unangenehmes folgt und das heißt für diesen speziellen Vorfall, statt: "Rechts um" schlicht und einfach "Links um".
Unseren 100 Mann starken Wanderverein führt stets der Zug der Nautiker 1. Studienjahr an. Die Kameraden haben an der Wustrower Seefahrtschule noch 4 Semester bis zum Kapitän auf großer Fahrt vor sich und reagieren auf die Drohungen, militärischerseits ihr Studium negativ zu beeinflussen ziemlich "algerisch". Wir übrigen Mitmarschierer haben dafür Verständnis.
Wir beiden Funkerzüge, F1A und F1B haben glücklicherweise unseren Fachschulabschluß von Wustrow schon in der Tasche, aber kein Patent.
Erst Armee, dann Funkzeugnis, dann anmustern!
Pädagogisch unwahrscheinlich ausgebufft läßt Oberleutnant Häher aus dieser Tatsache heraus, die beiden Funkerzüge in ihrer ständigen "LMA"-Stimmung immer ganz achtern marschieren, dort hinten können sie am wenigsten Mist bauen. In dieser Standardformation ist unser "winning team" nun auch angetreten und hat sich gegenseitig den Dreck in die Ranzen gehauen.
Vorgesehen ist danach "Rechts um" und die führenden Nautiker hätten mit uns im Schlepp schon bald die Straße von Prora nach Stralsund erreicht und auf dieser wacker fürbas marschierend, mit einem Lied auf den Lippen und stolz geschwellter Brust, wegen der hervorragenden Schießergebnisse, auch bald "die Objekt".
Wegen "Na gut" kommt "Links um" der erste Funkerzug leistet somit die Führungsarbeit und rechter Flügelmann ist "Kohli", der mit dem langen Karabiner im Drahtverhau der Sturmbahn. "Kohli" schleppt stoisch seinen verdreckten Rucksack. Aber das hätten die Offiziellen sich wesentlich und hartnäckig im schnelleren Tritt gewünscht.
"Kohli" jedoch ist nicht kommunikativ. Er hat abgeschaltet und hört, sieht und spricht nichts mehr.
Das Gelände ist unwegsam, wir müssen hintereinander wandern. "Kohli " hat seinen Feldspaten am Koppel rein zufällig so drapiert, daß bei jedem Schritt sein Kochgeschirr mit einem lauten Gong dagegen ballert. Das ergibt den Marschtakt für die gesamte Truppe. Den gemütlichen Wanderschlag finden alle recht angenehm, bis auf die Obersten. Der Oberleutnant tänzelt aufgeregt, nur mit seinem Pistolentäschchen belastet, an der weit auseinander gezogenen Truppe auf und ab und muß dabei oft über Stock und Stein hüpfen, weil den schmalen Weg ja die schwer schleppende Kolonne belegt.
"Schließen sie auf, gehen sie schneller, machen sie den Stahlhelmriemen zu, krempeln sie die Ärmel runter," heißen die aufmunternden Kommandos.
Es ist warmer August.
Nebst dem Dreck in den Rucksäcken tragen wir kratziges blaues Kieler Knabenzeug und geölte Stahlhelme.
Aber wir haben eine herrliche Erfrischung vor Augen.
Die ausgesuchte Wanderroute führt auf Umwegen wieder direkt zu dem uns vom Hinmarsch schon bekannten Badeparadies.
Die beiden "Öberschten" bilden wieder die Begrenzungspfähle. Niemand muß eingewiesen werden, es bedarf keinerlei Erklärungen. "Kohli" rückt dem Kommandeur so dicht auf den Leib, wie er es in seinem verkeimten Zustand nicht einmal bei seiner Braut täte. Zwischen die beiden paßt nur noch "Kohlis" Zeigefinger. Mit diesem tippt er dem Oberleutnant auf einen goldenen Knopf seiner gepflegten Uniform: "Solche Leute wie sie, krepieren im nächsten Krieg zu aller erst."
Wir wenige Mithörende der ersten Reihen erbleichen.
"Das kann sein, durch!" ist die uns verblüffende Reaktion und dabei bleibt es sogar.
Auf der Straße meint Werner Müller, der in der Wehrmacht die letzten Kriegstage als Hitlerjunge erlebt hat: "Kohli, dafür hätten dich die Nazis standrechtlich erschossen!" "Kohli" hat aber wieder jegliche Kommunikation eingestellt.
Wir planschen wieder durch das Feuchtbiotop, genießen das Badevergnügen und suhlen uns schon fast wie die Wildschweine. Dementsprechend ist danach unser out-fit!
Auf der breiteren Straße überholen uns dann befehlsgemäß die Nautiker des 1. Studienjahres, aber die motzen das Bild des dahintrottenden Schweinehaufens auch nicht nachhaltig auf, da sie diesmal als letzte das aufgewühlte Erlebnisbad durchqueren, tauchen sie jetzt auch weit über die Sommermarke ein.
Kein zackiger Marschblock stolz geschwellter Brüste, wegen den hervorragenden Schießergebnissen mit "Spaniens Himmel" als Lied auf den Lippen, passiert die grinsende Torwache, sondern eine triefende, weit auseinander gezogene Rotte.
Meine Freunde Jochen Brosig, Werner Sander und ich kommen spätabends vom Landgang zurück. Ich war noch nicht oft in der Stadt, weil ich mich vorher der widerlichen Landgangsmusterung beim Spieß unterziehen muß und der findet nach seinen jahrzehntelangen Erfahrungen, andere hat er nicht, immer einen Grund, seine widerspenstigen Untergebenen zur Erhöhung der Gefechtsbereitschaft besser in "die Objekt" als an Land zu lassen.
An diesem Wochenende ist mir der Landgang mit viel Aufwand geglückt und wie man gleich sehen wird, er war ein voller Erfolg.
Wir drei trinken im "Gelben Hund" ("Goldener Löwe") ein Bierchen und wagen auch ein Tänzchen. Meine Tanzpartnerin trägt ein zitronengelbes Kleid: "Rück mir nicht so dicht auf den Pelz", protestiert sie, nach dem ich sie herzhaft in den Arm nehme. Tide hieve, wie der Seemann sagt. Sie drückt mich von sich weg, ihr zitronengelber Fummel ist in Höhe meines Koppels glänzendschwarz.
"Dein's ist doch sicher auch mit einem halben Pfund Schuhkreme eingeschmiert?" fragt die "dancing queen" dieser Garnisonsstadt. "Na klar" gebe ich zu, "sonst hätte mich der Spieß ja erst gar nicht aus "die Objekt" gelassen! Ich mußte ja sogar meine Schuhsolen putzen, jedenfalls den Teil davon, der sich Steg nennt!"
Im Lokal halten sich zehn betanzungswürdige Mädels und etwa 80 Seemollies auf.
Selbst vor Mädels, die sich auch mit fünfzehn Bieren nicht schöner saufen lassen, baut eine halbe Kompanie Seemollies beim Einsetzen der Musik artig einen Diener.
Jetzt, bei diesem Tanz, ändert sich die Szenerie.
Wir drei nutzen die unverhofft sich bietende Chance, greifen uns die schnuckligsten Mädels und können mit diesen und noch zwei älteren Ehepaaren auf der leeren Tanzfläche schon fast einen Turniertanz abliefern. Bei allen vorherigen Runden standen die Tanzenden Schulter an Schulter gepreßt und konnten maximal nur mit dem Mors wackeln. Dabei schmierten die Seemollies die Schuhkreme ihrer Koppel an die Ballkleider ihrer Mädels.
Die Kapelle spielt "La Paloma".
Nachdem alle Kieler Knabenanzüge deshalb demonstrativ sitzen bleiben, stehen sie nun dennoch auf und umringen nun allesamt die Tanzfläche, als ob wir drei gleichsam Uniformierten eine Extratour abliefern. Nur klatschen die Berufskollegen nicht, sie sind maßlos entrüstet. Die erst vorgestern Rekrutierten, bei denen der Arm noch krumm ist vom Koffertragen, drohen mit diesem am heftigsten.
"La Paloma" tanzt kein Seemann, das ist eine nicht zu verzeihende Pietätlosigkeit gegenüber diesem ehrenwerten Berufstand!
Eine Beleidigung von irgendwo und irgendwann, auf irgendeinem Schiff einmal Untergegangener. Nichts Genaues weiß aber nicht ein einziger aus der ersten Reihe dieser Protestdemo. Je nach Charakter hat die eine niedere Charge fast Tränen in den Augen, die andere ballt dagegen die Fäuste.
Nachdem wir die Mädels zum Platz begleitet haben, geht das Zeremoniell weiter.
Jochen hat sein Seefahrtsbuch dabei. Damit fuhr er schon vier Jahre beim Fischkombinat am Armeeschießgebiet Adlergrund vorbei, nach Labrador, der Georgebank oder in die Barentssee und das auch, wenn der Wind recht heftig blies und der Trawler vereiste.
Der am heftigsten gestikulierenden Pappnase hält Jochen nun sein Seefahrtsbuch unter die selbe. Das beruhigt augenblicklich die Aufgebrachten.
Wir verlassen die Kultstätte für Deutsche Seekriegsgeschichte. Getrunken haben wir nicht viel und sehen uns ziemlich nüchtern für den Heimweg auf dem Markt nach einem Taxi um. Der Weg zur Schwedenschanze ist weit. Ein Matrose aus Parow gesellt sich zu uns. Seine Einheit in Parow liegt noch ein paar Kilometer weiter draußen in der Taiga.
Der Taxifahrer bringt erst den Parower Matrosen zu seiner Kaserne und fährt dann, nicht aus der Stadt, sondern eben aus der Taiga kommend vor "die Objekt" vor. Genau vor dem Schilderhäuschen des Wachhabenden läßt uns freundlicherweise der Fahrer aussteigen.
Unsere traute Umgebung mit ihrem anheimelnden Flair hat uns wieder.
"Wie können Menschen in einer derartigen Kulisse nur ihr ganzes Berufsleben verbringen und die Hälfte davon, mit Grüßen von Vorgesetzten vergeuden?" geht mir durch den Kopf.
Wir zücken unsere Ausweise, grüßen artig den Wachposten und grüßen nach drei Schritten den GOvD (Gehilfe des Offizier vom Dienst). Von diesem werden wir freundlichst, nach Art des Hauses wieder willkommen geheißen:
"Wissen sie, daß sie hier nicht halten dürfen? Hier ist Halteverbot!"
Wir machen Männchen und Meldung und erklären dem diensthabenden Gehilfen, daß das Taxi durch einen Taxifahrer chauffiert wurde, was ein GOvD ja nicht wissen kann. Eben dieser Chauffeur habe auch das Fahrzeug direkt vor dem Eingang zum Halten gebracht.
Unsere Erläuterungen sind anscheinend zu hoch gestochen für den Offizier, denn er fragt im Gegenzug und gehobenem Ton: "Kennen sie die Verkehrszeichen nicht?"
Die Situation eskaliert schon wieder leicht.
"Nöö, wir sind nur Radfahrer" beantwortet Jochen die Frage und bestätigt damit unseren Blödmannstatus. Nachdem wir unsere Namen und die Einheit nennen müssen, sind wir als solche völlig entlarvt. Als Reservisten fallen wir in dieser Kaderschmiede unter die Kategorie "nutzlose Zivilisten", die sogar zum richtigen Taxifahren zu dusselig sind, wie es sich ja gerade zeigte.
Als wir wegtreten dürfen, dürfen wir wieder antreten an höherer Stelle. "Genossen Maaten! Zu mir!" dröhnt es auf uns herab. Der OvD (Offizier vom Dienst) verfolgte aus dem Fenster seines Dienstzimmers im ersten Stock gelehnt, den Disput vor der Wache. Das dabei erzielte Ergebnis war aus seiner Sicht unbefriedigend. Vor seinem Schreibtisch stillgestanden, haben wir seiner ausgefeilten Rhetorik zu lauschen. Zu welchem Thema er doziert, kann ich nicht wiedergeben.
Ich höre nicht mehr zu.
Mich interessiert brennend die Telefonanlage in dem Dienstzimmer. Als ich mich während "stillgestanden" zur Betrachtung der selben zu weit vorbeuge, ziehe ich mir den Zorn des Genossen Kapitänleutnants zu.
Werner Sanders Interesse gilt der Landkarte an der Wand und Jochen findet auch etwas Interessantes zum Vertreiben der gähnenden Langeweile. Die nächsten 15 Minuten vergehen wie im Fluge mit den Erläuterungen, wie ein TGL-gerechtes "Stillgestanden" auszusehen hat. Die richtige Handhabung dieser Körperhaltung ist nahezu der ausschlaggebendste Faktor für die Kampfkraft jeder Armee und für die Ausbildungsergebnisse an der Seeoffizierschule "Karl Liebknecht" sowieso im ganz besonderen.
Und wir stehen stillgestanden, die denkbar ungünstigste Körperhaltung, für ein jetzt angebrachtes Nickerchen.
Die Daten unserer Rückennummer sind längst erfaßt. Fürs erste fliegen wir raus, bekommen aber am Montag einen Termin für Mittwoch, zur weiteren Erörterung dieses besonderen Vorkommnisses vor einem größeren Gremium.
Während der ersten beiden Unterrichtsstunden am Dienstag steht Politvorlesung auf dem Stundenplan.
Lehroffizier ist Kapitänleutnant Felkepräger, jener Offizier vom Dienst, der uns am Sonnabendabend zum Landgangsende so freundlich in "die Objekt" empfing und uns mit aufopferungsvoller Hingabe auf unser Fehlverhalten aufmerksam machte.
Seine monotone Stimme hat sich seit Sonnabend nicht geändert, mit der er während seiner Vorlesung die Heldentaten Marx, Engels und Lenins lobpreist. Kapitänleutnant Felkepräger belegt den Lehrstuhl Marxismus-Leninismus.
Jochen vertreibt sich in der ersten Bank die schon wieder aufkommende Langeweile durch das Studium der Heldentaten der Digedags in der neuen "Mosa", dem führenden Cartoon -"Magazin" der DDR.
Beim Studium dieser falschen Fetische wird er ertappt: "Wir kennen uns doch", bemerkt der Polit-Wissenschaftler. "Jawohl Genosse Kapitänleutnant. Für morgen haben wir einen Termin zum weiteren Kennenlernen."
Wir drei haben Termin.
Mindestens fünfzigtausend Mark Gehalt sitzen wieder im Präsidium. Wir drei Wochenendlandgänger stehen "stillgestanden" davor. Ziemlich lange.
Werner Sander und mir werden sechs Tage "Dicken" angedroht. Ich bitte darum. Das kommt nicht gut an.
"Aber dadurch werden sie noch verbitterter", konstatiert ein Menschenkenner mit einem ganzen Sternenhimmel auf den geflochtenen Schulterstücken.
Jochen wird eine heftige Mißbilligung ausgesprochen.
"Obermaat Flegel, Obermaat Sander, sie werden wegen aufsässigen Verhaltens degradiert" lautet schließlich das mich niederschmetternde Urteil.
"Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik" antworte ich und knalle die Hacken zusammen. "Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik" sagt der gebildete NVA-Soldat aber nur bei Auszeichnungen, nicht bei seiner Degradierung.
Da habe ich etwas verwechselt, aber im Schulungsunterricht beim Spieß haben wir das Stoffgebiet auch noch nicht gehabt.
Werner Sander bittet die Fünfzigtausend Mark Gehalt im Präsidium, wie ein Mensch, und nicht wie ein Offiziersschüler behandelt zu werden. Das findet dort überhaupt keinen Anklang und zieht ziemlich lange Erläuterungen nach sich, über den angeblich keinesfalls bestehenden Unterschied zwischen Menschen und Offiziersschülern.
Und wir stehen stillgestanden, die denkbar ungünstigste Körperhaltung für ein jetzt angebrachtes Nickerchen.
![]() Einmal Mittelmeer und zurück
Einmal Mittelmeer und zurück
Vier nervige Wochen Männerulk gehen vorbei, vier verbleibende Wochen Semesterferien leider viel schneller.
Im Dezember brandet im Semester F1A Beifall auf. Unser Fachgebietsleiter, das Funkurgestein Ernesto Leitzsch, hat beim VEB Deutsche Seereederei eine Praktikumsreise für seine Truppe klargemacht und kommt auch selbst mit. Ernesto hat keinen pädagogischen Abschluß, so kommt ein jeder mit ihm gut klar und alle gehen gern mit ihm auf Klassenfahrt ins Mittelmeer.
Ernesto ist eigentlich mehr Kumpel als "big boss".
Weihnachten verbringe ich zu Hause bei meinen Eltern und meinem Mädel. Silvester 1959 um 18.00 Uhr trete ich meine erste Wache auf dem Dampfschiff THÄLMANN PIONIER an.
Vorerst zwölf Stunden lang bis 06.00 Uhr in das neue Jahr hinein und in der Weiterführung zwei Jahrzehnte in mein kommendes Leben.
Ich bin, wie meine Klassenkameraden auch, als Decksmann gemustert. Das ist die Funktion eines "Schützen Arsch im letzten Glied", aber so wird niemand auf dem Schiff behandelt.
Wachhabender Offizier ist der Chiefmate, für Laien, so wie ich einer bin, der I. Offizier. Er hat zur Silvesterfeier seine Frau an Bord und ist ein umgänglicher Mensch. Er erklärt mir Deppen das Nötigste für meinen 12-Stunden Törn, insbesondere die Bedienung der Winschen zum fieren oder tide-hieven (teid) der Vor- oder Achterleinen, falls sich der Wasserstand im Hafenbecken ändert. Auf meine wißbegierigen Fragen hin, bekomme ich auch erläutert, daß mit tide-hieven das Straffen der Leine und mit wegfieren deren losegeben gemeint ist. Statt Winsch kann man aber auch Winde sagen.
Ich ziehe übermotiviert auf dem Schiff meine Kreise. Es ist nur ganz wenig Besatzung an Bord und die beginnt in der O-Messe schon bald mit der Verabschiedung des alten Jahres. Ernesto verabschiedet auch mit - und wie!
Ich schaue mir an Deck alles genauestens an und klettere auch auf die Masten, die Saling und das Peildeck.
"So jede Stunde kannst du schon mal in die O-Messe reinschauen und dir einen abholen" gestattet mir der Chiefmate. Dem widersetze ich mich nicht.
Oberleutnant Häher hätte jetzt in etwa befohlen: "Stillgestanden auf dem Gangway-Podest! Stündliche Meldung über Zustand von Mond und Sternen und etwaige Zivilistenbewegungen an der Pier!"
Die Party-Teilnehmer in der O-Messe zehren vom Vorrat einer 25-Liter-Milchkanne Ananas- Bowle, aber es stehen auch noch andere geistige Getränke zur Disposition. Der allstündlich von mir in der Messe abgefaßte Drink, hat nach einer Stunde an Oberdeck in der frischen winterlichen Seeluft seine Wirkung jedes mal wieder verpufft. So trete ich allstündlich immer wieder nüchtern an der Milchkanne an.
Um Mitternacht wird die laut Verfallsdatum unbrauchbare Signalmunition von der Brückennock aus verballert, soweit diese nicht für den gleichen Zweck mit nach Hause genommen wurde.
Bei meinen späteren Reisen habe ich bei jeder Silvesternacht in Küstengewässern das ungute Gefühl, wer in dieser Nacht auf See in Schwierigkeiten gerät, kann rot schießen bis zur Verdünnung. In dieser Nacht reagiert auf diese Signale niemand. Alle im Hafen liegenden Schiffe protzen um Punkt 00.00 Uhr ihrer Chronometer-Zeit für etwa 3 Minuten lang mit ihrem Typhon, ein imposantes Getute. Die Klangkörper der kleinen Barkassen mit ihrem hochtönigen eunuchischen Gepiepse beteiligen sich ebenso, wie die auf den mittleren Oktaven arbeitenden Schlepper und Kümos. Chef im Konzert sind natürlich die Großen. Je größer der Schlorren, je tiefer sein Baß.
Ein besonderes Instrument spielen die Dampfschiffe, wenn sie noch mit Dampf und nicht mit Druckluft tuten. Dampftuten können den Ton nicht halten. Bei ihnen kommt beim Ziehen an der Typhonleine als erstes statt Ton nur heißes Wasser, dem folgt dann im Wasserdampf nach einem Rülpsen ein tiefer Baß, der schnell in hochtönigere Oktaven anschwillt. Das ist sozusagen die blaue Mauritius unter den Schiffstuten.
Nach dem vom THÄLMANN PIONIER die letzte verfügbare 'unbrauchbare' Rakete mit ihrem grellen roten Magnesiumlicht am Fallschirm baumelnd zu Wasser (und hoffentlich nicht auf ein Rohrdach) sinkt, lichten sich auch die Reihen in der O-Messe. Auf dem Schiff und im Hafen kehrt zunehmend Ruhe ein.
Es wird langweilig.
An Oberdeck kenne ich mittlerweile schon jede Niete des Schiffes. Die anfänglich stündlichen Besuchsintervalle bei der vereinsamten Milchkanne verkürzen sich etwas. Ich fische ein zig-Meter langes Tonband Hand über Hand aus der noch viertel vollen Kanne. Dann gründle ich mit der Kelle und hole sie gehäuft mit Ananas-Stücken herauf. Die Bowle seie ich ab und esse die Stücke auf. Diesen Vorgang wiederhole ich tournusgemäß, aber ich vermute, wesentlich öfter, als noch volle Stunden bis zum Wachschluß verbleiben. Wir schreiben 1959, d.h. seit vier Stunden 1960, aber bis zu diesem Morgen, wußte ich doch noch nicht einmal wie Ananas geschrieben wird.
So gegen 05.00 Uhr habe ich wohl nach und nach ein oder zwei Kilo des wohlschmeckenden Bodensatzes der Milchkanne verdrückt, aber zu meinem Leidwesen springen davon in ziemlich kurzen Intervallen wohl drei oder vier Kilo aus meinem Gesicht, immer über das Schanzkleid die Bordwand hinab.
Die Bowle erweist sich jetzt als ziemlich vollmundig.
Bei der Gelegenheit lerne ich die vorteilhaftere Eigenschaft der Leeseite des Schiffes kennen und die Luvseite diesbezüglich zu meiden. Später im aufgewühlten Ägäischen Meer kommt mir das hier erworbene Wissen zugute, seekrankheitsmäßig gesehen.
Um 05.00 Uhr habe ich Herrn Pinkawa, den Koch zu wecken. Ich lege beim Uulf-Rufen eine Pause ein und erledige das termingerecht. Der Koch hüpft aus seiner Koje, zieht in der Kombüse eine Kiste Kartoffeln unter dem Herd hervor, die muß ich schälen. Bis 05.30 Uhr schäle ich mit meiner Restenergie im Marine-Vierkantschnitt auch noch einige Tüften. Gegen 05.15 Uhr haue ich verfrüht "Gebelchen" eigentlich aus meiner Koje. Er hat sein Fischlandmädel dabei und braucht im 'Judentempel', in dem wir über dem Propeller und der Rudermaschine untergebracht sind, meine sturmfreie Kammer. Darin sind meine drei übrigen Mitschläfer nicht an Bord und ich haue mich, rechtschaffen schlafbedürftig irgendwo hin. Für diesen Liebesdienst muß "Gebelchen" eine halbe Stunde früher ablösen und die dreiviertel volle Kiste Granaten abdrehen.
Nach Neujahr wird es richtig betriebsam an Bord und in unseren Unterkünften beängstigend eng. Jetzt sind alle 16 Teilnehmer der Klassenfahrt vorhanden.
Wir bewohnen die vier Viermannkammern im "Judentempel". So heißt volksmund-seemännisch das kleine Deckshaus auf dem Achterdeck abgerundet, so wie das Heck des Dampfers. Somit haben die beiden Viermannkammern mit Blick nach achtern, die Form eines Tortenviertels.
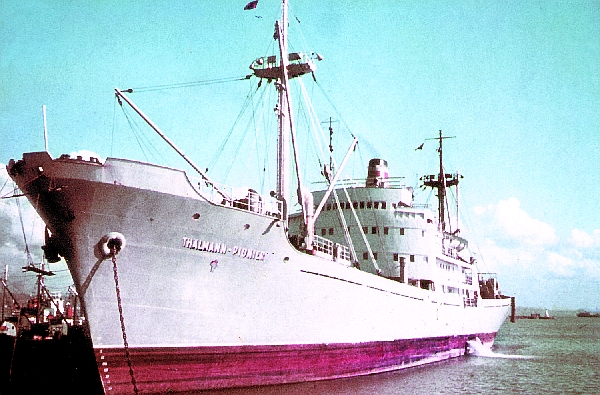 Die eine linke Schenkellänge des Tortenstücks hat genau die Länge einer Doppelstock-Koje, die rechte Gerade ist 70 cm länger, Kojenlänge plus Eingangstür. Das Interieur dieser Suite verfügt neben den beiden Doppelstock-Kojen noch über einen Tisch, einen Blechschrank, einen Hocker und drei Rohre eines Heizkörpers. Licht und Luft findet durch ein in die Rundung eingelassenes rundes Bullauge Zugang.
Die eine linke Schenkellänge des Tortenstücks hat genau die Länge einer Doppelstock-Koje, die rechte Gerade ist 70 cm länger, Kojenlänge plus Eingangstür. Das Interieur dieser Suite verfügt neben den beiden Doppelstock-Kojen noch über einen Tisch, einen Blechschrank, einen Hocker und drei Rohre eines Heizkörpers. Licht und Luft findet durch ein in die Rundung eingelassenes rundes Bullauge Zugang.
Der winzige Tisch ist an einer Seite der gebogenen eisernen Wand angeschweißt, die andere Seite stabilisiert eine am Fußboden angeschweißte Stütze. Der eine verfügbare runde Schemel ist jetzt im Hafen benutzbar. Auf See verbleibt er unterm Tisch an dessen einem Bein gelascht, damit er bei Seegang nicht in der Kemenate umherpoltert. Der Schrank ist ein blecherner lindgrüne Werkspind, nur vierfach geteilt, so hat jeder der vier Bewohner einen größeren Briefkasten zum Verstauen seiner Habe. Wir vier in der Kammer brauchen drei Tage, um uns zu arrangieren. Der verbleibende Freiraum in der Kammer bietet, bei angelegten Armen, immer nur einem Bewohner Raum zum An- oder Auskleiden, die drei verbleibenden Mitbewohner müssen dann von ihren Kojen aus dem Dressman zusehen oder hinausgehen.
Wir verstehen uns alle gut und meistern die atemberaubende Enge.
Richtig aus dem Weg gehen kann sich auf einem Dreitausendtonner ohnehin niemand.
Wir lernen die Schwimmwesten zu gürten und prägen uns die in der Manöverrolle zugeteilten Aufgaben ein, die zu erfüllenden Pflichten bei Bootsmanöver, Lecksicherung, Feuerlösch oder Mann über Bord. Ein über der Koje hängendes Kärtchen frischt im Manöverfall diese Kenntnisse aber auch noch einmal auf.
Ernesto teilt unsere Truppe in Seewachen ein.
Auf den Großschiffen der Reederei geht der Chiefmate die 4-8-Wache. Er zieht demnach um 04.00 Uhr und um 16.00 Uhr für 4 Stunden auf Wache. Der II.Offizier geht 0-4-Wache und dem III.Offizier bleibt die ungeliebte 8-12-Wache.
Wir werden den Wachoffizieren zugeordnet und verbringen von den vier Stunden eine Stunde und zwanzig Minuten am Ruder, danach die gleiche Zeit auf Ausguck, meist auf der Back, danach schauen wir Claus Mohs, dem großen Meister im Funkraum 90 Wachminuten ehrfurchtvoll über die Schultern.
Solchermaßen eingeteilt und eingewiesen schäppern wir los.
Der Dampfer ist im Levante-Dienst eingesetzt. Demzufolge fährt er in das Mittelmeer.
Emotional aufgeheizt, beim ersten Inseestechen, stehen wir am Schiffszaun und winken jedem Angler auf der Warnemünder Mole zu.
Der erste Törn am Ruder ist ebenso aufregend. Die erste Wache daran läßt die Brust schwellen. Das große Schiff gehorcht auf die Bewegung des kleinen Fingers vom "Schützen Arsch im letzten Glied".
Ein erhabenes Gefühl.
Jeder Neuling, dem diese ehrenvolle Aufgabe nach kurzer Einweisung übertragen wird, starrt unentwegt auf den Kompaß und reagiert auf die kleinste Abweichung vom Kurs. Der Kursschreiber schreibt dann eine schöne Gerade auf die ablaufende Papierrolle.
Lang gediente Matrosen sehen das längst nicht so verbissen.
 Nach der dritten Wache am Ruder mutiert dieses erhabene Gefühl zur Stupidität. Lieber an Deck Rost klopfen, als Rudergehen, ist dann bei der Decksgang die vorherrschende Meinung.
Nach der dritten Wache am Ruder mutiert dieses erhabene Gefühl zur Stupidität. Lieber an Deck Rost klopfen, als Rudergehen, ist dann bei der Decksgang die vorherrschende Meinung.
Im Funkraum meldet sich Claus Mohs, zur Passage des Kiel-Kanals, bei Rügen Radio ab und bei Kiel Radio an. Ich vergleiche dabei mein bisher erworbenes Schulwissen mit seiner Routine und bemerke gewisse Unterschiede zwischen Theorie und Praxis. Die nächsten 90 Minuten Ausguck auf der Brückennock sind im Seegebiet der Kieler Förde nur kalt, ohne besondere Vorkommnisse. Das Marine-Ehrenmal von Laboe hat noch einen gewissen Schauwert.
Das Einlaufen in den Kiel-Kanal hat bei der ersten Passage natürlich seinen Reiz. Außerdem, und das wird jeder ehemals eingekastelte DDR-Bürger natürlich bestens nachfühlen können, hier weht ja der Duft der großen weiten Welt herüber.
Die kommenden 20 Jahre meines Lebens habe ich dafür keine so sensible Nase mehr, aber jetzt, auf meiner ersten Reise, duftet es mächtig gewaltig. Ich vergeude fast meine ganze Freiwache zum Schnuppern und gehe spät pennen, obwohl ich um 04.00 wieder antreten muß.
Im Kiel-Kanal braucht man nicht Rudergehen. Der Lotse bringt seine zwei Kanalsteuerer mit. Künstliche Arbeitsbeschaffung auf Kosten der zahlenden Reeder. Unser Bootsmann könnte das genauso gut und ich nach dieser Reise auch.
Nach Schleuse Brunsbüttel empfängt uns die Elbe und ab Feuerschiff Elbe-eins beginnt die Seefahrt, die richtige!
Ich kann nicht schlafen, in der Freiwache meine ich.
Im Judentempel herrscht ein unglaublicher Rabatz. Wir schlafen nur wenige Meter über dem Propeller und, wie mir scheint, nur Zentimeter über dem Ruderquadranten.
Das heißt, um das einmal auch Nichtseeleuten zu verdeutlichen, wenn "Kneppel" oben auf der Brücke an seinem winzigen elektrischen Ruderrad dreht, bedient er damit nur einen elektrischen Schalter. Dieser setzt dann im Rudermaschinenraum, direkt unter meiner Koje also, einen kräftigen Mechanismus in betrieb, der das großflächige Ruderblatt nach Backbord oder nach Steuerbord und dann wieder nach Mittschiffs legt. "Kneppel" ist natürlich genau so erpicht darauf, den Dampfer so übertrieben genau auf Kurs zu halten, wie ich vorher. D.h. er kurbelt so hektisch am Ruderrad und macht dabei mit dem direkt unter unserer Suite arbeitenden Ruderquadranten so einen Rabatz, daß seine Kumpels von der Freiwache da hinten kein Auge zumachen. Der Propeller wütet natürlich auch noch recht ordentlich und der ist ja auch ganz nahe.
Schließlich bestätigt sich die älteste Ritterregel: Der Mensch gewöhnt sich an alles!
Zumal "Kneppel", "Gebelchen", "Titte", ich und alle andern blutigen Neulinge auch längst nicht mehr so übertrieben emsig am Ruderrad kurbeln.
Einen 'Eisernen Gustav' besitzt das Schiff noch nicht, wir halten "hand-made" unseren Kurs. Der 'Eiserne Gustav' wäre die automatische Selbststeueranlage, die, wenn richtig eingesteuert, Schiffe und Flugzeuge bei jedem Wetter so exakt auf Kurs hält, wie es der eingefuchsteste Rudergänger oder Flugzeugkapitän nie brächte.
Außer dem 'Eisernen Gustav' vermißt Dampfer THÄLMANN PIONIER ganz schmerzlich auch ein Radargerät.
Ersatzweise werden daher bei schlechter Sicht Radaraugen vom Ausguck auf der Back verlangt. "Fahrzeug an Backbord einmal, Fahrzeug an Steuerbord zweimal und wenn du Mittschiffs was ausmachst, dreimal an die Glocke hauen" weist mich mein Wachleiter diesbezüglich ein. Wenn er "glasen" gesagt hätte, wäre das zwar fachgerechter gewesen, aber dann hätte ich es nicht verstanden.
Ich stehe im englischen Kanal auf der Back und bimmle wie ein Weltmeister. Die Sicht ist nicht schlecht und somit taucht im befahrendsten Revier der Welt am Horizont ein Lichtpunkt nach dem anderen auf. Die Brückenbesatzung hat ihn auf Grund ihrer besseren Augeshöhe, ohnehin schon viel früher ausgemacht, als ich mit tränendem Auge im frostigen Fahrtwind des Januars.
"Kommst du so jetzt vom Ausguck, in Halbschuhen und Jacket?" haut mich Karl Lokenvitz, der Chiefmate am Niedergang an. Ab sofort bekommen wir Filzstiefel, Wattejacke, Ölzeug und Wachgänger (Pelzmantel).
Die Biscaya bleibt ruhig. Claus Mohs weiß das schon früher, aus dem Seewetterbericht von Lands End Radio. Er tippt die ziemlich gammlige Morsehandschrift des Engländers ganz locker in die Schreibmaschine. Ich, als sein gegenwärtiger Praktikant während meiner 90 Minuten-Funkwache, pinsle das englische Tempo 100 per Hand mit, obwohl ich in Wustrow sauber und maschinen-gegeben erst deutsche 80 kann. Demzufolge weiß ich auch nicht so ganz genau, welches Wetter uns in der Biscaya erwartet.
Ushant ist der französische letzte Felsen und Kap Finisterre dann wieder der spanische erste, wenn man vom Norden kommend die Biscaya durchfährt.
Die Biscaya hat ihr eigenes Flair.
Später passiere ich dieses Seegebiet ein paar hundert Mal, immer mit Respekt.
Nach zweimal vier Stunden Wache schart Ernesto täglich seine Truppe noch um sich. Schließlich kann er ja nicht ganz den "Passagier" raushängen lassen, so wie der Politnik, der nun wirklich als völliger Ballast mit drei Ärmelstreifen nur auf den Tiefgang des Schiffes geringfügigen Einfluß hat. Ernesto drangsaliert uns nach der Wache mit dem Fach "Funknavigation". Wir hängen teilweise seekränkelnd und müde ziemlich durch. Ernesto, das alte Leder befiehlt Härte!
Wir peilen alle nur möglichen Funkfeuer an, zählen teilweise mit konträren Ergebnissen die Punkte und Striche der Konsolfunkfeuer von Lugo und Sevilla aus und fuhrwerken dann mit den Kursdreiecken in der Seekarte umher, um aus X-gepeilten Standlinien die Schiffsposition zu ermitteln. So gänzlich nutzlos ist unser Tun nicht, der 3. Offizier reißt sich zum Wachende ganz gerne unseren Ort unter den Nagel. Wenn er mittags keine Sonne hat, ist unsere Position allemal genauer, als evt. der schon von drei Wachen gekoppelte Ort.
Im nachhinein erblasse ich jetzt noch in Ehrfurcht vor den U-Boot-Navigatoren der Weltkriege, die mit ähnlichen navigatorischen Primitivmitteln, teils in permanenter Unterwasserfahrt und stark havariert ihre Stützpunkte zwischen den Felsen in Brest oder La Rochelle gefunden haben.
Der Felsen von Gibraltar erscheint mir fotografierenswert, obwohl auf dem Orwo-Dia später nur ein Pickel am Horizont erkennbar ist. Das Dia entsorge ich nach ein paar Jahren zusammen mit 250 Sonnenuntergängen hinter Palmen in 5 Seemeilen Entfernung. Nicht hinter den Palmen, zu Hause in der Mülltonne.
Die etatmäßig in der Straße von Gibraltar wohnende Delphinherde treibt es ganz heftig vor unserem Steven. Die Tiere haben schiffserkennungsdienstlich schwer was locker. Ihre Meßtechnik sieht schon von weitem, welcher Schlorren sich nur mühsam vorwärts schiebt oder wer das in delphinunfreundlicher Brass-Fahrt macht.
Ich habe sie später hunderte Male beobachtet. Sie schwimmen bei einem fahrenden Schiff nie auf den Steven zu, sondern mit einem Vorhaltewinkel immer auf einen Punkt auf dessen Kurslinie weit vor dem Dampfer. Je schneller sie die Schiffsgeschwindigkeit vorher eingemessen haben, je weiter vor dem Steven legen sie ihre imaginäre Ansteuerungstonne.
Unsere 12 Meilen-Schleichfahrt kommt den verspielten Tieren wie gerufen. Ein Ruf hallt anscheinend durch die Herde, die Delfis unterbrechen ihr Herumtollen und eilen aus den entlegenen Winkeln herbei. Mutter und Kind mit Kind und Kegel. Wenn sie die Bugwelle erreichen, drehen sie aus ihrem Kurswinkel elegant auf den Schiffskurs ein und hechten nun in mehreren Lagen übereinander schwimmend vor dem Dampfer her. Die Jungtiere bleiben dabei ganz dicht bei ihrer Mutter. In der oberen Lage schwimmen die Tiere in der Walze der Bugwelle immer nur wenige Sekunden, sie versorgen sich mit Luft und machen der nächsten Lage Platz.
Diese Wechsel sind trainiert, so wie beim Radrennen das bei einem Mannschafts - Vierer abläuft. Ab Schiffsgeschwindigkeiten von etwa 18 Knoten scheiden sich dann die Delphingeister. In der Bugwelle eines solchen Schrittmachers kämpfen nur die besten Kurzstrecken-Spezialisten der Herde. Zum Abtrainieren und Glieder ausschütteln eignet sich nach dem Streß in der Bugwelle die keilförmig ablaufende Heckwelle des Schiffes. Darin dallern dann die Energiebündel voll Lebensfreude umher, bis der nächste langsam laufende Entgegenkommer sie wieder in ihr Revier mit zurück nimmt.
Ich beneide die Delphine um ihre Lebensfreude, denn die meinige nimmt zusehens ab. Am übernächsten Morgen im ägäischen Meer möchte ich gar nicht mehr leben.
In der Nacht donnerte die überkommende See gegen das Poophaus. Der Dampfer geht wie ein Lämmerschwanz. Durch das runde Bullauge schaue ich einmal in den Himmel und nach zehn Sekunden auf die aufgewühlte See. Die Wache schraubt dann die Panzerblende zum Schutz vor das Glas und diese ständig wechselnden Ausblicke sind verdeckt. Ich möchte nicht mehr leben, ziehe aber auf Wache. Ich esse 10 Gramm Knäckebrot und kotze im Fünfminuten-Takt
100 Gramm davon aus, möglichst in Lee-Seite. Erwischt man in der Hektik die Luv-Seite, schwirren einem die Brocken um die Ohren.
Am heftigsten erwischt es "Kneppel", der scheint schon klinisch tot auf Ausguck zu stehen und ist nur zu phlegmatisch auch umzufallen.
Jochen und "Quärkchen" ließen sich vorher auf ihren Loggern und Trawlern Seebeine wachsen und geben uns Halbtoten ganz wertvolle Hinweise zur Bewältigung dieser Lebenskrise und der drohenden Suezid-Gefahr.
Jochen meint, ein Stück Speck am Bändsel verschluckt, wirke Wunder. Wenn dieses aus dem Gesicht hüpft, stände es ja, an der Sicherheitsleine befestigt, zur häufigen Weiterverwendung immer wieder zur Verfügung.
"Quärkchen" warnt davor, beim Kotzen den braunen Ring zu übersehen, der müsse auf alle Fälle wieder verschluckt werden. "Sonst krempelst du dich um!" ist sein väterlicher Rat.
Claus Mohs im Funkraum schmunzelt, wenn wieder so ein ausgekühltes grünes Männchen, mit Galle im Bart vom kalten Ausgucksposten im warmen Funkraum ablöst. Aber die aufsteigende Wärme in dem engen Kabuff bekommt der Seekrankheit erst recht nicht. Zudem liegt der Funkraum auf dem Brückendeck und da oben schlägt das Pendel am weitesten aus, wenn der Dampfer sich von 40 Grad Backbord in 10 Sekunden auf die andere Seite wuchtet.
Bei solch einer Briese erstirbt das gesellschaftliche Leben auf dem Schiff. Auch alten Hasen geht solch ein Wetter auf die Ketten. Außerhalb der Wache läßt es sich dann nur noch einigermaßen in der Koje aushalten, aber auch daß ist stark gewöhnungsbedürftig und will gelernt sein.
Später darüber mehr, wenn es richtig zur Sache geht. Ich fahre ja noch länger zur See.
Hier im Ägäischen Meer ist das nur Schlechtwetter für Anfänger, für die reicht es aber allemal.
Wir erreichen unseren ersten Zielhafen Durres in Albanien. Meine grüne Gesichtsfarbe entweicht und ein Mords-Kohldampf überkommt mich, nachdem das Schiff bewegungslos und vertäut an der Pier liegt.
Statt Seewache gehen wir jetzt Hafenwache. Dreischichtig acht Stunden, Gangway-Wache oder Lukenaufsicht. Vorher werden wir diesbezüglich über die spezifischen Aufgaben eingewiesen.
Der Dampfer löscht seine mitgebrachten Kisten mit eigenem Ladegeschirr. Später kommen davon einige wieder zurück, oder versuchen es jedenfalls.
Das hat die Lukenaufsicht unbedingt zu vereiteln.
"Alles was die Reling passiert hat, ist denen ihr's" hämmert uns der II.Offizier ein. "Wenn uns der albanische Lukenfiez wieder was unter den Troyer jubeln will, schaltest du den Strom an der Ladewinsch ab!" Wir schalten öfter und die zurückgejubelte Kiste baumelt dann am Ladegeschirr, bis der Ladungsoffizier und der albanische Empfänger mit Händen, Füßen und mit der Mütze sich geeinigt haben.
Ein albanischer Hafenarbeiter dreht mir den linken Arm herum, klopft mir dabei aber freundschaftlich auf die Schulter und ruft: "Aah, Umpf und meint dabei die Marke meiner Uhr. UMF, Uhren- und Maschinen-Fabrik Ruhla. Dennoch kauft er das Fabrikat. Als nächstes kauft er meinen Troyer und meine Halbschuhe, die ich ja auf Ausguck nicht mehr benötige, da wir Stiefel bekommen haben. Im Blechschrank unserer Viermannkammer wird es zunehmend lichter. Wir vier Mann verfügen dann über das sagenhafte Kapital von 13 Flaschen herrlichsten albanischen Cognac der Marke "Kortscha". Die Flaschen sind zwar mit schwarzem Bitumen vergossen und nicht so ansehnlich, der Inhalt ist aber ganz vorzüglich.
Im Sommer schleppen die Hafenarbeiter, laut Aussage der Stammbesatzung, Schildkröten in Kartoffelsäcken zum Tausch gegen UMF-Uhren, Schuhen oder Klamotten an. Schildkröten kann man aber außerhalb der Stadt auch selbst leicht aufbringen. Auf dem Rostocker Bahnhof gegen zehn Mark pro Stück verkloppt, wäre das ein einträgliches Geschäft. Jetzt aber ist Winter und die Schildkröten pennen unauffindbar.
Wir gehen an Land, in Gruppen. Vorher wurden wir auch diesbezüglich belehrt.
In dieser stalinistischen Diktatur Albanien folgt jedem Seemann nach passieren des Hafentors von nun an ein Schatten, auf Konspiration bedacht auf Schritt und Tritt. Nach dem dritten Landgang, wo die Stadt nichts mehr bietet, ist der James Bond im Schlepp eine recht interessante Freizeitbeschäftigung. Wir jagen den Schatten des sozialistischen Bruderlandes Trepp auf Trepp ab hinter uns her, um die Ecken der engen Gassen, auch durch die Botanik. Wenn wir ihn dann abgehängt haben, grüßen wir ihn freundlich beim Zurückkommen am Hafentor, wo er auf neue Kundschaft wartend, gelangweilt am Wachgebäude lehnt.
Der Botschaftsfunker der Botschaft der DDR in Tirana hat seine Berufs-Kenntnisse ebenfalls an der Seefahrtschule Wustrow erworben. Die Fischer aus unserem Semester kennen ihn als ehemaligen Studienkollegen als sie das kleine Funkpatent FS erwarben.
Der Botschaftsfunker ist Kumpel.
 Er rückt aus Tirana mit so einem Polizei-Einsatzwagen mit Bänken und Planendach an und einem albanischen Fahrer. Ernesto gibt uns einen Tag frei.
Er rückt aus Tirana mit so einem Polizei-Einsatzwagen mit Bänken und Planendach an und einem albanischen Fahrer. Ernesto gibt uns einen Tag frei.
Wir fahren in Skanderbecks albanische Berge. In den niederen Gegenden beleben noch ein paar sagenhaft knorrige Olivenbäume die Landschaft, weiter oben wächst nichts mehr.
Die Berge sind absolut verkarstet.
Das schieben die Albaner den Italienern in die Schuhe, die für ihren Koggenbau vor geraumer Zeit dort alles Holz weggehackt hätten.
Wir überholen auf der geschotterten Straße erst eine Frau, gebeugt unter einem riesigen Holzbündel, 20 Meter vor ihr reitet der Gemahl, ganz aufrecht und fröhlich auf einem Esel. Der Mann trägt gar nichts, der Esel nur den Mann. Von da an war ich ganz erpicht darauf, eine muselmanische Frau zu ehelichen, oder noch besser, mehrere Muselfrauen.
Außer einer zerfallenen Burg der Adlersöhne, wie sich die albanische Elite bezeichnet, beeindrucken uns die gesicherten Gehöfte der Bergbauern. Ein jedes ist eine steinerne uneinnehmbare Festung. Nur so wehrhaft gesichert war ein Überleben zur Zeit der Blutrache in diesen Gegenden überhaupt möglich. Im Laufe der Generationen häuften sich die Sträußchen, die jede Sippe mit der benachbarten auszufechten hatte und kein einziges Sträußchen ließen die Ältesten verwelken. Eine Frage der Ehre.
Wir befahren eine hoch in die Felsen gehauene Straße, gerade so breit wie unser Ello. Der Fahrer hält an. Er steigt aus, wir auch. Vor uns steht einer. Die Fahrer handeln die Vorfahrt aus. Wir haben sie nicht. Unser Fahrer stößt zurück bis zu der nächsten in den Fels gehauenen Einbuchtung und die ist weit.
Dieses Erlebnis muß sich der arme Kerl allein gönnen.
Wir pressen uns mit den Rücken an die Felswand, damit uns der Entgegenkommer passieren kann und vertreiben uns die Zeit, bis unser Transporter wieder zurückkommt, in dem wir uns ganz ängstlich vorbeugend von dem unendlich tiefen Abgrund überzeugen, der ohne Geländer oder gar Leitplanken unsere Straße begrenzt. Wir werfen Felsbrocken hinab und stoppen die Zeit bis zur akustischen Trefferanzeige, sind dann aber als angehende Ingenieure allesamt zu dumm, aus der Fallzeit der Steine die Tiefe des Abgrundes zu errechnen. Man kann ja nicht alles können.
Alpenträume
Am nächsten Tag habe ich auf dem Dampfer Lukenwache. Wir laden in einem Laderaum Chromerz, das mit dem Greifer geschüttet wird und in zwei Luken Bitumenfässer. Ein 200-Liter-Rollreifenfaß mit dem Zeug wiegt sechs Zentner. Die Fässer hängen zu sechst an umschlungenen Stropps an unserem Ladegeschirr. Zum Glück tragen wir in der Luke einen Helm.
Am nächsten Tag laufen wir aus. Kapitän Just malt den Kurs von Durres nach Beirut in die Seekarten. Die Brise, die mich drei Tage lang vor Durres so heftig seekränkeln ließ, ist abgeflaut. Mit zunehmenden Subtropen können wir mehr und mehr auch unsere Aktivitäten an Oberdeck verlegen, das Bulleye öffnen und das schwere Eisenschott vom Judentempel auf den Haken hängen, Frühlingsluft in den herb männlich muffelnden Decksaufbau lassen.
In der Doppelstock-Koje schlafe ich unten, Jochen über mir. Ich schlafe fest und träume, bis Jochen über mir ganz infernalisch brüllt.
Ich träume von Durres und liege in Rückenlage in der Ladeluke. Über mir schweben sechs von diesen sechs Zentner schweren Bitumenfässern, die gerade dabei sind, sich auf mich herabzulassen. Dagegen stemme ich mich mit den Füßen und beachtlichem Erfolg, aber nicht gegen sechs mal sechs Zentner Bitumen, sondern gegen Jochens 90 Kilo, die ich damit über mir aus dem Schlaf reiße. Der eiert, durch meine Füße ausgehebelt, über mir auf seiner Matratze und hat Mühe, schlaftrunken nicht aus dieser Höhe herabzufallen.
Sein infernalisches Gebrülle beendet jäh mein geträumtes Erfolgserlebnis.
In Beirut wehen die arabischen Düfte der großen weiten Welt, diese beeindrucken in zweierlei Hinsicht. Man sieht die herrlichen Trauben dieser Welt, aber auch die Höhe, in der sie hängen. Wir bekommen auf dieser Reise 12 DM wertvolle Valuta. Ein spärliches Bewegungsgeld in einem Weinberg voller Trauben.
Am Hafentor möchte uns ganz hartnäckig ein Taxiunternehmer für zehn DM pro fünf Mann nach Balbeck fahren. Ich erwerbe statt dessen mit meinem mäßigen Budget eine Captain's Khaki-Uniform, der damalige Moderenner und mache damit zwei oder drei Jahre in der Konsumzone den Chef.
Für mein Mädel erhandele ich auf dem Basar einen Kamelleder-Beutel, auch ganz trendy. Der stinkt ziemlich herb. Ich hänge ihn ein paar Tage in den Mast. In meiner Suite hätte er seinen Geruch wahrscheinlich noch intensiviert.
Diese irdischen Güter sind natürlich längst vergangen, die antiken Ruinen von Balbeck hätte ich bleibend in der Erinnerung bewahrt.
Eine Erfahrung, nach der ich erst im gesetzteren Alter lebe.
Statt Balbeck besuchen wir rein visuell den Puff von Beirut und der ist beeindruckend, ein ganzes Stadtviertel dieser Großstadt.
Auf Reede im Hafen liegt ein riesiges amerikanisches Kriegsschiff. Die tausend "Marins" von diesem Kampfblech sind etwas besser betucht und möchten wohl bei ihrem Landgang unbedingt einen unterbringen. Die US-military police möchte das unbedingt unterbinden. So steht ein ganzer Stadtteil voll Hafennutten, spitzer "marins" und dienstbeflissener Ordnungshüter unter Dampf.
Das Spiel ist interessant.
Die Militärpolizei leuchtet jedes Taxi beim Eindringen in das Rotlicht-Viertel nach ihren Uniformen ab. In den Kofferraum leuchten sie nicht. In diesen Behältnissen lassen sich die Liebesbedürftigen nun einschleusen, springen dann wie die Eichhörnchen hurtig aus den Chevi-Taxen und nischt wie rein in die ein- bis zweistöckigen Etablissements. Die Police-men trillern dann heftig auf ihren Trillerpfeifen und hechten hinter ihren Landsleuten hinterher. Die Nutten begünstigen die Freier und behindern deren Verfolger mit ihren bescheidenen Mitteln so gut sie nur können.
Das ist alles sehr schön anzuschauen.
Aber wir müssen weiter, mit dem Schiff nach Lattakia in Syrien. Beim Landgang in der Stadt werden Jochen und ich verhaftet.
Ich fotografiere in der Stadt den zweirädrigen Eselskarren mit Apfelsinen von Ali Ben Beischlaf. Der Fuhrunternehmer hat nichts dagegen, aber eine Uniform füllt plötzlich meinen Sucher aus und behauptet, ich hätte mit seiner Person die Syrische Armee an ihrem sensibelsten Punkt fotografiert.
Polizei ist schnell zur Hand.
Wir werden in deren Head-quarter überführt und dort vernommen, aber wir vernehmen nur Bahnhof. Schließlich wird es allen Beteiligten zu langweilig und wir können wieder gehen. Aus dem ermahnenden Zeigefinger des Oberkommissars schließen wir, daß wir in Zukunft irgend etwas anders machen oder unterlassen sollen. Wir machen vorsichtshalber beides.
Von Lattakia aus fahren wir wieder heim zur Mutti und studieren alle in Wustrow weiter. Zwei Semester bleiben noch bis zum Schiffsoffizier. Aber jetzt weiß ich wenigstens in etwa, was mir bevorsteht und worauf ich mich überhaupt eingelassen habe.
Im Sommer 1960 gehöre ich zu den Glücklichen vier, von 16 Studienbeginnern, die nach bestandener Prüfung ein Seefunkzeugnis II. Klasse ausgehändigt bekommen.
Einen Vorvertrag mit der Deutschen Seereederei habe ich schon als Student geschlossen.
Nun muß ich nur auf der Schwedenschanze im Rahmen von Oberleutnant Hähers landeiernden Männerulk nochmals verdeutlicht bekommen, was die wahre Seefahrt ist, wozu sie überhaupt da ist und wie sie gegrüßt wird.
Ich überlebe degradiert, wie eingangs geschildert, die vier Wochen.
Mir bleiben noch drei Wochen Ferien, von denen ich nicht so viel habe. Ich warte zu aufgeregt auf meinen ersten Einsatz. Geht es nach Ostasien, nach Südamerika, Levante, nur Ost und Nordsee oder nach Archangelsk und Murmansk. Nur vierzehn Tage oder sieben Monate? Huch ist das aufregend beim ersten Mal.
![]() Ganz frisch gebacken
Ganz frisch gebacken
Ich erhalte per Telegramm den Gestellungsbefehl für MS DRESDEN, dem jetzigen Traditionsschiff "Typ Frieden", das als eine Art Museumsschiff in Rostock-Schmarl mich an diese schicksalsschweren Stunden erinnert.
Ich bekomme mein Seefahrtsbuch und dort hineingestempelt den äußerst wichtigen Sichtvermerk:
"Berechtigt zum Überschreiten der Seegrenze der Deutschen Demokratischen Republik"
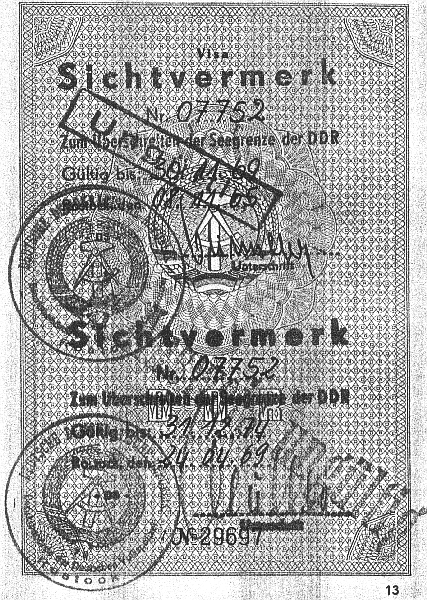 Des weiteren benötigt Hein Seemann in aller Welt einen gut geführten internationalen Impfausweis.
Des weiteren benötigt Hein Seemann in aller Welt einen gut geführten internationalen Impfausweis.
Für Ostasien werden in meinem jungfräulichen Dokument besonders viele Seiten vollgestempelt, nachdem ich vorher aber auch besonders viele Kubik Impfserum abgedrückt bekam. Gegen Gelbfieber, Fleckfieber, Typhus, Cholera, schwarze Blattern und wohl auch gegen Mundgeruch und Schweißfüße. Alles in einer Spritze, aber das ist auch ein ordentlicher Dobbas. Nur die Pocken-Ritzung ist darin nicht enthalten, die gibt es als Dessert.
Drei Tage lang marschieren alle solcherart Immunisierten auf dem Schiff nur mit gedämpftem
Trommelschlag. Diese Betonspritzen dämpfen erheblich hektische Bewegungen.
Meine ersten Pocken hätschle ich auch noch und lasse sie schön blühen. Dann später fasse ich noch etliche Pocken-Impfungen ab und immer ist schleunigst der erste Gang vom Doktor unter die Dusche, dann blüht nichts auf.
Nur kurz eingeflochten
Jahre später erwischt mich und sechs andere Besatzungsmitglieder im Irakischen Tankerhafen Kharg Island der angebliche Doktor der Hafenbehörde mit einer abgelaufenen Pockenimpfung.
Diese müsse er unbedingt nachholen. Eine Ampulle Serum führt er am Mann, hat aber keine Impffeder dabei. Der Doktor haut der Ampulle an der Tischkante den Kopf ab und mit den bizarrsten Zacken des splitterigen Randes werden wir alle sieben Angetretenen gegen Pocken immunisiert. Um jeden von uns auch mit frischem Serum zu versorgen, drückt der Doc immer den Daumen auf die zersplitterte Öffnung und schüttelt die Ampulle. Danach gehen wir alle ganz fix duschen.
Aber vorerst trete ich als II. Funkoffizier, erst einmal vom Medizinischen Dienst des Verkehrswesens der DDR versorgt, meine erste Reise an.
Wir laufen Anfang September aus und nehmen außer den Unmengen Proviant und Ausrüstung auch drei Weihnachtsbäume mit, das deutet auf etwas länger hin.
Der letzte Löschhafen ist Shanghai in China, der erste Ladehafen Stettin. So darf aber niemand sagen, das heißt Szczecin. Ich habe daraufhin als gelehriger Schüler des Politoffiziers beim schreibmaschinlichen Abfassen des Speiseplanes ständig die Königsberger Klopse als "Kaliningrader Klopse" serviert. Daraufhin hat mich dann einmal ein Chefkoch, der sich als Parteigenosse mit dieser Thematik wohl besonders beschäftigt hat, belehrt, daß bei diesen feststehenden Begriffen wohl "Königsberg" noch gestattet wäre.
![]() Flucht aus dem Paradies
Flucht aus dem Paradies
Wir laden also in Szczecin sehr schwere Stahlsektionen eines Drehrohrofens, das dauert. Die reich bemessene Freizeit verbringt in Szczecin der Mann von Welt im "Baltik". Das ist für Erholungssuchende das führende Haus am Platze.
Leider mußte ich die erlebnisreichen Stunden aus Platzmangel aus dem Manuskript streichen.
Mit dem angeladenen Schiff versegeln wir nach Liverpool und Swansea in England. Dort laden wir Kisten. Danach bekommt das Schiff in Dünkirchen (Frankreich) etliche tausend Tonnen Salz in drei noch leere Ladeluken geschüttet. Jetzt sind zehntausend Tonnen Ladung zusammengesammelt. Wir brechen nach China auf.
Vor dem Suez-Kanal in Port Said an der Pier liegt ein großer Passenger. Als Heimathafen führt er Vatikanstadt am Heck. Der Papst ist also auch Reeder.
Unmassen Menschen bevölkern die Oberdecks. Da sich alle an die Backbord-Reling drängen, besorgen sie dem Schiff eine ordentliche Schlagseite.
Wir bändseln die DRESDEN auf Warteposition für die Suez-Kanal-Passage an einer der Festmachertonnen an. Da wir für die Kanal-Passage erst für den nächsten Tag vorgesehen sind, fahren wir mit den sich reichlich anbiedernden Wassertaxis an Land. Für dieses Unternehmen benötigt ein jeder einen behördlich ausgestellten "SHORE LEAVE PASS" und für diesen ein Paßbild.
Es kommt ein Fotograf an Bord. Der stellt an Oberdeck immer einen Trupp von sechs bis acht Leuten in einer Reihe auf. Dann liefert er die großformatigen Bilder an und jeder schneidet sich daraus sein Paßbild aus. Da uns diese Aufnahmetechnik sehr belustigt, haben wir alle freundliche Paßbilder in unseren Dokumenten.
Port Said ist an diesem Tage fest in deutscher Hand. Die Amtssprache und auch die Leitwährung ist Deutsch!
5000 bundesdeutsche Auswanderer lassen sich vom Papst in das nach ihrer Meinung gelobtere Land Australien verschiffen.
Auf dem Basar kommen wir mit den Landsleuten sehr bald ins Gespräch. Die Leute können nicht verstehen, wie jemand wie wir, dem sich die Möglichkeit bietet, nicht sofort der DDR den Rücken kehrt. Wo doch im freiheitlichen Teil Deutschlands Milch und Honig fließt. Wir Seeleute der DRESDEN können aber im Gegenzug nicht verstehen, wie 5000 Auswanderer aus dem Schlaraffenland Deutsche Bundesrepublik nach Australien flüchten.
Nirgendwo habe ich soviel deutsche Dummheit und Intoleranz in so konzentrierter Form getroffen.
In kleinerer Stückzahl später schon noch. In Savona beispielsweise, an der italienischen Riviera oder auf der Strandpromenade von Las Palmas, wenn uns Gruppen deutscher Urlauber, als Vertreter des "häßlichen Deutschen" sturzbesoffen und grölend entgegentorkeln.
Wir stellten dann während dieses Landganges die Unterhaltung ein, um nicht auf Grund
der selben Sprache auch in dieser Schublade zu landen.
Wir werden beim VEB Deutsche Seereederei streng gehalten. Angeblich tragen wir als Seeleute den ehrenhaften Titel "Botschafter mit Seesack", der die Deutsche Demokratische Republik im Ausland ehrenhaft zu vertreten hat. Schon geringfügiges Danebenbenehmen hätte den Entzug des Seefahrtsbuches zur Folge. "Schädigung des Ansehens der DDR im Ausland" lautete dann die Anklage. Für so manchen deutschen Ballermann 6-Chaoten oder Hooligan täte eine dahingehende Handhabung des Gesetzes auch ganz gut. Im Gegenzug natürlich auch gegen jeden ausländischen Randalierer in Deutschland.
![]() Absolute Funkstille
Absolute Funkstille
Ab Suez-Kanal herrscht für die Schiffe der DSR, die einen Löschhafen in der Volkrepublik China ansteuern, absolute Funkstille. Eine der bescheuerten Reaktionen der politischen Führungsstrategen der DDR, die mit solchen Maßnahmen den kalten Krieg gewinnen möchten. Damit unser gemeinsamer erbitterter Gegner auf Taiwan uns als Blockadebrecher für Volks-China nicht so leicht aufbringen kann, schweigen ab Suez unsere Sender. Da aber die Volksrepublik China vor Taiwan auch gewaltigen Schiß in der Büchs hat, muß sich jedes Schiff, das einen chinesischen Hafen anlaufen möchte, 72 Stunden vor Erreichen Chinas Küste telegrafisch anmelden. Wir tun das auch und befinden uns dabei genau querab der Insel Taiwan.
Unser Schiff hält bei schönem Wetter in ruhiger See auf die Südspitze von Ceylon zu.
Ich habe die Nachmittagwache im Funkraum. Stehe aber halb im Gang, denn bei Klaus Völlmer, dem I. Funkoffizier, gibt es Kaffee. Seine Kammer liegt auf dem Brückendeck gegenüber dem Funkraum. Mit einem Ohr bin ich an dieser Gesprächsrunde beteiligt, das andere überwacht die Anruf- und Notfrequenz 500 KHz.
Gerade bekomme ich noch den wichtigsten Teil einer auf dieser Frequenz abgestrahlten Meldung mit. Das Rufzeichen des Absenders brennt sich ins Ohr. Es ist das baugleiche Schwesternschiff MS MAGDEBURG, das mit einer Dringlichkeitsmeldung alle Schiffe im Seegebiet südlich von Dondra Head bittet: "man over board - please keep sharp lookout".
Bei Klaus Völlmer erledigt sich die Kaffeerunde.
MS DRESDEN ist von seinem Schwesternschiff an der Südspitze von Ceylon noch ca. 50 Seemeilen entfernt.
Wir laufen mit 3 Motoren knapp 13 Knoten. Dondra Head ist noch zu weit, um einem dort außenbords Gefallenen Hilfe zu leisten. Wir telefonieren auf Grenzwelle mit dem Kollegen der MAGDEBURG.
Nach dem Überbordgehen des Matrosen ging das Schiff sofort auf Gegenkurs, macht dem im Wasser Treibenden auch ausfindig und bekommt für dessen Bergung auch schnellstens ein Boot zu Wasser. Die See ist ruhig, das Wasser tropisch warm. Als das Boot die Stelle erreicht, wo man die letzten Zeichen des im Wasser treibenden ausgemacht hatte, ist dieser verschwunden und bleibt es für immer.
Dieses frühe Erlebnis bleibt leider nicht meine erste Erfahrung und nicht der letzte Funkspruch, der mich wissen läßt, daß zur See fahren doch größere Gefahren birgt, als daheim über die Straße zu gehen, wo einem nach der landläufigen Meinung ja auch ein Dachziegel auf den Kopf fallen könne.
![]() Heiße Weihnacht
Heiße Weihnacht
Wir erreichen unseren ersten Löschhafen Georgetown auf der Insel Penang am Eingang der Straße von Malakka. Malaysia heißt das zugehörige Land heute. Die Insel Penang ist ein Tropenparadies und gleicht der Schaufensterwerbung des TUI-Reisebüros.
Wir ankern vor der Palmenidylle und löschen, auf Reede liegend, eine Teilladung Salz. Schuten kommen längsseit und kleine drahtige Malaien werfen eine Wurfleine auf des Hauptdeck. Eine kunstfertige Hakenkonstruktion verhakt sich dort im Schanzkleid oder der Reling und schwupp, schon laufen daran diese trainierten Leistungssportler die Außenhaut zu uns herauf. Sie stellen die Bäume, bedienen die Winschen und schaufeln in den Luken die großen Bastbehältnisse mit Salz voll. Das schiffseigene Geschirr hievt die Behältnisse dann in die längsseits liegenden Schuten, wo das Salz auf einen Berg geschüttet wird.
Die einklarierenden Behörden kommen über die Gangway an Bord. Sie kontrollieren die Besatzungsliste, die Impfausweise, die Liste für die zollfreien Genußmittel, die persönliche Effektenliste, die Seefahrtsbücher und den umfangreichen Wust der vorzulegenden Schiffs- und Ladungspapiere.
Jedem Besatzungsmitglied wird der Besitz einer Flasche Schnaps und einer Stange Zigaretten zugestanden. Das ist weltweit in jedem Hafen so üblich und gestattet. Für die Hafenliegezeit wird dann die zollfreie preisbegünstigte Ware im "Transit-Chap" verschlossen und von der Hafenbehörde versiegelt. Eine weitere Entnahme ist dann nicht mehr möglich.
Hier in Malaysia herrschen davon abweichende Sitten. Die Behörden versiegeln die Transitlast, lesen auf der persönlichen Effektenliste, daß jedes der 63 Besatzungsmitglieder im Besitz der einen üblichen Flasche Schnaps ist und verabschieden sich nach der Einklarierung des Schiffes und dem Versiegeln der Transitlast mit den Worten: "Captain, wir gestatten außerhalb der versiegelten Transitlast auf ihrem Schiff zwanzig Flaschen Schnaps und zwanzig Flaschen Wein! Beachten sie das gewissenhaft, morgen kommen wir filzen! Sie dürfen mit ihrem eigenen Boot an Land fahren, aber immer nur in Trupps zu zehn Mann.
Mehr dürfen sich von ihrer Crew nicht gleichzeitig an Land befinden. Meckern sie nicht, sie kommen aus dem kommunistischen "Russian-Germany". Die Russen dürfen bei uns gar nicht an Land!"
Somit hat Kapitän Zieske zwei Probleme:
a) 40 Flaschen Schnaps zu viel auf dem Schiff, die wir in das verschlossene Transit-Chap nicht wieder zurückführen können und
b) den Landgang zu organisieren, um in der zweitägigen Löschzeit des Schiffes 63 Leuten das schöne Stückchen Ostasien näher zubringen.
Der Kapitän löst das Problem für alle zufriedenstellend.
Er erteilt nach dem Abendessen die Order: Der Politoffizier, alle nautischen Offiziere (außer dem Wachhabenden), der Doktor und die Funkoffiziere zu mir! Schnaps mitbringen!
Alle technischen Offiziere, Decksmaschinist und Eisbär zum Chief! Schnaps mitnehmen!
Die Decksgang zum Bootsmann, die Maschinengang zum Storekeeper. Wachen und Anschlußwachen ausgenommen! Schnaps mitnehmen!
Die Zöllner kommen am nächsten Tag nicht filzen, sie hätten aber auch nur Restbestände außerhalb des von ihnen gestatteten Limits gefunden.
Leider wurden am nächsten Tag die herrlichen Eindrücke des Tropenparadieses auf der schönen Insel Penang durch den generell vorhandenen Brummschädel etwas vernebelt.
Diesen Brummschädel wieder loszuwerden, ist jetzt das weitere Problem. Es herrschen schließlich Temperaturen, die ich Außenseitern nicht schildern kann. Die alten Typ-IV-Freaks wissen, wovon ich rede.
Das Schiff besitzt keine Klimaanlage!
Auf See kühlt evt. der Fahrtwind die Temperaturen in den aufgeheizten stählernen Aufbauten auf ca. 36 Grad "herab". Hier auf Reede, ohne ein Lüftchen, erreicht man diese erfrischende Temperatur durch das weit geöffnete Bulleye erst im Morgengrauen. Bis dahin hat ein jeder sein Bettlaken in der Koje bei 40 Grad schon zum nassen Strick gedreht und keinen Schlaf gefunden. Nach der konzertierten Schnapsvernichtungs-Aktion funktionierte die Pennerei zwar einigermaßen, aber der Kreislauf reißt am nächsten Tag bei den aufkommenden paarundvierzig Grad ermahnend die Arme hoch und macht dem Zecher schonungslos klar, daß Brennol die Klimaanlage auch nicht ersetzen kann.
Der Kujambel-Verbrauch geht in die Hektoliter. Kujambel besteht aus dem Wasser des Trinkwassertanks, das mit dem Fruchtsirup von Schiffsversorgung etwas verbrämt wird. Einige Stücke Eis spendiert der Koch noch aus der Fischlast zur Verbesserung des erfrischenden Effekts.
Schutzlos der Tropenhitze ausgeliefert zu sein, ist etwas Furchtbares. Gegen Kälte kann man sich mit entsprechender Kleidung schützen, in unerträglichen 40 Grad plus kann man auch noch die Badehose ausziehen und evt. die Watte aus dem Ohr nehmen, dann ist auch die letzte Möglichkeit erschöpft und man schmachtet weiter. Auch völlig unbekleidet. Am härtesten treffen solche Bedingungen auf dem Schiff die Maschinenwache. Die Jungens flüchten sich von Zeit zu Zeit triefend naß unter das Gebläse ihrer Lüfter.
Als in solch einem Ansaugstutzen oben in den Masten eine verirrte Möwe zu Tode kommt und bei den üppigen Temperaturen sinnig vor sich hingammelt, mindern die eingebrachten Geruchspartikel den Gebrauchswert der Erfrischung.
Nach dem Verlassen der Insel Penang fährt MS DRESDEN die Malakka-Straße hinab. Vorbei an vielen idyllischen Südseeinseln und Inselchen. Dazwischen liegen aber viele Riffe und Sandberge, die es im Bestreben eine Insel zu werden noch nicht ganz bis zur Meeresoberfläche gebracht haben, die heißen dann Untiefen.
Die Nautiker müssen hier Filigranarbeit leisten, um die Flachstellen sicher zu umschiffen und dabei auch mit dem sich um Singapore verdichtenden Schiffsverkehr klarkommen.
In diesem Seegebiet ereilt uns das Weihnachtsfest.
Die Tropensonne ballert und mittels unseres maroden "Smaragd"-Tonbandgerätes intoniert der Thomaner-Chor: "Leise rieselt der Schnee".
Es rieselt tatsächlich: Die Tannennadeln von den im August geschlagenen mitgeführten Tannenbäumen aus der Rostocker Heide. Die Fichten standen eisgekühlt nunmehr schon vier Monate in der Fischlast. Jetzt am heiligen Nachmittag stellt der Bootsmann je ein Bäumchen in der Offiziers- und der Mannschaftsmesse auf. Die Temperaturdifferenz, mit der die Bäumchen jetzt Hals über Kopf fertig werden müßten, beträgt mehr als 50 Grad. Der Bootsmann steckt als letztes die Lauschaer Tannenbaumspitze oben auf das Bäumchen, da fällt unten die letzte Nadel von den Zweigen. Nicht ein einziges Fichtennadelchen verweilt bei den molligen Temperaturen auch nur länger als eine halbe Stunde an seinem Reis.
Um bei den Bäumchen die nackte Blöße zu verdecken, wird heftig Engelhaar produziert. Dazu wird ein Meterende eines dünnfaserigen weißen Tauendes aufgefranst. Danach fahren wir zwei wunderschöne, bis lange nach Neujahr durchhaltende Weihnachtsbäume durch die Südsee. Die dritte Staude wird am Mastknopf des vorderen Signalmastes befestigt und beleuchtet.
Die Freiwachen liefern sich auf dem Hauptdeck packende Shuffle-board-Wettkämpfe. Unter dem Winschenhaus findet eine Tischtennisplatte leidlich windgeschützt einen Stellplatz. Wir erreichen in dieser Sportart Oberliga-Qualitäten, meinen wir. In Shanghai treten wir zu einem Leistungsvergleich gegen eine sechs köpfige Schleudertruppe der Maklerei an und verlieren den Leistungsvergleich 6:0!
Wir hauen per Morsetaste Shanghai Radio an, just querab von Taipeh. Dem Klassenfeind Nummer eins in dieser Region, wegen dessen Existenz wir den ganzen weiten Weg von Suez bis Taiwan geschwiegen haben. Eine kaltkriegerische Blödmannsregelung der politischen Führungsriege der Reederei, die sich in "Geographie" nur auskennen würden, wenn sie in dieser Stadt schon einmal gewesen wären.
![]() Shanghai, der Kopf des großen Drachen
Shanghai, der Kopf des großen Drachen
liegt am Ende des 6000 Kilometer langen Jangtse-Flusses und am Anfang vom Gelben Meer. Diese Hafenstadt findet man ganz leicht. Dort wo das Gelbe Meer am gelbsten ist, mündet der "yellow river" und dann kommt auch gleich Shanghai. Vorher aber noch tausende Tschunken. Die chinesischen Tschunken transportieren, über ein Heckruder handbetrieben und von zerlumpten Segeltuch gelegentlich unterstützt, ein Vielfaches der Menge an Gütern, die die
Deutsche Seereederei mit etlichen Zehntausend-Tonnern wegzuschleppen vermag. Die Tschunken liegen im Päckchen zu hunderten an den Piers. Für ein ganzes Leben die einzige Behausung vieler Millionen chinesischer Familien, die sich dieser Art von Logistik verschrieben haben. Hier wird an backbord mit blankem Mors außenbords gekackt und an steuerbord schöpft Muttern das Kochwasser für die kärgliche Ration Reis.
Die blauen Ameisen fallen über unser Schiff und die verbliebenen Salzhaufen in den Luken her. Männlein wie Weiblein tragen die gleiche blaue wattierte Kleidung, die gleiche blaue Mütze mit dem roten Stern als Kokarde und den gleichen blechernen Essennapf mit dem roten Stern am Boden. Alle vier Stunden wird in eben diese Näpfe heißer Jasmin-Tee ausgegeben und pro Schicht eine Kelle gekochter Reis, ohne was.
Es ist Ende Januar und in Shanghai ist es schuppig kalt.
Alle vier Stunden zur 'tea-time' ist auch innerbetriebliche Wettbewerbsauswertung. Die Ladeluke, die tonnenmäßig die Nase vorn hat, bekommt dann einen Wimpel mit rotem Stern an das Lukensüll gestellt, zum für jedermann sichtbaren Zeichen, daß hier die letzten vier Stunden Nachahmenswertes geleistet wurde. Komischerweise klotzen dann die blauen Ameisen in den 'looser-teams' ganz mächtig ran, um für die nächsten vier Stunden die begehrenswerte Trophäe an sich zu reißen.
Das Schiff liegt mit Steuerbordseite an der Pier. Meine Kammer liegt auch an steuerbord, unterhalb des Brückendecks. An der Pier steht eine RFT-Lautsprechersäule genau in Höhe meiner Kemenate. "Wah", heißt Achtung, oder so, auf chinesisch. Das weiß ich von der Lautsprechersäule. Jedenfalls leitet diese alle vier Stunden mit diesem Schlachtruf die Auswertung des innerbetrieblichen Wettbewerbs der Salzeinsacker ein, verbunden mit der kostenlosen Ausgabe des grünlich schimmernden heißen Trinkwassers, das als Tee zu betrachten ist. Das "Wah" reißt mich früh um 04.00 Uhr in der Koje jedesmal in die Senkrechte. Danach werden uns Steuerbordbewohner 20 Minuten bestes Chinesisch mit 130 Dezibel aus 3 Meter Abstand an das gepflegte Mittelohr gelegt. Das ist ätzend. So empfinden das auch meine an steuerbord wohnenden und schlafenden Leidensgenossen im Brückenaufbau.
Wir gründen eine Selbsthilfegruppe von Luftgewehr-Scharfschützen.
Der diensthabende Schütze liegt in Deckung auf den Grätings der Brückennock und visiert durch die leicht geöffnete Klappe der Steuerbord-Seitenlaterne. Schließlich gelingt ein Blattschuß auf ein dünnadriges freiliegendes Zuleitungskabel. Achtzehn angenehme Grad Kammertemperatur und kein "Wah" um 20.00 Uhr, keine Störung im ersten Tiefschlaf um 24.00 Uhr und auch um 04.00 Uhr wird durchgepennt. So schön kann das Leben sein.
Die Salzberge vom Schütter in Dünkirchen haben sich auf dem langen Seeweg bis Shanghai ordentlich verhärtet. Unter der harten Kruste allerdings ist das Salz weicher.
Die Löschmannschaften schaufeln in der Luke das Salz in Säcke. Füllen damit eine Netzbrook (ein großes Einkaufsnetz) und hieven die ca. 20 Säcke per schiffseigenem Geschirr an die Pier. Hier stehen in langer Schlange Handkarren. Vorn zieht ein Mädchen im blauen Watteanzug, blauer Mütze mit rotem Stern und schwarzhaarigem Bubischnitt zwischen zwei Deichseln, hinten schiebt die Kollegin im blauen Watteanzug, blauer Mütze mit rotem Stern und schwarzhaarigem Bubischnitt den mit je sechs Säcken beladenen Karren. Wir begegnen später diesen kleinen Logistikunternehmen zig-Kilometer weit vom Hafen entfernt in den Straßen von Shanghai.
Später erzählt mir "Quärchen" aus Shanghai kommend: "Sechsunddreißig Stunden brauchten die blauen Ameisen, dann waren zehntausend Tonnen Kalisalz aus Wismar in den Ladeluken in Säcke gefüllt und mit der Handkarre abtransportiert. Nach 36 Stunden liefen wir besenrein wieder aus."
Auf unserem Schiff graben die Lukenarbeiter tiefe Löcher in die verkrusteten Salzberge, um das weichere Salz unter der Kruste bequemer in die Säcke schaufeln zu können. Dabei erwischt es gelegentlich den am vordersten Streckenvortrieb buddelnden Aktivisten. Meist gucken aber von diesen aus dem über ihn eingebrochenen Gebirge noch seine derben Arbeitstiefel hervor. An diesem ziehen ihn dann rasch immer die Kollegen wieder hervor, achten aber darauf, daß er die ihm dann zugestandene Verschnaufpause nicht über Gebühr ausdehnt und damit die Aussicht auf die Erringung des roten Wimpels für den Wettbewerbssieger für die nächsten 4 Stunden gefährdet.
Die blaue Mütze des Verschütteten mit dem roten Stern wird später geborgen, wenn das jetzt gelockerte Gebirge in Säcke gefüllt ist.
Die chinesische Seemannsbetreuung ist unwahrscheinlich aktiv. Wir verbringen zusammengenommen sieben Tage in Shanghai, da wir nach dem Anlaufen von Hsingkang für die Übernahme der Rückladung wieder zurückkommen. Sieben Tage lang rollt nun täglich um 09.00 Uhr morgens ein Bus mit einem englisch sprechenden Dolmetscher an. "Was möchten sie sehen? Wir bieten ihnen dies, das und jenes." Mich fasziniert der Besuch einer kunsthandwerklichen Werkstatt.
Die Handwerker dort fabrizieren Atemberaubendes, aus Papier, Knete, Holz und am beeindruckendsten aus Elfenbein. Ich bewundere einen elfenbeinernen Maiskolben, mit einem hauchdünnen, abgeknicktem Blatt. So dünn, daß helles Licht durchscheint, aber eine Mittelrippe des vermeintlichen trockenen Blattes dennoch erkennbar ist. Auch eingeschnitzte seitliche Äderung ist täuschend ähnlich dargestellt.
Wir werden einer Vorstellung der Peking-Oper zugeführt. Das ist wahnsinnige Artistik. An die Kalkwand neben der Bühne wird in senkrechten chinesischen Schriftzeichen mittels Projektor den Shanghai-Chinesen erklärt, was die Pekinesen auf der Bühne gerade vertellen. Beide Volksstämme verstehen sich nicht so ohne weiteres. Wohl so ähnlich wie in Deutschland die Friesen und die Bayern.
Die Musik der Teufelsgeigen und das Geschepper in den höchsten Frequenzen läßt sich bei allem Wohlwollen nicht bis zum Ende der vierstündigen Darbietung ertragen. Wir flüchten nach zwei Stunden.
![]() Revolution und Jasmin-Tee
Revolution und Jasmin-Tee
Vor der Bewunderung der Kunstfertigkeiten der jungen Frauen und Männer in den Werkstätten hält deren big boss eine chinesische Begrüßungsrede. Unsere Begleitung übersetzt ins Englische, ich darauf ins Deutsche. Die Begrüßung zieht sich hin. Währenddessen knetet ein herbeigerufener Künstler als Kontaktgeschenke winzige Chinesenmännchen mit dennoch markanten und faszinierenden Gesichtsausdrücken. Ein Mädchen in blauer Wattejacke, blauer Mütze mit rotem Stern und schwarzem Bubischnitt serviert heißen Jasmin-Tee, der nähert sich im Geschmack destilliertem Wasser. Wer seinem Becher dennoch einen Schluck entnimmt, bekommt auf der Stelle nachgeschenkt. Um sich diesem Zeug zu entledigen, bringt also schnell austrinken überhaupt nichts. Ich mache in Shanghai von mehreren Besuchsangeboten Gebrauch, aber nie kann ich mich vor diesem merkwürdigen Begrüßungsgetränk drücken. Und jede, aber auch jede der obligatorischen Begrüßungsreden beinhalten den ins englische übersetzten Satz: Before the revolution....war hier alles großer Mist - und after the revolution ist hier alles roger!
Der große Mao hat alles gerichtet. Ich wende mich auf der Heimfahrt von solch einer Exkursion im fahrenden Bus an unseren Reiseleiter mit der Bitte, ob es wohl möglich wäre, mal nachzuschauen, wie so ein chinesischer Normalverbraucher mit der after the revolution dazu gewonnenen Lebensqualität klarkommt.
Ich habe den Wusch gerade fertig formuliert, da wendet sich unser Reiseleiter stehenden Fußes an den Busfahrer und nach dem Kommando "zing ping peng um lei tung!" hält der Bus
augenblicklich am Straßenrand. 1960 ist in Shanghai motorisiert kaum etwas unterwegs.
Unser Vorturner klopft an der erstbesten Haustür.
Ein altes hutzeliges Mütterchen öffnet. Ihr wird erklärt und wir in kleineren Gruppen in die gute Stube gebeten. Das Interieur besteht aus einer Bett- und Kochstelle, Tisch und Stuhl und wenigen Behältnissen, aufgestellt auf gestampftem Lehmboden. Die Frau beginnt zu plaudern, unser Führer zu übersetzen: "before the revolution....hatte ich 5 Söhne. (Mädchen sind in China ohnehin nicht erwähnenswert). Vier meiner Söhne sind Hungers gestorben, einer ist im Krieg geblieben. Jetzt, after the revolution......geht es mir gut, ich bin glücklich und zufrieden.
Entweder hat nun unser Dolmetscher und Abgesandter des natürlich auf Propaganda bedachten Seemannsclub der chinesischen Freunde eine vorgefertigte englische Standardübersetzung für alle Gelegenheiten auf seiner Festplatte, oder im China des großen Mao sind nun alle Chinesen auf Befehl oder freiwillig glücklich ohne Ende.
Unter diesem Aspekt ist es wichtig zu erwähnen: zu dieser Zeit, in der ich China besuche, erhält der chinesische Arbeitnehmer keinen Urlaub. Lediglich 52 freie Sonntage im Jahr und im Februar zum Blütenfest einige freie Tage, aber nur derjenige, der anläßlich dieses
Familienfestes zum Verwandtenbesuch größere Entfernungen überbrücken muß. Es gibt keine finanzielle Altersversorgung.
Die jungen Schaffenden kümmern sich um die Versorgung der alten erwerbsunfähigen An gehörigen. Nur beim Fehlen solcher Familienbande springt der Staat unterstützend ein.
Achthundert Millionen Chinesen tragen die gleiche Kleidung und den gleichen Haarschnitt. Die Frauen schnüren unter der blauen Wattejacke mit straffen Binden ihre Brust platt und drücken sie unter die Achseln. Weibliche Kurven zu zeigen haben die alten Herren der "Viererbande" verboten. Aber im Moment sind die prüden alten Herren noch die leitenden Genossen ZK-Mitglieder unter Führung des weisen Mao.
![]() Zum Blütenfest nach Hsingkang
Zum Blütenfest nach Hsingkang
Unsere vorher mit Salz vollgeschütteten Luken sind besenrein. Wir versegeln in das Gelbe Meer nach Nordchina. Hsingkang sollen wir anlaufen.. "Wir haben ein wenig Pech" erläutert mir der 'Second', "es ist jahreszeitlich noch zu früh, wenn wir Nordchina erreichen, aber ein paar Wochen später, ist Hsingkang ein blühendes Paradies. Besonders zur Zeit der Mandelblüte."
Die Brühe, vor dem weit in der Ferne liegenden Hafen im Gelben Meer ist noch gelber als die vor Shanghai. In dieser schwabbeln wir auf Reede erst einmal 14 Tage umher. Neben uns auf Reede schwoit vor Anker der polnische Frachter JAN MATEKU im kalten nordchinesischen Wind. Mit den polnischen Kollegen plauschen wir gelegentlich funktechnisch. Doktor Pfeil entfernt einem polnischen Seemann bei der Gelegenheit einen dickmachenden Zahn.
Ansonsten passiert nichts Aufregendes. Hsingkang besteht nur aus Gegend, einen Meter hoch und so weit das Auge reicht. Als einzige Attraktion sticht eine in den Schlamm gebaute Pier mit zwei Kränen, eine Hafenverwaltung und ein Seemannsclub ins Auge. Vor dem Gartenzaun-Portal des Seemannsclubs kämpfen zwei mickrige Bäumchen in dieser Salzsteppe täglich erneut um ihr Überleben. Diese beiden Durchhaltetypen sind, so weit das Auge reicht, die einzigen Erscheinungsformen irgendwelchen botanischen Lebens. Die zwei verkrumpelten Gewächse würden also die sagenhafte Mandelblüte hervorbringen, bei entsprechender Jahreszeit natürlich nur.
Second, du Schlawiner!
Drei Tage später läuft der polnische Maler JAN MATEKU ein. Es kommt zu spontanen Verbrüderungsszenen. Nach Tagen verabschieden wir uns von unseren polnischen Berufskollegen bei Mao Dei im Interclub. Morgen sollen wir auslaufen.
Unser Bedarf an Hsingkang ist auch gedeckt.
Wir bitten die polnischen Leidensgenossen noch zu einem letzten Gläschen zu uns an Bord. Dagegen hat aber der chinesische Gangway-Posten vor unserem Landgang seine Einwände. Der polnische Adler auf deren Seefahrtsbüchern sieht geringfügig anders aus als Hammer, Zirkel und Ährenkranz auf unseren blauen Dokumenten. Unsere beiden polnischen Freunde dürfen zu dieser nächtlichen Stunde nicht mit an Bord und erbosen sich darüber ganz enorm. Der Pole reißt dem chinesischen Posten die wärmenden Schapka vom Kopf, beschimpft ihn mit: "Kurwa, yellow tiger", packt dessen Dienstfahrrad, das am untersten Gangway-Podest lehnt und wirft es in den Bach. Zum Glück klemmt sich der chinesische breite Gesundheitslenker des Dienstrades zwischen der Spundwand der Pier und der Bordwand der DRESDEN fest. Es gibt gewaltige behördliche Huddelei.
Ich hoffe, daß dieser Offizier der JAN MATEKU sein Seefahrtsbuch behalten hat. Ich hätte das meinige, nach solch einem ungebührlichen Verhalten, in Rostock abgeben dürfen: "Schädigung des Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik!"
![]() Shanghai, die zweite
Shanghai, die zweite
Wir versegeln vom nordchinesischen Hsingkang wieder mit Südkurs nach Shanghai, zur Übernahme der Rückladung. Ich weiß jetzt nach so langer Zeit nicht mehr, was uns die Chinesen da in das Schiff packten, aber die begehrtesten Importartikel der DDR aus China waren damals Arbeitsklamotten und Stacheldraht.
Diesmal gehen wir in Shanghai in mitten des Jangtse-Flusses an die Festmachertonnen und laden von Schuten aus.
Beim zweiten Landgang in Shanghai fühle ich mich ja schon als alter Hase.
Der Seemannsclub in Shanghai beansprucht für sich, die längste Bar der Welt zu beherbergen. Der Tresen ist in der Tat so lang, das die ledernen Barhocker am anderen Ende des Tresens nur noch wie Steinpilze aussehen. Das kommt durch die Paraly..., die Paraphra... na durch die Verzerrung wegen der großen Entfernung.
Hinter diesem Tresen fungieren eine Menge Barmixer, ständig mehr, als vereinzelt Gäste vor diesen auf den Hockern hocken. Die Barmixer tragen blaue Arbeitsanzüge, hier im beheizten Innenbereich allerdings nicht wattiert, die übliche blaue Mütze und die übliche Kokarde daran, den roten Stern.
Die alten Typ-IV-Freaks lassen die alten Geschäftsbeziehungen aufleben. Man kennt sich schließlich aus in Shanghai und ruft nach Ober Hans.
Ober Hans ist ein Unikat, ein herrlicher Mensch.
Er trägt blauen Arbeitsanzug, blaue Mütze mit rotem Stern und spricht ein gut verständliches Deutsch, bei dem man sich aber dennoch bei jedem Wort kringeln könnte. Ober Hans hat natürlich auch einen dreisilbigen vernünftigen chinesischen Namen, aber damit belastet er uns nicht. Hans hat seine beachtlichen gastronomischen Fähigkeiten im österreichischen Tirol erworben und dabei auch die dort gebräuchliche, dem deutschen ähnliche Schluchten-Mundart erlernt. Diesem Schnadelhupfer-Dialekt hat er dann noch seinen chinesischen Akzent aufgepfropft und mit diesem berät er uns jetzt bei der Zusammenstellung unserer chinesischen Menüs.
Ich muß bei der Gelegenheit ein Wort über, nach meiner Meinung, verpaßte lukullische Erlebnisse, vieler meiner Berufskollegen verlieren. Besonders im nördlichen Teil Deutschlands verfährt man nach der Maxime: wat de Buar nich kennt, fret hei nich!
Wir sitzen also mit ca. zwölf Mann im Speiseraum der längsten Bar der Welt. Auf Grund der moderaten Preise im Seemannsclub, zu den nur ausländische Seeleute Zutritt haben, ist nahezu jedes lukullische Feuerwerk erschwinglich. Auf unserer Viermann-Back liegt die Speisekarte unter Glas und ist genauso groß, wie die Tischplatte. Knapp zwei Quadratmeter. Jedes Gericht ist auf der Fläche in etwa der Größe einer Streichholzschachtel in englisch und darunter in chinesisch aufgeführt. Hier findet der Ire sein Irish Stew, der Brite seine Ham and Eggs und, ich ahnte es, der Germane sein Hamburger Schnitzel. Auf diese Kostbarkeit giert sich nun der größte Teil unserer Leute. Hans serviert demzufolge promt ein Stück Fleisch, überdeckt mit einem Spiegelei. So wie es das an Bord auch nahezu aller vierzehn Tage gibt.
In zehn Minuten ist alles gegessen.
Das Shanghai-Bier ist vorzüglich, daran kann man sich natürlich noch eine Weile auf-schießen.
Wir vier an unserer Back lassen uns beraten, d.h. wir überlassen Hans die Regie. Mit der einzigen Einschränkung, außer seinen Eßknüppeln auch Löffel bereitzustellen. Messer braucht man bei chinesisch ohnehin nicht. Die Köche zerpitzeln ja schon alles, bevor sie es in den Topf oder den Wok-Schaffen werfen.
Hans beschließt, daß dreizehn Gänge schon erforderlich wären, um uns einen winzigen Einblick in chinesische Gourmet-Freuden zu verschaffen und fährt dementsprechend auf. Zuerst legt er eine weiße Leinendecke auf die Glasplatte. Dann stellt er als ersten Gang eine Suppenterrine auf die eine Ecke des Tisches und bedient im ersten Arbeitsgang den Gast auf der entgegengesetzten Seite des Tisches mit der Suppe, indem er mit der triefenden Suppenkelle erst einmal eine Diagonale über die weiße Tischdecke zu dem Napf des am weitesten davon entfernten Gastes zeichnet. Das ist ein Ritual und zeigt dem Gast gleich zu Beginn: Hier gibt es keine Etikette, hier zählt nur der Genuß, hier kannst du moddern und matzen nach Herzenslust.
Hans schleppt gemäß seiner von uns akzeptierten Menü-Beratung die seltsamsten Genüßlichkeiten heran.
Es mundet, oder wie der Italiener sagt: el mundo!
Beim fünften Gang serviert Serviermeister Hans runde Radiergummis in Schlackemaschü von der Größe eines Tischtennisballs. Diese Biester haben eine derartige Konsistenz, daß einen der Oberkiefer sofort wieder hochschnipst, wenn man versucht, die Bällchen bißmäßig zu durchtrennen. Schneidwerkzeuge, wie Messer, oder noch besser Stichsägen oder Trennschleifer werden dem Gast an chinesischen Tischen nicht geboten. Die Normalausrüstung bietet ja nur Stäbchen, wir verfügen mit Sonderausstattung noch über Löffel.
Als Hans mit dem sechsten Gang wieder anrauscht, bewerfe ich ihn zur Begrüßung mit den seltsamen, als eßbar bezeichneten Radiergummis des fünften Ganges.
Wir dürfen ja rummatzen.
Die Radiergummis vom Gang fünf werden von Hans als Krabbenklöße enttarnt.
Wir spenden sie für das chinesische Winterhilfswerk.
Die Gänge sechs bis dreizehn hauen dann, bis auf einen, wieder hin.
"Hans, Jussus, Maria und Joosef, sakra, was ist dös?" befrage ich ihn, während ich in einem seltsamen Schmadder herumstochere, der unangenehmer aussieht, als er eigentlich schmeckt.
"Hans, was hast du uns da serviert? Geselchtes Faschiertes mit Peuschel und Ribisseln in Paradeisersoße?""Seegurke" wäre der Grundbestandteil dieser Delikatesse, erklärt er uns mit Wiener Schmäh und seinem chinesischen Tüpfelchen darauf. Ich muß erst einmal wieder eine Runde schmunzeln und löffle zum Sympathie-Beweis das Zeug in mich hinein, mit Stäbchen ist es ohnehin nicht zu packen. Aber viele Jahre danach, an den Korallenriffen der Karibik, habe ich diesem Nahrungsmittel 'lebig' durch die Taucherbrille tief in die Augen gesehen. Zehn Jahre nach dem Verzehr der chinesischen Seegurken hat es mich dann nachträglich unter Wasser noch gewürgt.
![]() Das Cloche merle von Shanghai
Das Cloche merle von Shanghai
Über der 12 Millionen-Stadt Shanghai wölbt sich eine ständige Dunstglocke. Nicht so herb wie über Athen oder Mexiko-City und auch fast unsichtbar, aber unüberriechbar. Knoblauch!
Wir steigen zu zweit in den Bus zum Fähranleger, d.h. wir werden von 20 Mann hinter uns die Treppe hinauf gepreßt, obwohl nach unserem Raumordnungsverfahren erst einmal zwanzig Mann hätten aussteigen müssen, damit wir zwei überhaupt hinein passen. Aber die zwanzig freundlichen Damen und Herren hinter uns, die uns das Einsteigen überhaupt ermöglichen, fahren auch noch alle mit.
Alle in blauem Anzug und Mütze mit rotem Stern.
Nach dem ersten Atemzug in dem Bus verweigert meine Lunge einen zweiten.
Die ranghöheren Knoblauchmoleküle haben allen Sauerstoffatomen die Mitfahrt verboten.
Wir laufen blau an.
Ich kralle mich beim nächsten Halt an der blauen Wattejacke eines Aussteigewilligen fest und entgehe durch das gerade noch rechtzeitige Erreichen des Heckausstieges dem Erstickungstod.
An der Bushaltestelle steht, wie alle nasenlang, ein Spucknapf. Der verfügt über eine ausgeklügelte Mechnik. Der Spuckbedürftige bedient nach dem Herantreten einen Fußtritt, darauf öffnet sich oben die blecherne Abdeckung des Topfes und man könnte dann sorgfältig in das Behältnis spucken.
Das aber macht kein Schwanz.
Jeden männlichen Einwohner Shanghai's bedrängt aber ein ständiges Spuckbedürfnis und so bombardiert jeder männliche Einwohner Shanghai's, mit mehr oder weniger guter Trefferquote, beim Passieren jeden Spucknapf schon aus großer Entfernung. Manche Exemplare ähneln dann den Stalagmiten der Tropfsteinhöhlen. Es herrschen Minusgrade!
Wir gehen am Fluß ein Stück zu Fuß und stehen vor einer öffentlichen Bedürfnisanstalt. Eine gelungene Wellblechkonstruktion mit an den Dachecken hochgezogenen Spitzen im Teehaus-look. Dazu noch in Top-Lage an der Flußpromenade.
Ich schaue hinein. Das vorher genossene Shanghai-Bier und der Mao-Dei bestehen darauf. Das langgezogene Gebäude hat an jeder Stirnseite eine Türöffnung, aber keine Tür. So ist der Tempel gut belüftet und leicht zu betreten.
Von einer Öffnung zur anderen führt ein gefliester Mittelgang. Links und rechts von diesem befinden sich in ca. 70 cm-Abstand Griffstangen und zwischen diesen, weiter nach hinten eingerückt, im Boden eingelassene Fußabdrücke. Wieder weiter nach hinten versetzt, schon fast an der wellblechigen Rückwand ist ein Loch im Fußboden eingelassen. Wenn man nun mit chinesischen anatomischen Standardmaßen seine Hufe in den Fußabdrücken postiert, leicht in die Hocke geht und, um diese zu halten, sich an den Griffstangen verankert, kann man problemlos, absolut mittschiffs in das Loch in den Fußboden kacken.
Bei der Kälte raucht das ordentlich!
An der gemeinsamen Griffleiste muß man sich natürlich mit dem Nachbarn arrangieren, so wie auf der gemeinsamen Armlehne eines Kinositzes.
Der Musentempel ist trotz des grimmigen Kontinentalklimas gut besucht.
Ein schlitzäugiger Chinese sieht beim Drücken einfach zu putzig aus und da ich in dieser heiligen Stätte nicht vor Lachen pietätlos losprusten kann, pinkle ich später an geeigneter Stelle in den lehmigen Fluß.
Wir fahren mit einer Rikscha weiter.
Der Fuhrunternehmer tritt kräftig in die Pedalen und bringt uns in der frischen Luft des Fahrtwindes zum Fähranleger.
Uns ist das irgendwie peinlich.
Schließlich ist man nicht als Pascha auf die Welt gekommen, nur mit zu geringer Knoblauchresistenz. Aus einem Arbeiter- und Bauernstaat kommend und aus einer ebensolchen Familie, bin ich nicht gewöhnt, jemanden für mich so schindern zu lassen.
Um mit solch einem Snobismus mein Gewissen nicht ein Leben lang zu belasten, gönne ich dem Tour de France-Anwärter ein fettes Trinkgeld. Er entnimmt der vollen Hand der ihm hingehaltenen Aluminium-Ships ohnehin nur wenige Fen, wirklich nur Pfennige. Ich schenke ihm zur Reinwaschung meiner versnobten Seele, mehr, als er für seine Transportleistung meiner hohlen Hand entnahm.
Meine Seele bleibt schwarz bis zum jüngsten Gericht!
Es ist absolut nicht zu machen, dem Kerl das Trinkgeld anzudrehen. Jeder China-Fahrer dieses Jahrgangs wird mir das bestätigen, die Chinesen in Mao's Gefolge sind direkt schon atemberaubend ehrlich und zurückhaltend.
Ich sinniere über die Kreuzung von soviel übertriebener Redlichkeit mit dem soviel übertriebenen Hinlangen zum Beispiel in Beirut oder Port Said.
Nach einer Kutschfahrt durch Port Said dem Fuhrunternehmer eine volle Hand Piaster hinzuhalten, würde die verlangte Nachlieferung weiterer Hände, fast ohne Ende, herauf-beschwören.
Wir besteigen die Fähre, die uns zur DRESDEN bringen soll. Das Schiff liegt an den Tonnen. Wir erwischen die verkehrte Fähre. Diese fährt flußaufwärts, zu den dort oben angebändselten Dampfern, der unsrige liegt flußabwärts. Nahbereich-Sprechfunk hat ja noch nicht einmal unser Starschiff, das chinesische Wassertaxi natürlich auch nicht. Daran arbeitet zu diesem Datum die Technik weltweit noch. Aber mit seiner Tute kann der chinesische Schipper umgehen und schwupp schon kommt eine für uns zuständige Arche längsseits und karrt uns freundlicherweise flußabwärts, ohne Aufpreis oder Bakschisch wie der Araber sagt.
![]() Geschichtliches
Geschichtliches
Außer vielen Kisten nehmen wir auch ein deutsches Ehepaar mit Töchterchen als Passagiere mit nach Rostock.
Der Ingenieur ist Spezialist für Wärmekraftwerke und half jahrelang dem Bruderland China beim Bau solcher Energieerzeuger. Er kennt sich in dem Land mit seinen seltsamen Gepflogenheiten gut aus. Ich nutze dieses Insider-Wissen auf der langen Heimreise zur Vervollkommnung meines Weltbildes.
Die mooring men im Festmacherboot lösen die Leinen an den Festmachertonnen. Beginn der Seereise! Es geht heim zu Mutter'n.
Aber der Heimweg ist weit.
Ich komplettiere meine Chinaeindrücke und höre bei dem Ingenieur interessiert zu:
In Chinas bewegter Geschichte verhungerten viele Millionen Menschen, eine halbe Million Chinesen ertranken in diesem Jahrhundert im immer wiederkehrenden Hochwasser der riesigen Flüsse. Der Gelbe Fluß bringt jährlich Unmengen gelben Lehms aus dem nördlichen Hochland Chinas mit und lagert nach abnehmender Fließgeschwindigkeit im Süden die Sedimente am Flußgrund ab. Einen feinkörnigen Rest der gelben Schwebstoffe behält der Fluß aber bis zu seiner Mündung noch listenreich im Gepäck, zur Gelbfärbung des Gelben- und des Ostchinesischen Meeres.
Die Ablagerungen am Flußgrund heben oben den Wasserspiegel an. Das viele Wasser paßt nun nicht mehr so recht in das Flußbett hinein. Dann tritt es wegen Platzmangel kurz entschlossen oben über die Deiche.
Die Anrainer, die das überleben, bauen dann Jahr für Jahr die Dämme höher und schauen dann Jahr für Jahr von unten zu ihrem immer weiter über ihnen dahinrauschenden riesigen Fluß empor.
(Gerade im Jahr 1998 geht das mal wieder gar nicht gut, es ertrinken aber nur einige Zigtausende.)
"Vor der Machtübernahme Mao Tse-Tungs, also before the revolution verhungerten und ertranken in regelmäßigen Abständen Hunderttausende seiner Landsleute. Jetzt werden diese alle einigermaßen satt und vor den verheerenden Hochwassern leidlich geschützt.
So gut wie sich das eben machen läßt.
Das ist für die vormals Betroffenen ein echter Zugewinn an Lebensqualität.
Unser dolmetschender Reiseleiter mit seinem stereotypen bevor the revolution - alles Mist, after the revolution - alles bestens, hat nicht gelogen oder gar so übertrieben schöngefärbt. Aber man muß Chinese sein, um einen uns so kläglich erscheinenden Lebensstandard als Zugewinn an Lebensqualität euphorisch feiern zu können!
Auf der langen Rückreise von China nach Rostock hören wir den Geschichten des deutschen Passagier-Ehepaars gerne zu. Seit zwei Tagen halten sich die Eltern des kleinen fünfjährigen Wirbelwindes mit ihren Kulturbeiträgen allerdings vornehm zurück.
Wir stampfen durch schlechtes Wetter. Pappi und Mammi sind heftig seekrank.
Die Kleine allerdings ist quicklebendig. Wer Zeit hat, spielt mit dem niedlichen blonden Mädchen.
Martin Schwinke, der Obersteward bringt das Mädchen eines stürmischen Morgens früh halbsieben vom gischtumblasenen Hauptdeck zurück in den Brückenaufbau. Sie war ihren seekranken Eltern entwischt und hat vor dem Frühstück an Oberdeck mit den fliegenden Fischen gespielt, die während der stürmischen Nacht sich verflogen haben und teilweise im Wassergraben am Schanzkleid noch mit den Schwänzen schlagen. Die Mutter der Kleinen verliert die letzte, noch verbliebene Gesichtsfarbe, als ihr der Ausreißer zurück gebracht wird.
Heute scheint die Sonne wieder, der Seegang ist abgeebbt und unsere Passagiere beenden dadurch ihre strenge Diät und plaudern auch wieder mit uns:
"Vor ein paar Jahren gingen den Chinesen die Fliegen auf den Senkel. Sie übertragen Krankheiten und verderben Lebensmittel. Die Fliegen müssen radikal bekämpft werden, war die Losung des Jahres. Jedem chinesischen Staatsbürger und jeder chinesischen Staatsbürgerin (damit Frau Schwarzer nicht mit mir meckert) wurde eine Plastik-Fliegenklatsche kostenlos zugeteilt. Diese hatte ein jeder stets am Mann bzw. an der Frau zu tragen und damit allerorts mitleidlos auf jede Fliege einzudreschen, der man nur habhaft werden konnte. Die Wirkung war selbst für chinesische Verhältnisse verblüffend. Das Land mußte später sechs Fliegenpärchen aus Korea importieren, da die Spezies der chinesischen Stubenfliege (summsi kemenatus sinensis) ausgestorben war!"
Tags darauf verkürzen mir unsere interessanten Passagiere mit folgendem Tatsachenbericht meine Wache im Funkraum:
"Die Fliegen waren durch das Mittun eines jeden aufrechten Chinesen ausgerottet, aber allerorts tschilpen Myraden von Spatzen von den hochgezwirbelten Teehausdächern. Spatzen verbreiten auch Krankheiten, fressen tausende Tonnen des ohnehin knappen Getreides weg und kacken dann überall hin und das Wellblech verrostet dadurch auf den Dächern.
Die Spatzen müssen radikal bekämpft werden, ist die staatlich befohlene Devise der Woche!
Spatzen sind keine Zugvögel, sie können mangels Trainings nur miserabel fliegen. Wenn es der ständig vollgefressene Vogel überhaupt 100 Meter von einem Hausdach zum anderen schafft, ist er nach der Landung schon ordentlich aus der Puste. Diese schlechte körperliche Verfassung ist der chinesischen Vögel Untergang.
"Raustreten zum Krachmachen und erst nach drei Tagen damit wieder aufhören", lautet der Tagesbefehl zur Ausrottung der Spatzen.
Befehlsgemäß machen im Land abermillionen Spatzenhasser mit Rasseln, Blechbüchsen, Töpfen und WOK-Pfannen auf Dächern, Straßen und Parks gewaltigen Radau. Die phlegmatischen Vögel steigen nun erschreckt in die Lüfte. Aber an der Leistungsgrenze ihres Aktionsradius stehen immer noch krakeelende Spatzenhasser auf allen Dächern und Plätzen. Solcherart erschreckt, fällt nach drei Tagen auch der letzte chinesische Spatz tot vom Himmel!
Durch derartig imponierendes Leistungsvermögen der motivierten werktätigen Massen beeindruckt, ruft das ZK alsbald zur nächsten konzertierten Aktion.
Jede chinesische Hütte auf dem Lande, ob Schuster, Schneider, Handwerker, Lehrer oder Bauer, jede Hütte wird ein Hüttenwerk!
Die aufblühende chinesische Volkswirtschaft braucht Stahl!
An zentralen Ausgabestellen versorgt sich ein jeder nun mit Eisenerz und Koks. Der private Hochofen wird aus Lehm gebacken. Lehm ist in China keine Mangelware. Ein jeder bruzzelt solcherart verbissen vor sich hin und läßt aus dem Gestein das Roheisen tropfen. Die Masseln liefert er mit stolz geschwellter Brust an zentralen Sammelstellen wieder ab und erhält dort für sein Engagement auch eine kleine materielle Anerkennung.
Aber gerade diese Anerkennung zusammen mit der verhütteten Zeit läßt bald schon auf den Feldern der Bauern die Ernten mißraten und am wilden Fluß den Deichbau vernachlässigen. Der Zimmermann vollendet den begonnen Dachstuhl nicht und auf dem Schulhof pustet,
auf dem Bauch liegend, der Lehrer in seinen Hochofen. Seine Schulklasse schleppt Erz und Kohle heran.
So bleibt neben dem Lehrer noch vieles im Land liegen. Jetzt gibt es zwar ausreichend Roheisen zum weiteren Verhütten, aber keine Nahrungsmittel für die Verhütter.
Der weise Mao hatte den ökonomischen Hebel falsch angesetzt.
![]() Dekubitus und Schwanzfraktur
Dekubitus und Schwanzfraktur
Trotz der vielen Leute an Bord, hat der Doktor die zweitwenigste Beschäftigung.
In seiner Unterbeschäftigung findet er auch am zweitwenigsten Ablenkung.
Nur der Politoffizier läuft diesbezüglich völlig außer Konkurrenz. Der ist an Bord so wichtig, wie ein Vogelhäuschen am Vormast. Er beschäftigt sich nur mit seinem großflächigen Dekubitus und damit auch den Doktor.
Außer den Politnik hat der Doc nur den Kater "Patrick" zu betreuen und vor Patrick einen Maschinen-Assi, den Patrick gebissen hat.
Bei der schrecklichen Hitze vor der Insel Penang hatte ein jeder seine Kammertür auf dem Haken hängen, um durch das gleichfalls geöffnete Bulleye Durchzug zu produzieren. Durch die geöffnete Kammertür schleicht sich Kater Patrick im unteren Deck in die Kammer vom Maschinen-Assi "Öli". Springt, vom schlafenden Öli unbemerkt, in dessen Koje und macht es sich am Fußende bequem. Im Schlaf tritt der Assi nun den Kater in die Lenden, der nimmt das persönlich und beißt Öli heftig in den großen Zeh. Danach springen Kater und Mensch, im Synchronsprung, zu Tode erschreckt aus der Koje. Ölis angebissener großer Onkel überfordert den Doktor nicht, aber nun, in seinem nächsten Fall hat er es mit einer schwersten Fraktur zu tun.
Eine böse aussehende Schwanzverletzung.
Aber diesmal zur ausgleichenden Gerechtigkeit nicht bei Öli, sondern bei Patrick. Der Kater war mit seinem Schwanz beim letzten schlechten Wetter in Begleitung eines Matrosen beim Gassimachen nicht rechtzeitig über das Süll eines schweren Außenschotts gesprungen, als dieses wieder, wegen des widrigen Wetters, schnell verschlossen wurde. Der Kater war schon drin, das obere Drittel seines Schwanzes aber noch draußen.
Patricks Schwanz hatte jetzt die Form einer Eins.
In Doktor Pfeils Lazarett kommt Hektik auf.
Eile ist geboten.
Patricks Schwanz wird mit zwei Holzspateln geschient und dick eingegipst. Eigentlich Liegegips, aber das störrische Vieh hält sich nicht an Bettruhe. Wenn Patrick nun bei schlingerndem Schiff durch die Gänge streift und somit, genau wie wir auch, Schwierigkeiten hat die Balance zu halten, klapperte sein Liegegips ständig an den Sprelacard-Wänden der Gänge.
Aha, Patrick kommt!
Die Fraktur verheilt so prächtig, daß der Doktor auf Gehgips verzichtet und bei der Gesundschreibung keine Folgeschäden bescheinigt. Patrick gibt nun mit steil empor gerecktem Schwanz wieder mächtig an.
![]() Das Kind im (See)Manne
Das Kind im (See)Manne
An Bord treten zunehmend die Probleme des Ostasienkollers auf.
Auch der Doktor ist befallen, eigentlich am heftigsten.
Wir sitzen im Saloon in fröhlicher Runde, als einer mit einer ganz besonderen Attraktion aufwartet, einer Flasche Mao Dei. Ein Mitbringsel aus Shanghai. In dem Schnaps allerdings ist in mehreren Bögen eine Schlange drapiert. Die Flasche macht die Runde. Wir betrachten die Rarität, wie ein eingeschlossenes Fossil in einem Stück Bernstein.
"Was eine Schlange" staunt Doktor Pfeil, dreht den Verschluß auf, verschließt die geöffnete Flasche aber wieder mit seinem gepflegten Gynäkologendaumen und fabriziert durch heftiges Schütteln aus dem Schlangen-Wodka so eine Art Danziger Goldwasser. Statt Goldblättchen flattern halt Schlangenschuppen, und so und alles, in der Buddel herum. Die Schlange ist aber so fein auseinandergestoben, daß sie beim Trinken nicht hinderlich wirkt.
Im Saloon ist nach der coffee-time Rennsonntag.
Leider nicht mit Kakerlaken.
Für renntaugliche Kakerlaken war in China, genau wie für die Mandelblüte, das Klima zu ungünstig. Renntaugliche Kakerlaken mit einer Länge über alles von sechs bis acht Zentimetern und gut ausgebildeter Oberschale, die auch eine gut sichtbare Rückennummer tragen kann, gedeihen nur in langanhaltendem feuchtwarmen Kombüsenklima. Die chinesische Kontinentalkälte ließ die gegenwärtige Population an Bord degenerieren und bringt keine dressurfähigen Rennkakerlaken hervor.
Ersatzweise kommen Bären zum Einsatz.
Fünft oder sechs Leute haben für 60 Fen im Shop, an der langen Bar in Shanghai, kleine schwarze Spielzeugbären erworben.
Ich auch.
Nach dem Aufziehen setzen diese einen Huf vor den anderen, wackeln mit dem Schädel und peesen ordentlich los. Mit diesen Viechern werden jetzt im fortgeschritteneren Stadium des Ostasienkollers enthusiastisch umjubelte Bärenrennen veranstaltet. Nach jedem Rennen muß allerdings, nach heißen Diskussionen, das Regelwerk geändert werden. Mehrere schlichtende Schiedsrichter, die nicht im Besitz eines Bären sein dürfen, haben alle Hände voll zu tun. Jeder Bär hat seinen Stolz und unterschiedliche Veranlagungen. Klaus Völlmers Bär sprintet nach dem Startschuß aus den Startlöchern wie Jesse Owens. Dieser Hektiker gewinnt jeden Sprint, hängt aber nach 74,37 cm die Zunge raus. Meiner keult im Paßgang, gemäßigten Schrittes hinter dem Hektiker her, schmeißt dann aber erst nach 91,71 cm das Handtuch.
Auf den übrigen Startbahnen herrschen ähnlich konträre Verhältnisse.
Nur Cross und Hindernislauf schafft nach Jury-Entscheid einigermaßen Chancengleichheit.
Vorerst.
Am nächsten Renn-Donnerstag, nach der coffee-time, sind sämtliche Bären des kompletten Starterfeldes gedopt.
Die Juroren finden kleine Metallhaken unter den Bärentatzen, Schmirgelleinwand auf allen Gliedmaßen, Antirutschbelege und tiefergelegte Schwerpunkte, um die von der Jury in den Weg gelegten Hindernisse besser und schneller zu erklimmen.
Doktor Pfeil's Bär ist natürlich auch mit allen Unredlichkeiten ausgestattet.
![]() Ich besteige die Emma
Ich besteige die Emma
Im März 1961 endet mein Typ-IV-Schiff - Einstand und damit der vorteilhafte Umstand, als zweiter Funkoffizier unter Anleitung Erfahrungen sammeln zu können. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, die nächsten zwanzig Jahre muß ich als ständiger Einzelkämpfer auf den Schiffen der Reederei weltweit meine Wellen ausbreiten.
Als erstes vertrete ich urlaubsweise Funkoffizier Gerd Schäfer für eine Mittel- und
Schwarzmeer-Reise. Gerd Schäfer ist seine Emma ans Herz gewachsen. Emma ist der reedereiweite Kosename für die "E.M.A" oder ausgeschrieben: Dampfschiff "Ernst-Moritz-Arndt" / DHZY.
Die "E.M.A." ist ein teuer bezahltes griechisches Geschenk und hieß vorher "Erzengel Gabriel". Der Erzengel sieht im Winter 1958 in der Ostsee nicht so recht durch und kommt im DDR - Hoheitsgewässer vor der Greifswalder Oie auf dem Grund fest. An ihm zotteln nun die PS - schwachen Schlepper des VEB Schiffsbergung herum und bekommen ihn erst vom Grund frei, nachdem ein Teil der Eisenerzladung aus Brasilien auf Schuten umgeschlagen wurde.
Das havarierte Schiff wird nach dem Freikommen nach Szczecin geschleppt.
So etwas erfüllt den Tatbestand der "schweren Bergung" und erbringt mit etwas Glück unwahrscheinlich viele wertvolle Valuta. Das erhofft sich zumindest die Staatskasse. Statt dessen hat sie nun den geborgenen Erzengel am Hals, den der griechische Eigner, statt der Begleichung seiner Bergungsschulden nun der Bergungsfirma überläßt.
Der "Archon Gabriel" ist ein ehemaliger "Liberty"-Dampfer. Von diesen Schiffs-Typen wurden zur Zeit des II. Weltkriegs über 4000 Schiffe in den USA billigst und schnellstens zusammengenietet. Dann mußten die Schiffe je zehntausend Tonnen Kriegsgerät nach Europa transportieren und um ihr Ziel zu erreichen, meist nur von einem Bootsmann kommandiert, im Geleit immer einem navigierenden Leithammel hinterherfahren. Für jeden Frachter, den die deutschen U - Boote erwischten, wurden schleunigst hundert neue auf Kiel gelegt.
Die "Liberty" erreichten mit nur 2500 dampferzeugten PS bei schönem Wetter gerade 9 Knoten Marschfahrt und wurden so häufig ein gefundenes Fressen für die feindlichen U-Boote.
Jetzt in friedlichen Zeiten ein willkommenes Trainingsgerät für die Delphine.
Nur noch die Koggen, schoben einen so delphinfreundlichen dicken Steven mit einer schönen tragenden Bugwelle so gemütlich langsam durch das Wasser, daß auch Pensionäre, Schwangeren, Kleinkinder und die Vollgefressensten vor dem Steven der E.M.A. ihre bewegungs-therapeutischen Programme gemütlich abspulen könnten.
An so einem Eimer ließ nun der VEB Schiffsbergung seine schwere Bergung ablaufen um sich den Pudel dann schenken zu lassen. Jetzt bekehrt die Deutsche Seereederei den heiligen "Archon Gabriel" zum Freiheitsdichter ERNST-MORITZ-ARNDT.
Das Schiff ist nach menschenwürdigen Gesichtspunkten nicht bewohnbar. Es geht nach Danzig in die Werft und wird dort so aufgemotzt, das Funkoffizier Schäfer nicht mehr von ihm lassen kann.
Ihn vertrete ich nun für eine zweimonatige Reise. Zwei Monate wilde Schinderei.
Außer den normalen Funkbetrieb erledigte mein Vorgänger auf seiner "E.M.A." die gesamte Verwaltungsarbeit, d. h.
• Die Proviantabrechnung gemäß des Verpflegungssatzes von 6,- M pro Mann,
• Die Handgeldabrechnung (für Offiziere 2,70 Valuta-Mark) pro See- und ausländischen Hafentag
• Die Transit-Waren-Ausgabe und Abrechnung und
• als größten Horror, die Lohnabrechnung für 44 Mann.
Das kann doch nicht so schlimm sein, meint da sicher so mancher Leser, der jetzt im technisierten Zeitalter evtl. auch schon sein Erinnerungsvermögen strapaziert: "Wie ging das noch mal mit zu Fuß multiplizieren?"
Die Reederei hatte das Schiff zwar schnuckelig bewohnbar gemacht, aber das finanzielle Opfer für die Anschaffung einer Rechenmaschine nicht erbracht.
Der elektronische Taschenrechner war noch nicht erfunden. Wenigstens ein solcher Winzling, im heutigen Scheckkarten-Format für 1€ hätte mich damals glücklich gemacht.
Bei Schiffsversorgung in Rostock gibt es keine Kartoffeln. Jedenfalls nur ein paar Sack. "Bescheinigen sie mir bitte ihre Lieferunfähigkeit" verlange ich vom Filialleiter. Dieses Ticket wird mir verweigert, mit der Begründung, daß ich es dann ja schriftlich hätte, daß in der DDR die Kartoffeln knapp sind. Ein Zentner Kartoffeln kostet in der DDR 6,30 Mark, falls vorhanden. Das Schiff bunkert die benötigten Grundnahrungsmittel in Alexandria/Ägypten nach. Den Sack für 36,- DM wertvolle Valuta.
In "Alex" läßt mich die Devisenabrechnung verzweifeln. Den deutschen Handgeldanspruch in Pfunde und Piaster ummünzen, in 44 verschiedenen Ansprüchen zum Landgang ausgeben und pünktlich vor dem Auslaufen die Rückgaben zurück rechnen. Das kostet Energie. Ich muß doch alles zu Fuß rechnen!
Im nächsten Hafen, zum Monatsende, sitze ich über den 44 horizontalen und ca. 30 vertikalen Spalten meines riesigen Lohnabrechnungsbogens noch früh um 04.00 Uhr, den Tränen nahe, während meine Lohnempfänger weinselig vom Landgang in Constanza zurückkommen.
Wir versegeln mit ein paar Tausend Tonnen Mais, in dem sehr tragfähigen Schiff, an die italienische Riviera nach Savona.
Auf Reede umrunden unseren Luxusliner die schnuckeligsten Girls im Bikini mit Tretbooten. Wir flirten zu ihnen hinab und die Mädels zu uns herauf.
In den Hafenkneipen kostet ein Humpen Rotwein mit Berg drauf 100 Lire, 60 Pfennig.
An der Pier laden wir dann Reis in Säcken, aber nur bis zum nächsten Tag. Ein wichtiger Aufsichtshabender entdeckt in dem Mais - aus dem rumänischen Constanza - Kornkäfer und tobt ganz wild herum, weil mit diesem rumänischen Ungeziefer jetzt sein schöner italienischer Reis versaut ist. Es kommt eine vereidigte staatliche Aufsichtsbehörde und forscht in den Ladeluken herum, dann legt der Gutachter sein Ergebnis vor: "Der Mais aus Constanza ist o.k., aber der dazugekommene Reis ist voller Kornkäfer."
Der Italiener tobt nun nicht mehr wegen seines angeblich versauten Reises, aber wegen den Kosten, für die Ausgasung der gesamten Laderäume. Die bekam er natürlich als Verseucher aufgebrummt.
Uns verbleibt ein wenig mehr Zeit, die schmackhafteste Rotweinsorte in Savonas Hafengastronomie herauszufinden. Das brauche ich einfach, um danach wieder kopfrechnen zu können.
![]() Der Tanz um den Weihnachtbaum
Der Tanz um den Weihnachtbaum
Diese Reise und auch der Sommer gehen zu Ende. Ich diene auf verschiedenen Schiffen und vertrete die zur Stammbesatzung gehörenden Kollegen. Ich bin noch neu und muß mich in der Hierarchie erst hochdienen. So schaue ich auf kurzen Reisen mal hier und mal dort hin und natürlich, das ist doch völlig klar, erst recht über Weihnachten/Neujahr. Mit dem Dampfer WISMAR führt mich der Weg nach Hangö ins finnische Eis. Dort liegen jetzt zu Weihnachten die Schnapspreise in astronomischen Höhen, behaupten die alten Hasen auf dieser Fahrtroute. Jeder bunkert ordentlich "Schilkin-Wodka" und scheißt sich damit an. Die Finnen gaben vor Weihnachten an ihre, wie immer nach Brennol lechzende Männerwelt anscheinend ausreichend Gutscheine aus, mit denen sie ihren Alkholspiegel wieder auffrischen konnten. Wir werden mit unseren an Bord sorgfältig vergrabenen Beständen mit spärlicher Nachfrage herb getroffen.
Unter Protest versegeln wir im Neuen Jahr nach Klaipeda. Klaipeda hieß vor dem verlorenen Krieg Memel, was von dem hier in die Ostsee mündenden Fluß herrührt.
Klaipeda liegt jetzt in der Litauische CCCR und wird russisch kommandiert.
Über die Memelmündung toben heftige Winterstürme. Dampfer WISMAR geht mit Lotsen- und Schlepperassistenz stevengerecht an die Pier, ragt mit dem Steven demzufolge ein wenig über die Kaikante und verplettet dem dort geparkten Kran einen Rüffel. Dieser überfordert die Statik der Konstruktion. Der Kran kippt um und fehlt dann bei den Umschlagsarbeiten und sein herumliegender Schrott behindert diese zusätzlich.
Das Schiff legt unbeschadet nach der Sturmfahrt an der Pier an und wird gewissenhaft vertäut.
Klaipeda hat kein nervenaufreibendes Nachtleben. Aber im "Club Rabotja" steppt der Bär. Es ist Anfang Januar und man huldigt dem "Djed Moroc" (Väterchen Frost). Im "Club Rabotja" ist "Danzuwatch wokrug jolku", der Tanz um den Weihnachtsbaum. Wir nehmen in einer größeren Abordnung an diesem kulturellen Höhepunkt teil. Als Kälteschutzausrüstung führt jeder eine Flasche "Schilkin Wodka" am Mann, natürlich im Wintermantel verborgen. Im Club toddert Afanassja Filipowa erst einmal eine Runde mit uns. Wir haben keine Kopeken für den Eintritt. "Da Da, dla wodku u was ... ist wohl Geld immer vorhanden, aber die paar Kopekitschki Eintrittsgeld habt ihr nicht!" Die Ausmecker geht ihr so locker über die Lippen, ich vermute ihr Alter daheim ist nicht zu beneiden und hört diese Litanei in ähnlicher Form sicher auch in der Woche fünf Mal.
Ich lade die Babuschka zu einer Daumenbreite aus meiner Buddel ein, das stimmt sie milder.
Ludmilla im "Club Rabotja" ist Kumpeline. Sie schließt unsere übergewichtigen Wintermäntel vorsorglich ein Deck höher in der dortigen leeren Garderobe ein. Sicher ist sicher. Der Verdunstungsfaktor sowohl für Kälteschutzmittel als auch für Wintermäntel nimmt ab der deutsch - polnischen Grenze im Quadrat der Entfernung zu. Wir schauen dann während der herrlichen Weihnachtsfeier ab und zu nach der freundlichen Ludmilla und unseren Wintermänteln. Den Einheimischen fällt dann zunehmend unser angenehmer Mundgeruch auf, das Aroma ist ihnen so fremd nicht.
Um das friedliche Weihnachtsfest auch friedlich über die Runden zu bringen, verweigert man diesen darbenden Menschen berauschende Getränke.
In der Mitte des Saales steht eine prächtige Fichte, die "Jolka" eben. Von denen wachsen in dieser Gegend reichlich. Oben in der Stuck-Decke des Saales ist ein Loch in das Mauerwerk geschlagen, darin klappert das entastete, noch schaufelstiel-starke obere Ende des Baumes.
Die Jolka dreht sich nämlich.
Dieses bewerkstelligt ein am Fußende aufgestellter E-Motor mit Keilriemen und Riemenscheibe. Über das Zuleitungskabel auf dem Tanzboden hüpft man beim 'dancing' am günstigsten im Schuhplattler-Rhythmus.
Die Musik ist natürlich handgemacht, life!
Nur Sitzgelegenheiten sind die absolute Mangelware.
Ludmilla besorgt uns aber sechs Stühle. Damit besetzen wir so eine Art VIP-Longe. An Steuerbordseite des großen Saales stehen die Damen zwanglos herum.
Mittschiffs ackert die Jolka.
An Backbord lümmeln die Tänzer an der Wand.
Wenn der Kapellmeister auf der Bühne die Violine hebt, nehmen die Tänzer, die es an diesem Abend noch zu was bringen möchten, eine so ähnliche Startposition ein, wie das Starterfeld eines olympischen 3000-Meter-Laufes. Der Kapellmeister sagt dann das Musikstück an, an dem sich für den nächsten Tanz um den Weihnachtsbaum das Estradenorchester versuchen wird. Bei dem angekündigten Titel: "Walz grasunowa" stürze ich auch aus den Startlöchern.
Bei einem Walzer kann man ja nichts versauen. Ich schaffe 10,5 sec. auf hundert Meter und erreiche außer Atem meinen Schwarm. Ordentlicher Diener: "rasreschietje ?"
Ich hieve Nataschenka 'tide' und walze mit ihr um die Jolka. Dabei muß oben herum auf die längeren herausragenden Äste geachtet werden, die einem in der Drehbewegung entgegenschleudern. Es erweist sich arbeitschutzgünstiger, mit der Drehrichtung der Jolka zu walzen, oder überhaupt den Nahbereich zu meiden.
Wenn das Stromkabel auf dem Boden wieder überhüpft werden muß, hat man eine Runde erfolgreich absolviert.
Die Kapelle gönnt sich eine größere Pause.
Die Kulturbeauftragte des "Club Rabotja" postiert unterhalb der Bühne nun einen aus Sperrholz gesägten Storch mit hoch erhobenem Schnabel. So einen übergroßen Salzbrezelhalter. Dann wird zu diesem Vogel eine Distanz abgeschritten und markiert. Ab dieser Linie dürfen nun Interessierte versuchen, mit einem gezielten Wurf, den Vogel einen Bastring um den aufgereckten Hals zu werfen. Das ist schwierig. Wer diese Schwierigkeit meistert, wird für den Rest des Abends durch ein angeheftetes Abzeichen als Leistungssportler ausgewiesen, zu den alle ehrfurchtsvoll aufschauen können.
Mich packt einer am Handgelenk und will mich von meiner mühsam behaupteten Sitzgelegenheit ziehen. Nataschenka zupft an mir. Sie kann nicht verstehen, wie ich mich diesem Gaudi versagen kann. Auf Grund ihrer Initiative werden wir gemeinsam an der Markierung postiert und ballern dem Holzvogel auch einige Ringe an Hals und Schnabel vorbei.
Am Ende des schönen Festes spielen sich draußen auf der Straße und in den kalten Pfützen gräßliche Szenen zwischen Littauern und Russen ab.
Nataschenka erklärt mir die Zusammenhänge.
Hier wird mir zum erstenmal verdeutlicht, daß über den ethnisch so verschiedenen Volksgruppen unter der Knute der Sowjetmacht nicht ständig nur die Sonne scheint und jeder jeden nur küßt, wie die alten Herren im ZK.
Als unserem Schiff dann aber über Nacht noch an die schwarze Bordwand mit weißer Ölfarbe ein Hakenkreuz gepinselt ward, verstehe ich das allerdings nicht.
![]() Kümo KOSEROW, ein wilder Höllenritt
Kümo KOSEROW, ein wilder Höllenritt
Am 10. Januar hat uns die Heimat wieder. Ich habe Weihnachten und Jahreswechsel wieder seemannsüblich über die Runden gebracht. Jetzt habe ich fünf Tage frei. Zwei davon verbraucht allerdings die Reichsbahn mit ihren Fahrplanverspätungen.
Ich wohne bei Mutter'n.
Am 15. Januar 1962 habe ich mich in Wismar auf dem Kümo KOSEROW einzufinden, besagt das handschriftliche Telegramm, daß mir per Fahrrad und ziemlich aufgeregt Frau Hanckel, die Postfrau meines Heimatdörfchens nach Hause bringt.
Dieses Küstenmotorschiff soll Kapitän Düerkop und mich mit nach Antwerpen nehmen. Ich bekomme nun ein "eigenes" Schiff, den Bananenjäger MS JOHN BRINCKMAN.
Aber der Weg dorthin ist beschwerlich oder besser gesagt lebensgefährlich.
Die Politökonomen der DDR und die Landeier der Reederei hatten inzwischen beschlossen, die anfallenden Kanalgebühren für eine Passage des Kiel-Kanals dem Klassenfeind in Gestalt der Bonner Ultras nicht mehr in den gierigen Rachen zu werfen.
Ab diesem Beschluß wird generell durch Sund oder Belt um Skagen gefahren!
Dieser Anordnung hat auch Kapitän Grosser mit seinem kleinen 500-Tonner, dem Küstenmotorschiff MS KOSEROW nachzukommen.
Kapitän Düerkop schläft beim Chiefmate, ich beim Kapitän auf der Backskiste.
Wir beiden haben es eilig, uns drückt der Übernahmetermin in Antwerpen.
Ab Skagen empfängt uns die winterliche Nordsee mit einer Mordsbrise.
Der Sturm bereitet die Nordsee auf, um drei Wochen später Hamburg zu überfluten.
Es ist unverantwortlich, einen 500er Kümo in dieses Chaos hineinzuschicken. Das Schiff kämpft sechs Tage gegen diese Urgewalten und wird arg gezaust. Der Schiffszaun und der beigelaschte Landgang sind zertrümmert, die Außenhaut hat Dellen. Der Kümo hat alle Außenschotten verriegelt und verrammelt und Panzerblenden vor den Bulleye's. Die im Brückenfenster eingelassene Klarsichtscheibe rotiert im Dauerbetrieb, um durch die Zentrifugalkraft das ständig überkommende Seewasser wegzuschleudern und eine Durchsicht zu ermöglichen. Ein paar Kabellängen freigucken kann sich die Brückenwache aber ohnehin nur, wenn das Schiff für zwei, drei Sekunden von der See auf einen Wellenberg gehievt wird. Unten im Tal schaut man nur auf das Gebirge rundherum.
Nach sechs Tagen wird voraus ein Feuer ausgemacht. Die Nautiker klammern sich mit einer Hand auf der Brückennock fest, mit der anderen bedienen sie die Stopuhr, um die Blitzgruppe festzustellen. Borkum, Texel oder Terschelling, einer der drei Leuchttürme muß es sein.
Es ist Texel.
Das Schiff kämpfte auf den lumpigen paar Seemeilen von Wismar nach Gent volle acht Tage.
Ich wünsche den Politökonomen für so eine menschenverachtende Segelanweisung noch nachträglich, statt der Einweisung in die Hölle, den immerwährenden Dienst auf MS KOSEROW zu den gleichen Bedingungen. Nur das Schiff hätte das nicht verdient!
![]() Die BH's retten die Situation
Die BH's retten die Situation
In der Mercantile-Werft Antwerpen liegen "Djoliba" und "Dubreka". Genietete Schiffe, Jahrgang 1942. Die von den Franzosen angekaufte Gebrauchttonnage ist schon sehr gebraucht. Die ersten Seeleute, die in Antwerpen dieses Schiff betreten, reißen die Hände hoch und fragen sich, welches Landei solche Rostfeilen kaufen durfte.
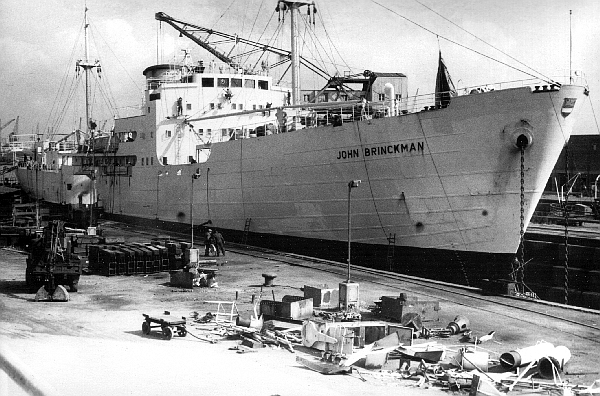 Einer versackt in dem morschen Deck, ein zweiter bricht mit der Schulter beim Anlehnen
Einer versackt in dem morschen Deck, ein zweiter bricht mit der Schulter beim Anlehnen
in ein Lüfterrohr ein. Der erhebliche Rostfraß war vom Verkäufer mit Heftpflaster und Farbe kaschiert worden. Die belgischen Werker verstehen ihr Handwerk und machen aus den beiden alten Schlorren schnucklige Schiffchen. Allerdings fällt ihnen für zwei Wochen spontan der Hammer aus der Hand, als eine Ratenzahlung für diese teuren Umbauten nicht termingerecht erfolgt. Wir erfreuen uns indes der himmlischen Ruhe auf dem Schiff und essen Pommes frites mit Muscheln, belgisches national-fast-food. Dann läuft MS THEODOR KÖRNER ein und löscht eine Ladung Büstenhalter, made in GDR.
Die Werft bekommt den Erlös für den BH-Verkauf und hämmert wieder hurtig weiter.
Mit diesen beiden aufgemotzten Schiffen steigt die Deutsche Seereederei nun in die Fruchtfahrt ein. Aus der "Djoliba" wird MS FRITZ REUTER, aus der "Dubreka" wird MS JOHN BRINCKMAN. Auf diesem Schiff darf ich als Pionier der ersten Stunde mit dabei sein.
![]() Der 12. Februar 1962
Der 12. Februar 1962
Am 12. Februar 1962 verlassen wir die Werft in Belgien zur Ausrüstung und Komplettierung der Innenausstattung in Rostock. Diesen 12. Februar habe ich heute noch im Kopf, u.a. hat es in diesen Nächten 1945 Dresden in Schutt und Asche gelegt und ich sah von Ferne den hellen Himmel über den Flammen. An dem heutigen 12. Februar bietet mir mit MS JOHN BRINCKMAN meine Reederei auf dem Weg nach Rostock wiederum eine Nordseedurchquerung an. Der Heimweg führt natürlich wieder um Skagen.
Nunmehr hat sich die Nordsee bei wochenlangen Windstärken zwischen 10 und 13 soweit aufgeschaukelt, daß sie durch die gerade über Hamburg hereinbrechende Sturmflut wohl noch lange von sich Rede machen wird. Jeder Kapitän packt sich mit seinem Schiff an geschützter Stelle vor den Haken oder bleibt gleich im Hafen. Die Schiffe der Deutschen Seereederei allerdings gönnen sich auch bei Windstärke 13 den Ritt quer durch die seit Wochen hochgetürmten Wellenberge und meiden den Kiel-Kanal.
Während der Überfahrt kommt entsprechend Freude auf.
Die Innenausrüstung soll erst in Rostock komplettiert werden. Das hat wenigstens den Vorteil, daß nicht so viel gelascht werden muß. Dennoch fliegt genügend durch die Räumlichkeiten. Das Schiff ist ohne Ladung, Treibstoff und Ausrüstung federleicht, es nimmt jeden Wellenberg gekonnt mit, um danach in jedes Wellental hinabzurauschen. Wir alle üben noch mit unserer Neuerwerbung.
"Um Himmelswillen, was habe ich mir denn da angelacht" sind meine ersten Eindrücke.
Mein alter Studienkollege Eckhard Kühl kommt mir entgegen. Wir haben in Antwerpen heftig Wiedersehen gefeiert. Er übernahm die "Djoliba", die früher fertig wurde und kommt mit der umgetauften FRITZ REUTER jetzt voll ausgerüstet der JOHN BRINCKMAN in diesem Nordsee-Chaos entgegen.
Wir telefonieren miteinander. Obwohl Ecki, im Gegensatz zu mir, einen vernünftigen Drehstuhl nun in seinem neuen Funkraum zu stehen hat, fliegt er beim Telefonieren als erster von seinem Hocker. Es knackt nur kurz auf der Welle, dann ist Funkstille.
Dann knackt es wieder: "Felix, bist du noch da? Mich hat's eben ausgehoben! Jumpt euer
Schlorren auch so? Over!"
Unsere Schiffe legen sich in 9 Sekunden gelegentlich bis zu 48 Grad auf die Seite.
Leuten, die sich vorwiegend nur zwischen senkrechten Wänden bewegen, möchte ich diesen Zustand so verdeutlichen: Bei einer Schlagseite von 48 Grad, würde man 3 Grad gut machen, wenn man sich statt auf dem Fußboden, auf der derart aus der Flucht gebeugten Seitenwand fortbewegen würde. Da aber schon nach ca. 9 Sekunden nur die gegenüberliegende Seite sich dafür anbietet, bietet dennoch der Fußboden die bessere Existenzgrundlage.
"Da hab ich mir ja eine Feile angelacht", fluche ich vor mich hin.
Damit beleidige ich das Schiff aber und entschuldige mich später. Der Bananenjäger schlägt sich tapfer in der See und schließlich gewöhnen wir uns so aneinander, daß mich die Reederei nach sechseinhalb Jahren gewaltsam von Bord zerren muß!
Mit den Max und Moritz-Streichen dieser ganz besonderen Sorte Seefahrt möchte ich Sie auf den nächsten Seiten evt. zum Schmunzeln bringen. Ich danke Ihnen im voraus, daß sie weiterlesen.
![]() Die Revolutionäre Volksrepublik Guinea
Die Revolutionäre Volksrepublik Guinea
Das Hauptjagdgebiet, in dem die beiden Fruchtschiffe nun Bananen aufstöbern sollen, ist die Republik Guinea, an der westafrikanischen Küste mit der Hauptstadt Conakry, 9 Grad über dem Äquator gelegen.
Kein Mensch holt dort eigentlich Bananen. In Mittel- und Südamerika, auf den Plantagen der United Fruit Co. wachsen viel mehr und viel schönere. Die heißen Dole oder Chiquita, aber sie kosten wertvolle Valuta.
Die paar Tönnchen Bananen, die wir in Guinea auftreiben, kosten faktisch nichts.
Die Früchtelieferungen vermindern nur geringfügig die Schulden, die die Republik Guinea bei der DDR ständig auflaufen läßt.
Am 28.Oktober 1958 klinkt sich die einst französische Kolonie aus dem französischen Commonwealth aus, bzw. die Republik Frankreich wünscht seiner ehemaligen Kolonie widerstandslos guten Weg.
In Guinea nennt man das Revolution.
Ahmad Sékou Touré ist nun Oberhaupt der "Revolutionären Volksrepublik Guinea". Diese Revolutionäre Volksrepublik erkennt nun als erstes Land Afrikas die Deutsche Demokratische Republik diplomatisch an. Erich Honecker fühlt sich nun ganz furchtbar auf den Bauch geklatscht und karrt außer einem Haufen Diplomaten zehn Tausende Tonnen Danksagungen nach Conakry. Und wir nun, um diese einleitenden Erläuterungen abzuschließen, holen dafür als Gegenleistung ab und zu ein paar Stauden Bananen ab. Dafür hat sich die Reederei die beiden Fruchtschiffe zugelegt. Ich fahre ab jetzt in sechseinhalb Jahren 46 Mal nach Conakry. Auf nicht einer dieser Reisen, ist das Schiff voll abgeladen. Das wäre mit ca. dreitausend Tonnen Bananen der Fall.
Bei einer Abladung mit über 1500 Tonnen, backen wir vor Freude schon Kuchen.
Auf geht's.
Nach Auslaufen Rostock haben wir die rauhen Witterungsverhältnisse mit Südkurs durch die Nordsee, den englischen Kanal und die Biscaya auf Höhe Gibraltar generell überstanden. Unser Kurs hält auf die Kanarischen Inseln zu, vorbei an Gran Canaria. Bei besonders schönem Wetter und einem besonders gut gelaunten Kapitän Düerkop führt der Kurs auch gelegentlich an Tenerife vorbei. Dann sieht die Besatzung nicht nur den Schiffsschornstein, sonder auch den Pico de Teide rauchen. Das ist der Chefberg der Kanaren. Hier weht zwar äquatorwärts der Passat, aber der ist erträglich und schiebt von achtern.
Nach dem Passatgürtel herrscht Stille.
In dem ruhigen Wasser treiben Sepia-Schalen, von Tintenfischen abgeworfene Kalkrucksäcke. Blau-bunte Segelquallen ziehen lange Nesselfäden hinter sich.
Gelegentlich schwimmt ein Hammerhai dicht unter der bleiernen Wasseroberfläche.
Nach neun Tagen erreicht das Schiff mit 16 Knoten Fahrt Conakry. Die Ansteuerung bietet keine Probleme. Der Hafen ist offen, es ist ja ständig schönes Wetter.
Ein paar Kabellängen vor den Piers werfen wir den Haken in den Grund, setzen das Flaggensignal "Lotse erwünscht" oder tuten eben hektisch herum. Funkverbindung zu den Hafenbehörden existiert nicht. Das Verzeichnis der Küstenfunkstellen führt zwar eine Küstenfunkstelle "Conakry Radio", weist auch ständig korrigiert deren Wachzeiten und Frequenzen aus, aber auf 46 Reisen in diese Gegend, habe ich diesen Sender nicht ein einziges Mal piepsen gehört.
Alle Telegramme nach Conakry schicke ich über die Küstenfunkstelle "Dakar Radio" im Senegal oder Abidjan in Elfenbeinküste. Die beiden Länder hatten bisher noch keine Revolution.
Wir liegen auf Reede und schauen mit dem Fernglas hinüber zur Bananenpier und den angrenzenden Fruchtschuppen. Wenn man zwischen den Stützen im Schuppen hindurch sehen kann, ist er leer. Das ist die Standardsituation, zugestaute Stützen sind der Sonderfall.
![]() Captain, no 'bakschisch'?
Captain, no 'bakschisch'?
Nach "Fall Anker Reede Conakry" kommt ziemlich schnell Besuch zum Schiff herüber, aber nur um nachzuschauen, was der Kapitän so für Präsente mitgebracht hat. Die Größe, der vorab verteilten Kontaktgeschenke, bestimmt dann ganz erheblich den weiteren Gang der Dinge.
Gerade in diesem Punkt haben die Kapitäne unüberwindliche Schwierigkeiten, den Landeiern der Reederei klarzumachen, daß mit einer Kiste Whiskey, für zwar fünfzig Mark wertvolle Valuta, die Hafendurchlaufzeit sehr oft um Tage verkürzt werden könnte.
Das ginge nach Reederei-Auffassung aber nur, wenn der damit Bestochene bzw. Beschenkte eine notariell beglaubigte Empfangsbestätigung beibringt. Besser noch, sie würde vom Botschafter der DDR gegengezeichnet. Wird dem Reeder diese Bescheinigung nicht vorgelegt, bestünde ja die Möglichkeit, daß der Kapitän vorgibt, sechs Flaschen Whiskey zum Wohl der Volkswirtschaft ausgegeben zu haben und davon aber eine für sein eigenes Wohl behält. Diese verbohrte Engärschigkeit kostet dem DDR-Außenhandel eine Menge Millionen wertvolle Valuta.
Andere Reedereien schmieren in jedem Hafen auf Teufel-komm-raus, jeden, der für die schnelle Abfertigung ihres Schiffes auch nur die Bohne eines Einflusses hat. Das kostet nicht unbedingt Unsummen, erspart aber unter Umständen die Ausgabe solcher Beträge.
Kurz eingeflochten,
ein Beispiel für die geschilderte Engstirnigkeit der Deutschen Seereederei: Ein Typ-IV-Schiff, wie die vorher abgehandelte DRESDEN macht sich für die Suez-Kanal-Passage fertig. Demzufolge stehen dem Kapitän im Hafen von Port Said Behördenbesuche ins Haus. Die Besucher kommen nicht mit leeren Händen, aber mit leeren Taschen in diesen. Die Taschen schlenkerten aber immer noch leer und luftig, als die Officers die Gangway wieder hinabsteigen.
Der Kapitän ist ein ganz redlicher. Er vergattert vor Port Said seine Besatzung: "Keiner verbirgt irgendwelche Konterbande, alle Listen und Papiere werden absolut korrekt ausgefertigt. Sollen die uns doch filzen, wir sind sauber. Von uns kriegen die kein Bakschisch!" Ein Muster an Korrektheit passiert den Suez und hat der Reederei noch dazu mindestens 80 Mark Unkosten für Geschenke eingespart.
Arabische Gastfreundschaft wurde mir immer so nahegebracht, daß der Gast dem Gastgeber auch ordentlich etwas mitbringt.
In Suez, am anderen Ende des Kanals, kommen die ausklarierenden Kollegen der einklarierenden von Port Said an Bord. Das schlechte Benehmen dieses engärschigen Schiffskapitäns ist diesen ganz gewiß zu Ohren gekommen.
Dennoch kontrollieren die Suez-Leute auf dem Schiff so gut wie gar nichts. Eigentlich nur die Plombe, mit der die Kollegen in Port Said die Transitlast gewissenhaft versiegelten.
Diese Plombe aber ist zerfetzt!
Das Schiff wird aus dem Konvoi genommen, kommt so lange an die Pfähle, bis die Tausende Dollar Strafe für das Zollvergehen beglichen sind.
No comment!
![]() Zurück nach Conakry
Zurück nach Conakry
Der Anker ist gefallen, gleich an die Pier geht das Schiff selten. Jetzt schaut auf Reede Monsieur Macouli mit Gefolge beim Kapitän vorbei. Seine Tasche trägt ein Diener. Monsier Macouli kann kein waschechter Moslem sein. Er trinkt ganz gern ein Gläschen Hochprozentiges und verehrt Schweinespeck.
Es ist ihm stets gegönnt.
 Kapitän Düerkop ist nicht geizig und ein sehr umgänglicher Mensch. Er läßt nichts unversucht, absolut alle Bananen, die sich aufstöbern lassen, auch in sein Schiff zu bekommen.
Kapitän Düerkop ist nicht geizig und ein sehr umgänglicher Mensch. Er läßt nichts unversucht, absolut alle Bananen, die sich aufstöbern lassen, auch in sein Schiff zu bekommen.
Wir gehen an die Pier.
Wenn elektrischer Strom und Bananen vorrätig sind, wird unser Schiff mit landseitiger Technik per Elevatoren beladen. Guinea erzeugt seinen Strom mit Wasserkraft, das flutscht während der Regenzeit reibungslos. In der Trockenperiode erschöpft sich aber schnell der Wasservorrat im Staubecken, dann tröpfelt es nur auf die Schaufelräder der Turbinen. Die Generatoren und der Strom werden dann abgestellt.
In dieser Zeit läuft aus dem Bächlein das Staubecken wieder voll. Dann gibt es wieder für eine Weile Strom.
Just in der Zeit eines solchen Energieengpasses läuft in einem der beiden Kinos der guinesischen Hauptstadt der historische Monumentalfilm "Ben Hur". Wir gönnen uns das Werk. Es ist der teuerste Film der Welt.
(In unserem Bordkino ist DEFA-mäßig gerade "Florian von der Mühle" der große Held.)
An Land tritt nun um 20.00 Uhr "Ben Hur" auf und erst nach früh um 04.30 Uhr wieder ab. Der Strom war dauernd alle.
Wenn mangels Elektrizität die Elevatoren nicht einsetzbar sind, wird mit schiffseigenem Geschirr geladen. Die Stauden werden dann an der Pier in eine Netzbrook gepackt und mit dem eigenen Ladegeschirr in die vorgekühlten Laderäume gehievt.
Die bauliche Spezialität eines Fruchtschiffes sind seitlich in die Bordwand eingebaute Ladepforten, das sind dicke, ebenfalls isolierte Kühlschranktüren. Durch diese kurz über der Pier liegenden Lukenzutritte kann über Rollenbänder oder auf den Schultern der Hafenarbeiter gleichfalls das Schiff beladen werden. Wenn gelegentlich in allen Laderäumen Betriebsamkeit aufkommt, werde ich auch zur Lukenwache eingeteilt. Ansonsten erledigen den Job die nautischen Offiziere.
Lukenwache ist wichtig.
Wir holen hier Bananen nicht in Kisten, sondern als im ganzen belassene Stauden. Diese sind in Packpapier und Reisstroh eingeschlagen.
Wenn einem unbeaufsichtigten Kollegen Neger in der Luke beim Stauen der Bananen die Notdurft befällt, dann muß der lukenaufsehende Offizier schon einen ganz strengen Blick aufziehen, damit der Bedrängte die hohen Eisenleitern bis an Deck hinaufsteigt. Aber zur Entdiskriminierung dieser Männer füge ich gleich dazu, Rostocker Hafenarbeiter haben auch gelegentlich den Drang, ihr Bier wieder abzulassen, ohne die immer noch so hohen Leitern überwinden zu müssen. Auch kann dort nicht jeder Raucher seinen Jieper zügeln.
![]() Benti, die Perle Westafrikas
Benti, die Perle Westafrikas
Wir laden in Conakry ein paar hundert Tonnen, seltener auch einmal über tausend. Mit etwas Glück hat aber unser Ablader noch ein paar Tönnchen in Hinterhand liegen, nämlich in dem landschaftlich sehr schön gelegenen Benti.
Der Lotse für Benti ist Monsieur Camara. Er ist kein Lotse mit Kapitänspatent und 25 jähriger Großschifferfahrung. Er sammelte seine seemännischen Erfahrungen auf flachgehenden Booten auf dem Fluß, wo er die Bananen von den ehemaligen französischen Pflanzungen zum "Hafen" von Benti karrte.
Irgendeine Ausbildung hat er nicht, aber eine Frau mit Kindern in Conakry und eine Frau mit Kindern in Benti postiert.
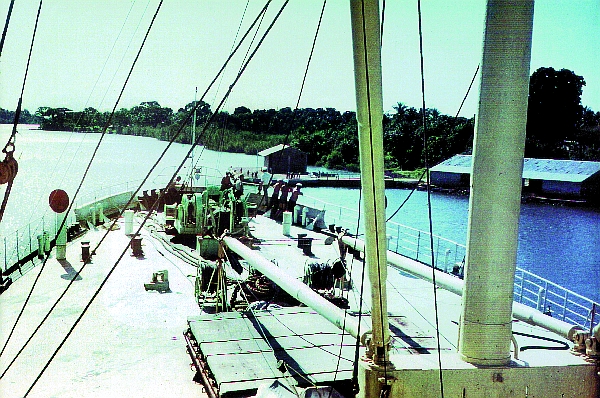 Vorerst besteigt er aber unser Schiff.
Vorerst besteigt er aber unser Schiff.
Der seltene Besucher, der nach Benti möchte, muß das ausschließlich mit dem Schiff vornehmen. Dort hin führt keine Straße.
Von Conakry aus fährt das Schiff etwa 50 Seemeilen nach Süden. Vor der Grenze zu Sierra Leone und der Man-groven-Küste dümpelt eine schwarze Ansteuerungstonne in ziemlich flachem Wasser. Man benötigt ein gutes Fernglas. Auf zweihundert Meter Breite wachsen dort keine Mangroven am Ufer. Dort mündet der Melacoré, einer der riesigen afrikanischen Flüsse, die dennoch keiner kennt. Monsieur Camara kennt den Fluß.
Er kurvt mit unseren 4 800 BRT recht selbstbewußt und souverän den gewundenen Melacoré zu Berg nach Benti.
Mit unserem Dickschiff kann man Benti nur bei absolutem Hochwasser erreichen.
Sonst fährt man auf Dreck. Wenn das Schiff angekommen ist, muß es mit seinen 114 Metern Länge auf dem Fluß auslaufgerecht gedreht werden. Schlepper, wie in den ruhigen Gewässern richtiger Häfen, sind natürlich nicht verfügbar. Das Dreh- und Anlegemanöver wird zu einem atemberaubenden Ereignis, wenn die Ebbe einsetzt und der dann reißende Melacoré alles daran setzt, das Schiff wieder dem Seewasser zuzuführen. Es hat immer geklappt und Monsieur Camara hat sein kleines Geschenk jedes Mal redlich verdient.
An der Pier winkt seine zweite Familie.
Jetzt steigt er wieder um.
Die Pier ist viel zu kurz, um die gesamte Längsseite des Schiffes aufzunehmen. Sie reicht gerade für die Beherbergung eines kleinen Bananenschuppens und die herbeigeeilten Dorfbewohner. Die Vor- und Achterleinen des Schiffes werden unter Palmen an einbetonierten Pollern zwischen den Mangroven belegt.
Dieses Dorf am Fluß ist eine Attraktion, aber man muß es mögen und damit umgehen können.
Den Ort bildet ein lockerer Hüttenverband. Die Behausungen sind weitläufig in der üppigen Botanik verstreut, aber einigermaßen durch Wege und Pfade miteinander verbunden. Diese Infrastruktur ist die Voraussetzung zum herrlichen Herumströpen im Busch. Ansonsten ist da ja kein hineinkommen.
 Ich ströpe doch so gerne und zahle an verkappte Brenn- und andere Nesseln, hintertückische Insekten und andere Hinterhältigkeiten der unbekannten Natur auf meinen ersten Exkursionen auch mein Lehrgeld.
Ich ströpe doch so gerne und zahle an verkappte Brenn- und andere Nesseln, hintertückische Insekten und andere Hinterhältigkeiten der unbekannten Natur auf meinen ersten Exkursionen auch mein Lehrgeld.
Drei französische Pflanzer halten vier Jahre nach der Revolution im tiefen Busch am Melacoré noch die Stellung. Für ihre abgelieferten Früchte schuldet ihnen der Staat auch seit dem das Entgeld in französischen Franc. Den Anteil an Franc guineé bekommen sie.
Diese drei französischen Musketiere sind Kumpel.
Wir pflegen zu ihnen guten Kontakt und freuen uns gegenseitig jedes Mal beim Wiedersehen. Was nun in letzter Zeit auf ihren im Busch verstreuten Plantagen heranwuchs, wollen wir ihnen heute gerne abnehmen. Meistens ist es aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, obwohl die drei Pflanzer ihr Möglichstes tun und die Schar ihrer schwarzen Helfer ebenso.
 Vier Schiffsluken mit einem Fassungsvermögen von dreitausend Mal zwanzig Zentnern sind aber auch unersättlich.
Vier Schiffsluken mit einem Fassungsvermögen von dreitausend Mal zwanzig Zentnern sind aber auch unersättlich.
Den Küstenstrich Guineas bevölkert zum größten Teil der Stamm der Susu, vermischt mit einigen Malenké. Guinea hat 27 Hauptstämme und noch mehrere ethnische Untergruppierungen.
Ich mag die Susu, Malenké und Foula hier in der freien Natur. Sie sind offen, ehrlich, naturbelassen und sehr reinlich. Das trifft für die Hauptstädter in Conakry nicht mehr so ganz zu. Unterhalten kann ich mich ein wenig leider nur mit Männern oder Kindern. Die Männer lernten ihr französisch als Arbeitnehmer auf den Plantagen der Kolonialherren. Die Kinder der letzten Jahrgänge in der Schule.
Die Muttis aber lernten schon ab 13 Jahren nur das Kinderkriegen und das Amortisieren der Kosten, die ihr muslimischer Gatte für ihren Erwerb ins Geschäft stecken mußte.
Die Frauen sind ständig am ackern.
Der Meister schaut da schon gelegentlich nur in beratender Funktion von der Hängematte aus interessiert zu.
![]() Im Dorf ist Ball
Im Dorf ist Ball
Man könnte auch Dorftanz sagen. Aber wir werden zum "Ball" eingeladen. Die Tam-Tam's sind unüberhörbar. Es ist nicht weit, nur die bauxit-rote 'main-road' das Flußufer hinauf und ein Stück durchs Gebüsch.
Es ist wie immer ein schöner lauer Abend, so um die dreißig Grad.
Die Grillen und die Ochsenfrösche sind auch zugange.
Wir nehmen einen gekühlten Kasten Bier mit hinauf und andere Drinks. Nicht einen davon werden wir los, obwohl wir gerne mit den freundlichen Veranstaltern teilen möchten. Es ist eine 'open air'-Veranstaltung, was sonst.
Wir bekommen sogleich ein Brett als Sitzgelegenheit aufgestellt und schauen dem Treiben zu. Die Susu-Mädchen haben ein unwahrscheinliches Rhythmus-Gefühl und legen sagenhafte Stakkatos auf dem Lehmboden des Dorfplatzes hin.
Ein Mädchen bringt uns in einer Blechbüchse Wasser. Ich kenne die Herkunft. In dem zwar sauberen Wasser des Tümpels habe ich schon oft die bunten Fischchen, die Kaulquappen und die bizarren Wasserpflanzen bewundert. Uns europäischen Weichwürsten bekommt ein solches Trinkwasser überhaupt nicht. Aber auch der Afrikaner holt sich hier seine Bilarziose, die Elefantiasis oder den Medina-Wurm.
Wir haben ja Bier mitgebracht.
Jetzt kommt das schlanke, kerzengerade Mädchen und verteilt Erdnüsse.
Der Dorfälteste mit dem roten Fez mit Bommel und dem schneeweißen Nachthemd hat ihr das befohlen.
Jedem von uns schüttet sie die hohlen Hände bündig voll.
Wir bekommen auf dem Schiff jede Reise die gesundheitserhaltenden Verhaltensregeln eingehämmert: "Im Süßwasser lauert der Ursprung allen Übels. Das ist in dieser Gegend nicht einmal zum darin baden geeignet! Früchte unbedingt abschälen! Hände waschen, möglichst pausenlos!"
Die an uns verteilten Erdnüsse sind geschält, aber sie umhüllt noch das dünne braune Häutchen. Das akzeptieren wir ersatzweise als Schale.
Schließlich können wir die vom Herzen kommende Gastfreundschaft doch nicht ständig mit Füßen treten.
Ich kenne die Verhältnisse der Dorfbewohner, die schwelgen alle nicht im Überfluß. Wir pipsern also die dünnhäutige Schutzschicht von den Nüssen und beginnen den Verzehr.
Das Abpipsern muß dem Häuptling aufgefallen sein. Wahrscheinlich ißt er immer das dünne braune Häutchen mit, aber, um uns alles recht zu machen, schickt er das Mädchen wieder in die Spur. Sie sammelt alle unsere Nüsse wieder ein, rubbelt nebenan die gesamte Ladung zwischen ihren Händen und teilt nun auf's neue die blankgeputzten Nüsse wieder aus.
Die freilaufenden Zwerghühner haben am nächsten Tag ihre üblichen C-Eier bestimmt auf B-Größe hochgejubelt.
Auf dem Festplatz werden die vielfältigsten Rhythmusinstrumente und Teufelsgeigen strapaziert.
Die Mädels können auch glockenklar singen.
Ich habe sie vor zwei Reisen vor einem kleinen Tonbandgerät so weit gebracht, daß sie auch am hellen Tag, ohne Dorffest, losschmettern. Diese journalistisch ausgefeilte Reportage brachte mir beim Sender Rostock hundert Mark ein, d.h. achtzig, zwanzig Märker behielt die Steuer.
Aber heute abend dreschen Männer auf die Tam-Tam's. Tanzend schaffen sich eigentlich nur die Mädels. Sie tanzen barfuß und oben ohne. Bei den Dreizehn-, Vierzehnjährigen ist das sehr schön anzuschauen. Die Männer halten sich beim 'dancing' vornehm zurück.
Die Situation eskaliert, höchste Alarmstufe! Jetzt zerren ersatzweise die wilden Ischen uns von der Bank. Mein Wirbelwind trommelt vor mir auf dem Lehmboden und hüpft mit den elegantesten Sprüngen um mich herum, wie eine schlanke Gazelle um einen schlafenden Nilpferdbullen. Dabei pfeife ich auf dem letzten Loch, schließlich bewege ich auch ganz enorm rhythmisch alle verfügbaren Glieder. Bis auf eins. Ich zelebriere als Multi-Kulti-Beitrag eine nordische Variante des Schuhplattlers, oder so.
 Nach dieser Damenwahl schenkt mir Acjeta ihr Tuch, das sie um den Hals trug.
Nach dieser Damenwahl schenkt mir Acjeta ihr Tuch, das sie um den Hals trug.
Das will in Afrika schon etwas heißen. Sie begleitet mich auch durch den finsteren Busch zum Schiff. Barfuß und fast nackt. Angst vor Schlangen und Brennesseln hat sie nicht.
Die Leute sind Moslems. Dennoch gehen die Frauen oben ohne und schauen sogar einen Ungläubigen freundlich an.
Die Gegend hier ist Allah anscheinend aus dem Ruder gelaufen.
Am nächsten Abend macht der E-Mix für die Dorfbewohner Kino. Die FRITZ REUTER hat bereits nach ihrem ersten Anlaufen auf Benti mit weißer Kalkfarbe eine "Leinwand" an den Bananenschuppen an der Pier gepinselt. In Benti gibt es keinen Strom, kein Telefon, keine Wasser- oder Abwasserleitung.
Aber auch keinen herumliegenden Unrat oder Abfälle.
Der E-Mix stellt seine Kinomaschine an die Pier und holt Strom von Bord. Das Nachrichtensystem funktioniert besser als die Telecom. Nur wie, da bin ich nie dahinter gestiegen. Wenn der Film losgeht, sind jedenfalls alle da.
Heute werden "Die Hosen des Herrn Bredow" in deutsch und in Farbe vorgeführt und alle freuen sich ganz bärisch.
Beim nächsten Mal gibt es die "Petroleum-Miezen", da ist erst was los im afrikanischen Busch.
Ich suche in der großen schwarzen Einheitsmenge meine 'dancing-queen' vom gestrigen Ball. Als ich glaube, sie aufgespürt zu haben, schenke ich ihr einen großen Spiegel und Toilettenartikel. Sie nimmt das Zeug zwar, guckt mich aber ganz verdattert an. Da habe ich wohl die Falsche erwischt. Gleichmäßig braun gebrannt sind sie ja alle und in der Tropennacht erst recht.
![]() Matrose Matz "knaupelt" sich durch
Matrose Matz "knaupelt" sich durch
Die Ladung wird in Rostock gelöscht. Das sollte zu Beginn der noch jungfräulichen Bananenfahrt in Hamburg passieren, da in DDR-Häfen keine Elevatoren zur Entladung verfügbar sind. Es wurde das Löschen mit Kränen probiert und da das leidlich funktionierte, bleibt es dabei. Auch im strengen Winter. Bananen sind die Frostekatzen unter den Früchten.
Das Schiff ist gelöscht und klar zum Auslaufen.
Allerdings die Mannschaft ist nicht komplett. Matrose Matz fehlt. Der wohnt tief im Süden.
Er ist Angehöriger eines kleinen sächsischen Bergvolkes und wohnt in den bergigen Gegenden, die für Kartoffelanbau zu hoch, aber für Edelweiße zu niedrig sind.
Nach Stunden trudelt er ein.
Der Alte faltet ihn väterlich zusammen. Matz verteidigt sich: "Wenn sie wissden, wie ich mich bis hier hinn iiberhaubd durchgemährt habbe!"
Außer Matz kämpfte auch die Reichsbahn, gegen einen der vier Hauptfeinde des Sozialismus: gegen den Winter! Der Fahrplan ist längst außer Kraft gesetzt, da erreicht mit Stunden Verspätung der D-Zug und Matrose Matz den Bahnhof Ludwigslust. Bis hierher und nicht weiter, verkündet dort im Cockpit der riesigen Dampflok der Baureihe 01 die Besatzung. Lokführer und Heizer sind anscheinend von der Schlacht an der Winterfront so ausgemergelt und übermüdet, daß sie nicht mehr weiter können.
Der D-Zug steht vor sich hin.
Einen Lokführer hat die Bahn jetzt irgendwie aufgetrieben.
Nun sucht der Bahnhofslautsprecher zwei kräftige junge Männer unter den Fahrgästen, die der Lok so viel Dampf an die Hacken machen können, daß der Zug auch mal Rostock erreicht.
Matrose Matz ist als erster vorn auf der Lok.
Es meldet sich noch ein Fahrgast zum Schaufeln. "Einsteigen und Türen schließen!"
Jetzt geht es weiter.
"Immer wenn der Lokführer es sagte, hauten wir beiden Aushilfsheizer kräftig Kohlen in das Feuerloch. Die Lok ging ab wie eine V-1. So habe ich mich persönlich bis hier hin 'durchgeknaupelt'", erklärt der Matrose seinem schmunzelnden Kapitän.
Die Arbeitskombi, die ihm die Reichsbahn zum Schaufeln bereitstellte, trägt er während seiner Entschuldigung immer noch unter seiner Winterjacke.
![]() Schweinchen ist der Pfiffigste
Schweinchen ist der Pfiffigste
Unser alter Bootsmann, Walter Stark, setzt urlaubsmäßig eine Reise aus. Bestmann "Schweinchen" vertritt ihn derweil. Die Bootsmannskammer, in die Schweinchen jetzt umziehen müßte, liegt an backbord auf dem Hauptdeck.
Aber Schweinchen mag für eine Reise mit seinen Plünnen nicht umziehen, er bleibt unter Deck in seiner Kammer im Matrosengang wohnen. Die Kammer neben ihm bewohnt Decksmann Udo. Udo ist FDJ-Sekretär und nicht gerade Schweinchens Intimus.
Die Decksgang übernimmt im Heimathafen Ausrüstung für die kommende Reise.
Bootsmann Schweinchen führt das Kommando.
Decksmann Udo ist an Land zur Abwicklung seiner gesellschaftlichen Tätigkeit.
Alles ist soweit unter Deck verstaut, nur noch eine armstarke Manilla (Festmacherleine) liegt aufgeschossen und verpackt noch an Deck.
Dieser Kolli wiegt eine Tonne.
 Um diese Last über den Niedergang im Kabelgat einzulagern, muß die Verpackung und die Verschnürung geöffnet werden. Dann postiert sich aller fünf Meter ein Mann und die Leine wird Hand über Hand dorthin befördert, wo sie wieder zum Coil aufgeschossen werden kann.
Um diese Last über den Niedergang im Kabelgat einzulagern, muß die Verpackung und die Verschnürung geöffnet werden. Dann postiert sich aller fünf Meter ein Mann und die Leine wird Hand über Hand dorthin befördert, wo sie wieder zum Coil aufgeschossen werden kann.
So wie der Kleingärtner seinen Gartenschlauch händelt. Der Gärtner wickelt einen Schlauch auf, der Seemann 'schießt' ihn auf.
"Los", kommandiert Schweinchen, "wir schießen Udo die Leine in die Kemenate!
Du, du und du, ihr macht euch bei Udo in die Kammer. Schraubt das Bulleye auf und nehmt uns von oben die Leine ab. Wir stecken oben nach, ihr schießt vor seiner Koje auf! Dann hat er zwanzig Zentner Leine in seiner Buchte liegen und wenn er keinen ordentlichen ausgibt, die ganze Reise lang!"
Aus einem Bulleye unter der Bande der Hinterlistigen reckt sich ein Arm aus der Bordwand: "Hei geit, kann losgehen!"
Das dicke Tauende wird dem gereckten Arm zugeführt und innenbords gezogen.
Die Arbeit geht locker von der Hand, man möchte ja auch nicht vom Wachoffizier erwischt werden.
Abends, lange nach Feierabend, dröhnt es unter Deck im Matrosengang. "Ihr Arschlöcher, ihr verfluchten!" Bootsmann Schweinchen drückt seine Kammertür auf und hat Mühe, seinen rundlichen Bauch durch den Türspalt zu zwängen.
Der ganze Colli der neuen Nylonleine beansprucht den gesamten Freiraum in seinem Apartment.
Matrose Matz ist Judoka und dallert einschlägig bei jeder Gelegenheit auf dem Schiff herum. Bei dem schönen warmen Wetter in den Roßbreiten weiht er Maschinen-Assi "Düse" in seine Geheimnisse ein. Erste Lektion, bei der es dann auch bleibt: Schulterwurf.
Düse, des gekonnten Fallens noch unkundig, landet mit einer verunglückten Fallschirmrolle unsanft auf den hölzernen Lukendeckeln. Sein Schlüsselbein ist 'out of order'.
Jimmy Radke, ist der 'Second' und damit der Schiffs-Doc. Er bastelt Düse um sein lädiertes Schlüsselbein nun einen Rucksackverband. Fiete Beus, unser korpulenter Chief, ist davon nicht so erbaut. Die Planstellung Schonplatz hat er in seinem Ressort nicht vorgesehen, er braucht Leute die zupacken können.
![]() Die Insel Kassa, unser Naherholungsgebiet
Die Insel Kassa, unser Naherholungsgebiet
Wir landen wieder in Conakry an, wo sonst!
Monsieur Macouli schaut vorbei und meint, wir sollten uns auf Reede in Geduld üben.
Schweinchen fiert die Barkasse weg. Wir machen einen Ausflug nach Kassa.
Kassa ist eine Insel gegenüber dem Hafen. Man muß aber ein paar Seemeilen tuckern. Wenn man nochmals ein paar Meilen drauflegt, erreicht man die Insel Roum.
Auf Kassa wohnen ein paar Fischer, auf Roum nur ein paar Ziegen. Idyllische Inselparadiese zum herumströpen. Ich ströpe doch so gerne.
Kassa hat einen schönen breiten Sandstrand und auch krumme Palmen, wie bei TUI. Der Strand ist menschenleer.
Hinter dem Strand allerdings ist dichter Busch. Bei meinem ersten Besuch auf Kassa wurden wir beraubt. Das war herb.
Während wir im und am Wasser umher dallerten, brach eine Affenherde aus dem Grünzeug und klaute unsere weiter oben im Schatten abgelegten Klamotten.
Später, als Insider und Fast-Ehrenbürger Guineas, bin ich der Überzeugung, daß diese Primaten der Gattung Meerkatzen, den Inselbewohnern unsere Klamotten zutrugen.
Also passen wir heute auf und lassen unsere Habe im Boot.
"Matzi" sage ich zu unserem Judo-Ass, "hier ist schöner weicher Sand. Wie geht denn das mit deinem Schulter-hebe-eier-fassi-saki?"
 Matz hebt mich aus und läßt mich mittelsanft in den Strandsand fallen, während er seine Unternehmungen allen umstehenden Interessenten erläutert.
Matz hebt mich aus und läßt mich mittelsanft in den Strandsand fallen, während er seine Unternehmungen allen umstehenden Interessenten erläutert.
"Jetzt du!"
Ich hebe Matz aus und lasse ihn mittelsanft in den Strandsand fallen, ohne zu erläutern.
Er rappelt sich mittelschnell hoch und hält seine Schulter. Das Schlüsselbein ist hin.
An Bord verbietet jetzt der Alte alle weiteren derartige sportliche Aktivitäten!
![]() Die Klippen der Antillen und die "Teutsche Post"
Die Klippen der Antillen und die "Teutsche Post"
Wir liegen in Conakry in der Sonne und vor uns hin.
Ich höre nachts im Blindfunk bei Rügen Radio rein.
Aus keinem Hafen der Welt darf ein Schiff senden. So vereinbart man vor dem Einlaufen mit der Heimatfunkstelle eine Zeit und Frequenz und bekommt die vorliegenden Nachrichten per Telegrafie "blind" zugestellt. Ob erhalten oder nicht, bestätige ich nach dem Verlassen des Hafens.
Delta-Charlie-Zulu-Delta ist mein Rufzeichen. Rügen Radio hat mich auf der Liste.
Ich traue meinen Ohren nicht:
wegen extremer eissituation entloeschung rostock nicht moeglich stop keine ladung uebernehmen stop schiff versegelt for order nach cuba stop benoetigte ausruestung und verproviantierung in dakar vorgesehen - seerederei befrachtung
"Felix Flegel" sagt Kapitän Düerkop "und du hast dich nicht verhört?"
Auf MS JOHN BRINCKMAN bricht Hektik aus. "Klar vorn und achtern. Maschine klar. Zimmermann auf die Back. Hiev Anker. Wasser an die Ankerklüse. Gefechtsrudergänger auf die Brücke!"
Wir brechen auf. Vorerst nach Dakar im Senegal. In Conakry gibt's doch nischt. Der Senegal aber hatte noch keine Revolution. Wir brauchen für die uneingeplante Reiseverlängerung Bunker, Wasser, Getränke und Proviant und vor allem Seekarten und Navigationsunterlagen. Kein Schwanz auf dem Schiff war bisher in der noch jungen Volksrepublik Kuba.
Die uneingeplante Ausrüstung des Schiffes kostet wieder wertvolle Valuta!
Es folgen genaue Anweisungen, wie viele Büchsen Coca Cola und Becks-Bier pro Mann und Tag gebunkert und ausgegeben werden dürfen. Die Broiler, die der Koch einlagert, sind gritze-blau. Mit Schweinefleisch sieht es bei den Muselmanen auch mau aus. Hammel wäre ausreichend im Angebot, wollen wir? Nee bloß nicht! Na usw.
Aber Obst und Gemüse ist schwer in Ordnung.
Wir kaufen an Land Schnitzereien, Speere, Felle und anderen Buschiganga.
Schließlich haben die Nautiker auch ihre notwendigen Seekarten zusammen. Zwar nicht die gewohnten SHD oder DHI-Exemplare, sondern ziemlich bunte Dinger von irgend wo anders.
Seehandbücher sind nur in französischer Sprache verfügbar.
Wir fahren in dem herrlich ruhigen Seegebiet der Roßbreiten mit Westkurs nach Kuba. Der Kapitän tüftelt sich einen Kurs aus, auf dem er gedenkt, zwischen den Antilleninseln in die Karibik einzudringen. Er kreuzt dann in dem französischen Text des Seehandbuches die Stellen an, die ihm das dafür nötige Wissen vermitteln sollen. Alfred Zimdarß, der Chiefmate und ich schaffen uns an der deutschen Übersetzung. Das ist schwierig, denn für das seemännische Fachchinesisch bzw. Französisch taugen unsere Wörterbücher nichts.
Der Kapitän macht auch mit, wir zaubern alles Notwendige zusammen.
Ich erhielt nach meiner Ausbildung an der Seefahrtschule das Seefunkzeugnis II. Klasse. Die oberste Sprosse der Karriereleiter meines Gewerkes ist das Seefunkzeugnis I.Klasse. Benötigen würde man das nur als Funkstellenleiter auf einem Passenger. Auf den Frachtern der Reederei bringt das auf der Uniform drei Ärmelstreifen und, als das Wesentlichere, zwei Heuergruppen, also 100 Mark mehr.
Der Seefunk vollzieht sich unter der gestrengen Schirmherrschaft der Deutschen Post, Hauptabteilung Seefunk. Dort äußere ich den Wunsch, die letzte Sprosse meiner Karriereleiter erklimmen zu wollen. Die erforderliche Fahrzeit habe ich zusammen und ordentlich Ahnung habe ich mittlerweile ja auch.
Die Postler zeigen sich gewogen und vergeben mir sechs Themenkomplexe, an denen ich mich wissenschaftlich schaffen muß. So eine Art postgraduale Klausur-Arbeiten. Zwei Arbeiten sind fremdsprachlicher Natur. Englisch habe ich schon erfolgreich hinter mich gebracht, mit der Reisebeschreibung der Chinareise auf MS DRESDEN. Jetzt, wo ich mich an dem vertrackten französischen Seemannschinesisch der Seehandbücher aufreibe, kommt mir der Gedanke, daß mir diese Phänomenalleistung die Seefunkbehörde auch getrost als Fremdsprachen-Klausur abkaufen könnte.
Die gestrengen Beamten kaufen ab, verlangen aber die Abschrift des französischen Textes. Obwohl ich ihnen die französischen Originale mit angekreuzten Textpassagen schenken wollte. "Na o.k.", sage ich und unterdrücke das Knirschen meiner Zähne. "Das dauert dann aber wieder".
Wir laufen wieder aus und nehmen nun auch die Navigationsunterlagen für die Karibik an Bord und, ich fasse es nicht, die deutsche Fassung eben dieser Handbücher, mit deren Übersetzung ich bei der Post groß raus kommen will.
Mit der deutschen, wesentlich eleganteren Ausdrucksform vervollkommne ich nun meine eigene, doch recht holprige Übersetzung.
Ganz verbissen gesehen, könnte man auch behaupten: Ich schreibe nun die etwa dreißig Seiten französischen Text aus den französischen Handbüchern ab und den deutschen Text aus den deutschen Handbüchern. Da ich alles ja vorher schon handgemacht übersetzt hatte, betrachte ich das nur als ganz kleinen Beschiß.
Stolz wie ein spanischer Grande, werde ich nach Abschluß der Reise bei der "Teutschen Post", Hauptabteilung Seefunk, wieder vorstellig. Schade, daß es keine Eins plus in der Zensurenordnung gibt, schließlich hätte ich den Ehrentitel "Verdienter Dolmetscher der Seeverkehrswirtschaft" oder so, verdient.
Mein Werk ist ordentlich gebunden. Weißes, holzfreies Papier, tipfehler- und tipex-frei.
Ich fasse dafür als Bewertung "mangelhaft" und einen Rüffel ab.
Meine deutsche Übersetzung, also der (abgeguckte) amtliche Text des Deutschen Hydrografischen Institutes Hamburg, enthält zahllose rote Korrekturen.
"Hier zum Beispiel" schilt mich Postoberinspektor Moldenhauer, "übersetzen sie 'Feuerträger', nur weil es im französischen 'porteur de feu' heißt. Man muß so etwas freier, praxisnäher übersetzen, das heißt im deutschen "Leuchtturm". So hatte es der korrigierende Sprachwissenschaftler rot an den Rand geschrieben. Oder hier: "Die Kennung der 'Tonne' ist Blitzgruppe .... 'Tonne'! ..... So was heißt in deutscher Sprache "Boje"!
Ich laufe rot an!
"Herr Moldenhauer", ich hole Luft, "Bojen markieren evt. im Rostocker Flußbad das Revier für die Nichtschwimmer oder dienen zum Festmachen eines Angelkahnes. Kapitän Düerkop hat sich auf MS BRINCKMAN nach Tonnen orientiert.
Nach Begrenzungstonnen, Wracktonnen, Fahrwasser- und Ansteuerungstonnen.
Und im Mangrovenbusch der kubanischen Pinos-Insel oder der Ansteuerung von Nuevitas steht kein pompöser Leuchtturm sonder ein Feuerträger. Ein Gittermast oder nur ein Pfahl. Der trägt ein Festfeuer oder eins mit Blitzgruppe. In französisch 'porteur de feu' (Träger des Feuers) und im seemännischen Amtsdeutsch 'Feuerträger'."
Jetzt hole ich wieder Luft.
In der Hauptabteilung Seefunk kann kein Schwanz französisch. Aber im großen Hauptpostamt kann einer. Der ist zuständig für Briefmarken in kleinen Mengen und die Entleerung der Brieflocher. Am Sonntag war er in Warnemünde spazieren und sah im alten Strom Bojen und neben dem Teepott den großen Leuchtturm.
Am Montag hat er dann "meinen" amtlichen Text des Deutschen Seehydrografischen Instituts (DHI) kräftig korrigiert und ihm auf Grund seiner Wochenendbeobachtungen ein "mangelhaft" verpaßt.
Meine Fleißarbeit beurteilten Juroren, die von dem, was sie sich zu Bewerten anmaßten, keinerlei Ahnung hatten.
Meine Arbeit wird dennoch großzügigerweise anerkannt. Die Benotung ist mir schließlich auch 'togal'. Reisen später liefere ich dann auch noch meine Arbeiten in Technik und Betriebskunde ab. Dann trete ich zur mündlichen Verteidigung zwecks Erwerbs des Funkzeugnisses I. Klasse an. Just mit mir zusammen wird aber der Prüfungskommission ein Funkverstoß reingereicht. Douglas/Arizona hatte mich "loud and clear" viel zu lange auf Kurzwelle im Pazifik hämmern hören, nur Rügen Radio eben nicht. Man darf nicht pausenlos seine Heimatfunkstelle rufen, weil diese 'Wooling' auf der Welle den Nachrichtenverkehr beeinträchtigt.
"Flegel, kommen sie in zwei Jahren wieder, dann werden wir weiter sehen," sagt der gestrenge Postoberrat Moldenhauer.
Nicht nur Kapitäne haben es in der Seefahrt schwer.
Nach zwei Jahren hat es dann geklappt, mit dem dritten Streifen auf der Uniform.
![]() Isla de Pinos, da kann man nicht meckern
Isla de Pinos, da kann man nicht meckern
Wir halten for order auf Kuba zu. Schließlich kommt genaueres vom DSR - Befrachter: Anladen Nueva Gerona, in Nuevitas Ladung komplettieren.
Das Geschäft mit den nicht so geliebten Kuba-Apfelsinen nimmt seinen Anfang.
Wir blättern heftig im Seehandbuch und fangen auf's neue an zu übersetzen.
Nueva Gerona ist ein mittleres Dörfchen in reizvoller Umgebung auf der Pinos Insel. Jetzt heißt sie 'Isla de la Juventud', die Insel der Jugend. Wir halten also auf den Süden Kubas zu und passieren vor der größeren Pinos-Insel eine Menge kleine Inselparadiese. Das Revier ist sehr schwierig. Die Nautiker finden die Ansteuerungstonne für Nueva Gerona. Erwartungsgemäß ist das keine Boje.
Der Lotse kommt dem Schiff entgegen. Er führt als Erkennungszeichen ein "P". Practico heißen die Herren hier im Gegensatz zum Rest der Welt, dort heißen die Herren "peilot"!
"Bon dia capitano, full ahead". Wir ballern mit 16 Knoten durch kristallklares unbewegtes Wasser dem Dörfchen entgegen. Wenn man sich über die Reling beugt, kann man den Meeresgrund sehen. Der ATA-feine Sand ist gekräuselt. Hinter dem Heck baut sich eine riesige Heckwelle auf. Es hoppelt etwas auf dem Deck, wie auf den Bodenbrettern eines Leiterwagens auf Kopfsteinpflaster.
In Fachkreisen heißt das Grundberührung. Das haben Kapitäne nicht so gerne. Wir hatten allerdings keine und niemand möge so etwas behaupten, bestimmt unser Kapitän!
Der Practico grinst schelmenhaft und meint, das müsse so sein. Man muß nur ordentlich Sprutz geben, dann flutscht das Schiff über diese harmlose Untiefe auch drüber.
Andere Länder, andere Sitten!
Die Pinos-Insel hat nur einen ganz kleinen Bootshafen, aber einen riesigen Knast. Dieser ist ein Nachbau von Sing Sing und bietet achtzigtausend Gefangenen Unterkunft. Bei politischen Vergehen gegen Fidel Castro, muß etwas Strafe immer sein! Die fängt dann meist bei 25 Jahren an. Während dieser Zeit haben die Häftlinge im lockeren Strafvollzug ihr Auskommen in den Marmor-Steinbrüchen und den Pampelmusen-Plantagen der Insel.
Nach "Fall Anker Reede Nueva Gerona" kommt als erstes ein schwer bewaffneter
Wachsmann auf das Schiff, eben wegen der vielen Häftlinge auf der Insel.
Wir übernehmen auf Reede die Ladung von Schuten, Pampelmusen in dünnen Sperrholzkisten. Die Früchte sind von ausgezeichneter Qualität und auch reichlich davon vorhanden.
Bei einer Hiev auf der Palette bricht ein Stropp noch vor dem Passieren der Bordwand.
40 mal 20 kg Pampelmusen treiben, in zum Teil zersplitterten Kisten, im Bach.
Wir rennen zu fünft, so wie wir an Deck stehen, die Gangway hinab. Ich renne über den Pram, hebe auf diesem ab zum Kopfsprung und sehe im Flug unter mir nur Brettchen, zerborstene Kisten und fette Pampel- und andere Musen, aber kein Wasser. Ich konzipiere im Flug meinen Köpper zur Arschbombe um und wassere unversehrt. Vom Schiff aus werden in Pützen nun eimerweise die Pampelmusen an Deck gehievt.
In Deutschland ist graues Grippewetter.
Wir erhöhen unseren Vitamin-C-Spiegel auf tausend Prozent. Bananen verzehrt auf diesem Schiff niemand mehr. Bei mir hält diese Aversion ein Leben lang an. Bei Zitrusfrüchten tritt dieser Effekt nicht ein.
Es ist Februar und ich habe Geburtstag. Bei europäisch schlechtem Winterwetter, kommt auf einem stampfenden Schiff kaum Stimmung auf, da kommt man billig davon. Aber hier, beim Reedeliegen, in der warmen Sonne hat jeder Brand und durchforstet pausenlos die Geburtstage in der Besatzungsliste, ob nicht endlich einer geburtstagsmäßig dem erhöhten Flüssigkeitsbedarf Rechnung trägt.
Heute bin ich dran, Rechnung zu tragen. Neben der Rechnung trage ich vom Koch den großen Fünfzig-Liter-Topf auf die Luke. Dort schneide ich reichlich vorhandene Pampelmusen in Hälften und kratze den frisch von den Plantagen kommenden Saft samt Fruchtfleisch mit einem Löffel in den Topf. Bis er endlich voll ist. Die Stewardessen und der Chiefmate helfen mir. Der Zimmermann nur ideell.
Er baut eine High-tec-Fruchtpresse. Zwei ausgekehlte Bretter verbindet er mit einem Gummistreifen als Scharnier. Damit quetscht er die halben Pampelmusen breit, aber auch das Bittere aus der Schale heraus. "Bleib uns vom Acker mit dem Gerät", bedanke ich mich für seinen Ideenreichtum.
Die 50 Liter Frischgepresstes peppe ich dann mit 15 Flaschen "Schilkin-Wodka" auf. Die Flasche kostet im Transit 2,46 Mark. 46 Mann Schiffsbesatzung dokumentieren nach meiner Geburtstagfeier das blühende Leben und die Grippeviren in Europa beißen sich im März die Zähne an uns aus.
![]() Verschollen auf der Pinos-Insel
Verschollen auf der Pinos-Insel
Es ist Februar und Rosenmontag. Eigentlich sind die Kubis ja auch Karnevalisten.
Der Zimmermann ist Treckfiedel-Virtuose und will das testen. Ihm schließen sich noch einige Pappnasen an. Sie fahren mit einer leeren Pampelmusen-Schute an Land. E-Ing. Luckmann führt auf dieser Reise seine Gemahlin mit. Das Ehepaar nutzt auch die Transportleistung des Prams, bewahrt aber zu der Karnevalsgesellschaft Kontenance.
Die Horde zieht nun singend hinter der Treckfiedel des Zimmermanns durch das verschlafene Örtchen. Sie testen auch die sozialistischen Errungenschaften der neuen Kindertagesstätte, die Rutsche und die Wippe.
Die Anlegestelle der Pampelmusenschuten und der Bootshafen liegen an der Mündung eines kleinen Flusses. Über diesen führt eine steinerne Bogenbrücke. Just als der "Ümgang" sich auf dieser Brücke des Lebens freut, trifft sie die Härte des Gesetzes. Die ganze Bande wird verhaftet, die Treckfiedel verstummt.
Es gibt kein Entkommen.
Generalstabsmäßig geplant, stellt sich an beiden Seiten der kleinen Brücke die Policia quer. Geistesgegenwärtig werfen noch ein paar Jungens ihre unrechtmäßig erworbenen Kuba-Pesos von der Brücke in den Bach.
Der E-Ing. beobachtet von weitem die Polizeiaktion, an der sämtliche verfügbaren Kräfte der Insel zum Einsatz kamen. Der E-Mix und seine mitreisende Ehefrau sind die einzigen Zeitzeugen, die nach Rückkehr zum Schiff dem Kapitän melden können, wo seine vermißten Truppenteile abgeblieben sind.
Der II. Offizier "Jimmy" ist Tauchfan. Er hat unter Wasser schwer was auf der Pfanne. In diesem herrlichen Revier will er mich in diese neue Welt einführen. Matrose Schnulli kommt auch mit.
Der I. Ing und der III.Offizier sind auf Bambus aus. Späher haben dieses gefragte Material als leichte Beute landeinwärts auf dem Flüßchen entdeckt. Hier haben die Kubis ein Drahtseil über den Fluß gespannt und als Fähre einige dicke Bambusstangen zusammengebändselt. Auf diesen Schwimmkörper stehend, hangeln sie sich bei Bedarf über den Fluß.
Diese beiden sozialistischen Schiffsoffiziere rüsten nun zur Beschaffungskriminalität und wollen den Kubis ein paar Stangen Bambus aus ihrem Floß klauen.
Als Tatfahrzeug dient die Barkasse. Diese ist mittlerweile nicht mehr mit dem alten tuckernden Diesel bestückt, sondern wird von zwei Außenbordmotoren vom Typ "Forelle" mit je 6 PS Leistung erbarmungslos vorwärts gepeitscht.
Dennoch ist dieser Hobel ein ständiges Problem für sich.
Die beiden Materialbeschaffer setzen uns Taucher auf einer kleinen Insel ab und fahren dann weiter zur großen hinüber, an Nueva Gerona vorbei, den Fluß aufwärts ins Land hinein. "Auf der Rückfahrt wieder abholen, mindestens eine Stunde vor Sonnenuntergang!" wird vereinbart. Wir haben Walky-Talkie's mit, die mittlerweile erfundenen Handsprechgeräte.
Mir eröffnet sich die karibische Unterwasserwelt.
Ich bin begeistert.
Nur die Seegurken schmälern meine Verzückung. Sie wissen doch, der 8. Gang vom großen chinesischen Menü mit Ober Hans in Shanghai.
Dann faucht mich eine Muräne an und ich erschrecke. Als ich einen großen Marmorblock umschwimme, glotzt mir ein großer Baracuda in die Brille. Links- und rechtsmaulig läßt er einen großen Kuchenzahn diskret über die Unterlippe ragen. Er geht nicht aus dem Weg und ich umschwimme ihn ehrfurchtsvoll.
Dann paddelt ganz gelassen eine Schildkröte vor mir her. "Na das ist doch das Richtige", denke ich hinter meiner Brille "die beißt und faucht nicht. Die kann ich doch mal streicheln." Ich keule mit meinen Flossen, daß der Schnorchel durch die Brassfahrt fibriert. Die Schildkröte schaltet locker auf den zweiten, dreht sich noch mal kurz um und grinst. Ich tauche auf, reiße den Schnorchel beiseite und pfeife wie ein Typhon. Jetzt bleiben mir zum Streicheln nur noch die unbeweglichen Seesterne.
Die Fischer haben unter Wasser trichterförmig zwei 30 cm hohe Drahtzäune hundert Meter weit in die See hinein gebaut. Am Ende des Trichters steht ein Drahtkäfig. In ihm robben eine Menge gefangene riesige Langusten herum, eine stiefelt über die andere. Sehr imposante Tiere. Der Verzehr eines ihrer gehaltvollen Schwänze ist sättigend. Wir überlegen, zwei Tiere zu mausen. Jimmy möchte sie präparieren. Er ist Fan für so etwas. Uns übermannt die Redlichkeit, Jimmy holt sich im Dorf zwei ganz prächtige Tiere aus der Fischfabrik.
Unsere bescheuerten Taucherbrillen, Made in DDR, überdecken nur einen eng begrenzten Blicksektor nach vorn. Man bekommt nur wenig mit, was neben einem abläuft. Das jagte mir später oft einen fürchterlichen Schreck ein, wenn ich unter Wasser den Kopf nur leicht zur Seite wende und dicht neben mir das hämische Grinsen eines Baracudas bemerke. Diese Fische begleiten einen oft aus reiner Kollegialität. Sie sind in den Gewässern rund um Kuba die Chefs. Mir hat aber nie einer etwas getan, aber eingekesselt haben sie mich oft.
Die See ist bleiern glatt, aber es steht Dünung. Jimmy schwimmt weiter draußen als ich. Nach dem Auftauchen sehe ich ihn nur, wenn er aufgetaucht auch gerade von einem Wellenberg angehoben wird.
Auf so einer Anhöhe gestikuliert er jetzt ganz wild herum. Er trägt noch Brille und Schnorchel und weist in eine Richtung. Ich blicke in diese mit meinem Panzerfahrer-Horizont und sehe auf- und abtanzende Dreiecksflossen. Ich blutiger Laie, ich mache mir schon fast bei einem Zackenbarsch in die Dreiecksbadehose und jetzt kommen solche unangenehmen Kameraden auch noch dazu. Jimmy keult wie ein Wasserballer auf den nächsten Felsen zu, ich tue es ihm nach. Wir erklimmen keuchend die glatte bemooste Felswand. Und schauen von oben auf eine prustende, gemächlich an uns vorbeiziehende Herde Schweinsfische. Ihre Rückenflossen sehen schon bedrohlich aus und ähneln der der Haie. Die Heckflosse allerdings ist waagerecht. Schweinswale sind Säugetiere.
Auf der Insel stinkt und dämmert es mittlerweile. Jimmy hat weiter draußen auf sechs Meter Wassertiefe große Schildkrötenpanzer gefunden. Ich helfe bei der Bergung und bemerke, daß sechs Meter Wassertiefe meine absolute Leistungsgrenze sind. Als ich einen Panzer vom Grund aufhebe, umwabert mich eine Wolke Aas. Mit äußerster Mühe und angeekelt bringe ich das Fossil dennoch zur Meeresoberfläche. Dort schwimmt er dann wie ein Boot, wenn man das Wasser auspützt. Diese Schildkrötenpanzer stammen wahrscheinlich von Fischern, die nur auf das Fleisch der Tiere Wert legten. Wir hängen die geborgenen Panzer auf die Reusenstangen eines Langustenkäfigs im flachen Wasser. Hier trocknen sie in der Sonne und beginnen nun so erbärmlich zu stinken, daß wir uns nur in Luvseite dieser Fossilien bewegen können. Zu Hause, in seinem Garten, wollte Jimmy eigentlich Blumen hineinpflanzen. Schweren Herzens läßt er die Stinkbomben nun auf die See hinaus treiben.
 Die Sonne taucht ins Meer. Am Horizont in Gerona gehen die Lichter an. Unser Abholservice
Die Sonne taucht ins Meer. Am Horizont in Gerona gehen die Lichter an. Unser Abholservice
hätte längst auftauchen müssen. Dummerweise war bei unserer Anlandung am Nachmittag das Sprechgerät zwischen den Steinen in den Bach gefallen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis es aus den Spalten zwischen den Klamotten wieder geborgen werden konnte. Ich habe es mit dem Taschenmesser aufgeschraubt und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Nun baue ich es zusammen. Der Empfänger rauscht, aber ob der Sender was bringt, ist nicht gewiß. Ich rufe abwechselnd das Schiff und unseren Abholservice, die beiden Beschaffungs-Kriminellen. Es rührt sich nichts im Empfänger.
Das Schiff liegt in ca. drei Meilen außer unserer Sicht. Die hohe Felswand aus verwittertem Marmor verhindert das. Ich versuche hinaufzusteigen, um die Empfangsmöglichkeiten zu verbessern. Es wird zu gefährlich und auch schon zu dunkel. Wir hocken unten am Wasser jeder auf einem Stein. Die Steine sind rutschig, dazwischen klaffen tiefe Spalten.
"Wir müssen ein Feuer machen, sonst holt uns bis morgen früh hier keiner ab, "beschließt Jimmy. Mit dem Restlicht der untergegangenen Sonne suchen wir kriechend und springend an dem felsigen Ufer nach einer Einflugschneise zwischen dem im Wasser auch reichlich umherliegenden Klamotten. Wir wollen eine Einfahrt markieren, durch die unsere Barkasse auch im Dunkeln zu uns herankommen könnte, falls sie überhaupt noch kommt. Im Wasser liegen ja auch noch eine Menge Hinkelsteine, die dem schweren Boot nicht bekommen.
Einen geeigneten Platz haben wir nun, aber kein Brennmaterial.
An der steilen Felswand wachsen Kakteen und Sträucher. Jimmy und Schnulli schaffen sich an Trockenem. Ich finde einen ausrangierten Langustenkäfig am Hang. Ein Gewirr von Brettern und Knüppeln mit viel Draht. Schwer vom Boden zu lösen.
Ich ziehe an dem Gedönse und grabe es aus Laub und Erdreich. Mir wird ganz kribblich. Ich habe meine Arme und Beine voller Gries. Ameisen !
Die Khaki-Jacke ziehe ich noch aus, Sandalen, kurze Hose und Khakihemd behalte ich an und haue mich damit ins Wasser. Die Ameisen lassen von mir ab. Die beiden Holzsammler auf steiler Felsenhöh' lachen sich kringelig.
Jetzt klappern mir die Zähne am Feuer. Im Februar sind die Nächte in Kuba maikühl. Ich kriege Funkkontakt zu unserem Boot. Das getrocknete Sprechgerät schnärpselt doch noch.
Die beiden Bambusbären mit der Barkasse haben zwecks Floßdemontage ihre Motoren abstellen müssen und nach großem Engagement des I.Technischen Offiziers nur eine "Forelle" schließlich wieder zum Tuckern gebracht. Trotz C-6-Patent des Maschinenfachmanns. Der Modder im Fluß hat die Kühlwasserleitungen verstopft.
Unser Richtfeuer leistet nun zu unserem Auffinden gute Dienste. Wir verbrennen als Freudenfeuer den gesamten Vorrat samt Ameisen auf einmal.
Es blubbert nur ein Motor am Boot. Da den beiden im Boot die Probleme über den Kopf wuchsen, haben sie auch keinen Bambus geraubt. Blumenkübel übrigens, wollten sie daraus fertigen.
Wir werden von unseren Schlaf-Steinen abgeborgen und laufen draußen auf See unserem Kapitän in die Arme. Der hat sich das Lotsenboot gechartert, um
a) die karnevalistischen Pappnasen an Land aus dem Knast auszulösen und
b) vier seiner verschollenen Offiziere und den Matrosen Schnulli wieder aufzustöbern.
Um 00.30 Uhr sind wir alle vollzählig und wohlbehalten an Bord und schwärmen von dem erlebnisreichen Tag.
Kapitän Düerkop läßt uns in Ruhe ausschwärmen.
Am nächsten Tag raucht es dann aber wieder ganz heftig! Bis zum nächsten Max- und Moritz-Streich.
![]() Das Seeigel-Muttertier und der Mißgriff
Das Seeigel-Muttertier und der Mißgriff
Wir versegeln nach der Nordseite Kubas, nach Nuevitas.
Vor der Sandbank, auf der wir beim Ansteuern von Nueva Gerona auf ausdrücklichen Wunsch unseres Kapitäns keine Grundberührung hatten, hat der Kapitän gewaltigen Respekt. Schließlich haben wir jetzt noch größeren Tiefgang, als mit leerem Schiff beim Einlaufen.
'El Practico' nimmt wieder Anlauf: Mit "normalemento commandante" glättet er die Sorgenrunzeln im Gesicht des Kapitäns, der schließlich die 'Beratung' des Lotsen als Einziger verantworten muß. Es geht klar... Huch!
In Nuevitas ist es nicht ganz so schön. Aber unsere fidéle Truppe holt aus jeder Gegend etwas heraus. Gleich am Hafen bietet die Lagune ein schönes Bad, eingezäunt mit dicht gerammten Palmenstämmen, weil sich auch die Fachleute nicht ganz so sicher sind, ob Baracudas nun beißen oder nicht.
Das Bad hat schönen Sandstrand und ganz vorne seichtes Wasser.
Obersteward Charlie Dürr rennt mit freudigem Geheule als erster hinein in das warme seichte Wasser.
Dann hält er jäh inne und hüpft auf einem Bein auf der Stelle. Er heult jetzt auch in anderer Tonlage.
23 abgebrochene Stacheln sind es dann, an denen wir abwechselnd auf der Liegewiese unter Palmen und unter seiner Fußsole herumpopeln. Er hat einen fetten schwarzen Seeigel zerlatscht. "Charlie", spotte ich, "der Kubi von der Strandbar meinte, das war ein Muttertier, das sollte zur Zucht bleiben. Jetzt kriegst du bestimmt Ärger!"
 E-Ing. Luckmann und Kapitän Düerkop führen auf dieser Reise ihre Ehefrauen am Mann. In der warmen Tropennacht beschließen die beiden Paare am nahen Strand in der Lagune vor dem Zu-Bett-Gehen ein Bad zu nehmen. Frau Luckmann und Täubchen, wie der Kapitän seine Gemahlin zu nennen pflegt, schwimmen oben ohne in der karibischen Nacht und dem menschenleeren Bad.
E-Ing. Luckmann und Kapitän Düerkop führen auf dieser Reise ihre Ehefrauen am Mann. In der warmen Tropennacht beschließen die beiden Paare am nahen Strand in der Lagune vor dem Zu-Bett-Gehen ein Bad zu nehmen. Frau Luckmann und Täubchen, wie der Kapitän seine Gemahlin zu nennen pflegt, schwimmen oben ohne in der karibischen Nacht und dem menschenleeren Bad.
Der E-Mix greift seiner schemenhaft vor ihm auftauchenden Gemahlin ganz zärtlich von achtern unter die Arme und erwischt fälschlicherweise dabei die Moppels der Kapitänsgattin. Die Story veröffentlicht der Kapitän am Donnerstagnachmittag zur Kaffeetime in der O-Messe, sie trägt die Überschrift "Der Mißgriff" und erzeugt allgemeine Heiterkeitsausbrüche. Nur der E.-Ing. lacht in artiger Verlegenheit eine Nuance diskreter.
![]() Companero Rudi
Companero Rudi
In Nuevitas entsteht eine große Zementfabrik. Der technische Leiter dieses Aufbaus ist Rudi Baumung, ein Sachse, mit all der Umgänglichkeit und Kollegialität versehen, die diesem Volksstamm eigen ist. Er läuft in dieser Gegend unter dem Kosenamen "Companero Rudi" und ist eine Institution, von der jedermann nur mit Ehrfurcht spricht. Companero Rudi ist für jedes Problem in dieser Gegend zuständig, zu jedermann freundlich und hilfsbereit. Wir schließen mit "Companero Rudi" und seinen ca. zehn deutschen Mitarbeitern natürlich auch sofort Freundschaft.
Die Kleinstadt Nuevitas liegt etliche Kilometer landeinwärts. Vor dieser breitet sich eine große Lagune aus, die nur durch einen schmalen Seekanal mit der offenen See verbunden ist. Innerhalb der Lagune gibt es zwei Anlegeplätze für Großschiffe.
Puerto Taraffa, dicht bei Rudis Zementfabrik und Pastellilio ziemlich weit draußen in den Kalkbergen, aus deren Material Companero Rudi den Zement brennt..
JOHN BRINCKMAN wurde vom Lotsen nach Puerto Taraffa gebracht. Hier wird der Dampfer mit schön frischen saftigen Kuba-Apfelsinen beladen, die zu Hause nach Seetransport und Lagerhaus-Aufenthalt keiner essen möchte.
Bei dieser Gelegenheit, falls es noch interessiert: Die Kuba-Apfelsine ist eine United-Fruit-Züchtung, eine ausgesprochene Industrie-Orange, auf Saft gezüchtet. Die Kubis können noch nicht einmal etwas dafür, für die vom DDR-Verbraucher so verpönte Frucht.
Der DDR-Mensch versucht nun krampfhaft, diesen Saftballen abzuschälen und das Fruchtfleisch in Segmente zu zerlegen und verzweifelt dabei.
Die Frucht ist nun aber einmal nur zum Auspressen gezüchtet worden und nicht zum Auseinanderpulen.
 Die Kubis haben für den Verzehr eine bei uns zu Hause völlig unbekannte Methode.
Die Kubis haben für den Verzehr eine bei uns zu Hause völlig unbekannte Methode.
Sie schälen mit scharfem Messer von dieser Orange nur die äußere gelbe Schale ab und achten dabei darauf, die darunter befindliche weiße Hülle nicht zu durchstechen.
In diesem weißen flexiblen Ball schneiden sie nun oben ein Loch hinein und halten die so entstandene Öffnung an den Mund und knitschen das Ding völlig leer.
Auf das strohige Fruchtfleisch legt hier im Erzeugerland keiner ein Pferd. Um an dieses Insider-Wissen zu gelangen, muß man den Schauerleuten in der Luke aber ein scharfes Messer zur Verfügung stellen. Keiner von den Companeros besitzt nämlich eins.
Sie werden am Hafentor vor jeder Schicht durchsucht und alle Messer konfisziert.
Bei dreitausend Tonnen eingestauten Apfelsinen ist der Eigenverzehr von 20 Kilo Früchten nicht drin! Eine kubanische Spezialität, nirgendwo in der Welt trifft man solch einen Geiz noch einmal an.
Vom Hafen Taraffa nach Nuevitas hinein, ist es weit, so ca. 5 Kilometer. Hinter die Geheimnisse eines angeblich existierenden "Städteschnellverkehrs", steigen wir so schnell nicht.
Der gestreßte Bauleiter "Companero Rudi" trinkt bei uns abends an Bord ein Bierchen. "Wie läuft denn das transportmäßig hier in deiner Wahlheimat? Hier ist doch Gleisanschluß von Taraffa nach Nuevitas? Fährt da nichts in das Town rein?"
"Hör bloß auf, rühre nicht da dran! Vor euch war die LEIPZIG hier," erläutert uns Rudi den nicht vorhandenen städtischen Nahverkehr.
Die Crew vom MS LEIPZIG hat in Nuevitas ordentlich einen gezischt und ziemlich spät und ziemlich bezecht sich auf den langen Heimweg begeben. Neben dem geschotterten Heimweg nach Puerto Taraffa verläuft, von Feigenkakteen gesäumt, der Schienenstrang. Auf diesem erspähen die müden Spätheimkehrer auf einem Abstellgleis eine Draisine. So ein handbetriebenes Schienenfahrzeug, bei dem zur Fortbewegung an Oberdeck nur alle kräftig einen Schwengel hin- und herbewegen müssen.
Alle Mann bewegen den Schwengel, das Ding geht ab wie Schmidt's Katze.
Die dunkle Nacht erhellt sich plötzlich. Einer von den rumseeligen Hobby-Eisenbahnern sieht noch klare Bilder und erkennt einen Entgegenkommer auf Kollisionskurs, nämlich den Leerzug mit Apfelsinenwaggons von Puerto Taraffa. "Alle Mann von Deck!" Es hat geklappt, keiner kommt zu Schaden, nur das so proppere Transportmittel hat arg gelitten.
Der Makler hat dem 'Alten' die Schadensrechnung natürlich präsentiert.
"Haben sie ein Glück" sage ich zu Kapitän Düerkop, "daß wir ihnen solche Sorgen nie bereiten würden!"
"Companero Rudi, mach's gut und halte sämtliche Köpfe hoch. Nett, dich mit deiner duften Truppe hier aufgestöbert zu haben" verabschieden wir uns von Rudi und seiner Spezialistentruppe. "Wir kommen bestimmt wieder und dann mit voller Wucht!"
![]() Heim zur Mutti klappt nicht
Heim zur Mutti klappt nicht
"Klar vorn und achtern!" Das Schiff legt ab. Es geht heim zur Mutti. Diesmal mit voll Schiff. Die jungfräulichen Ahmings (Tiefgangsmarken) auf der oberen Scala tauchen nun auch einmal für länger unter Wasser und eine leichtsinnig zu weit oben angesiedelte vertrocknete Seepocke legt vor Freude Eier.
Wir verlassen die gastlichen karibischen Gewässer und drängeln uns bei den Inseln der Crooked Passage durch, hinein in den Atlantik, hinein in das Bermuda-Dreieck.
Uns schlottern die Knie, vor Entsetzen, wie so viel Blödsinn diesem schönen Seegebiet von einem Landei-Schriftsteller angedichtet werden kann. Die riesigen Krautfelder des Saragossa-Tangs fallen mir hier auf, sonst nichts. Ich fahre dann noch paarundfünfzig Male unbehelligt durch dieses 'furchtbare Dreieck', so wie zigtausende andere Besatzungen vor und nach mir auch. Schließlich sind Schiffe auch schon im Bodensee untergegangen und auch jede Menge Flugzeuge dort hineingestürzt.
Aus "heim zur Mutti" wird nichts. Rügen Radio hat mich auf der Liste:
wegen extremer eissituation in ostsee entloeschung rostock nicht moeglich stop schiff loescht in hamburg - seereederei befrachtung
In Hamburg haut man unsere lumpigen dreitausend Tonnen Zitrusfrüchte natürlich ratz-batz in die bereitstehenden Waggons der Deutschen Reichsbahn und schwupp, schon fliegen wir wieder raus. Ab, nach Conakry, lautet die Order. Ausgerüstet und verproviantiert wird per LKW-Lieferung aus Rostock. Wir dampfen schneller, als uns lieb ist, wieder die Elbe abwärts.
Auf der Elbe ist erheblicher Eisgang.
Unser weißer Schwan hat keine Eisklasse und ziert sich bei Fahrten durchs Eis, wie die Zicke
am Strick. Fiete Beus ruft aus der Maschine die Brücke an. Er müsse sein Waffeleisen anhalten, die Zylinderdeckel glühen schon. Die Seekästen vor der Ansaugleitung sind mit Mahleis so zugesetzt, daß die Kühlwasserpumpe trotz dicker Backen keinen Tropfen Kühlwasser an den überhitzten Motor bringt.
Dem Elblotsen wird dieses Begehren nahegebracht: "Kapitän, auch wenn die Zylinderdeckel hier oben durch die Skylights fliegen, hier können wir auf keinen Fall liegen bleiben. Hier pflügt man uns unter. Die gebrochene Fahrrinne ist doch nicht breit!"
Irgendwie klappt es halt wieder. Der glühende MAN-Diesel bringt uns in sicheres Fahrwasser.
 Fiete Beus, unser erfahrener Chief diente vor dem Krieg schon auf einem Passenger. Jetzt beim Abendessen plaudert er aus dem Nähkästchen:
Fiete Beus, unser erfahrener Chief diente vor dem Krieg schon auf einem Passenger. Jetzt beim Abendessen plaudert er aus dem Nähkästchen:
"Dieses Problem mit dem ausbleibenden Kühlwasser hatten wir damals schon auf dem Hudson-River. Da waren die Siebe auch zu, aber nicht mit Eisschlamm, wie heute, sondern mit Kondomen. Da habe ich die kuriosesten Exemplare zwischen den Gittern herausgepult. Möönsch hatten die damals schon ausgefeilte Modelle!"
An Bord ist jetzt nicht die beste Stimmung. Wir alle wollten jetzt zu Hause Frau oder Freundin längsseits haben und nicht schon wieder Feuerschiff Elbe eins, Borkum Riff, Texel, Terschelling.
Aber es gibt wenigsten frischen Proviant an Bord, frische Milch. Ordentliches "Hafenbräu"- Bier und nicht das Rülpswasser von "Becks" aus Dakar. Auch ein deftiges Eisbein kann der Koch wieder servieren, statt der bläulichen Zwerghühner aus Afrika. Auch Luftgewehr-Kugeln und Mücken-Spray sind eingetroffen.
Ein Schiff braucht tausend Dinge!
Man stelle sich vor, wie lang meine vom Atlantik telegrafisch abgeschickte Bestelliste war. Ein Telegramm von fünf DIN-A4-Seiten.
Nur nebenbei erwähnt, um auch mal was von der Arbeit zu erzählen.
![]() Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind
Das Schiff macht wieder in Conakry fest.
Genau so pünktlich wie Herr Makouli kommt uns auch das Botschaftspersonal besuchen. Herr Makouli kommt mit einer Aktentasche und kriegt ein paar Pfund Kleinigkeiten, die Diplomaten kommen mit dem Wäschekorb und immer neuen Wünschen. Sonntag morgens z. B., zwei niedliche kleine Mädchen mit Schleifchen im Haar. Sie singen in der O-Messe ein Liedchen. Der Bäcker, der um 3.00 Uhr aufgestanden ist, hat derweil 80 warme Brötchen in den mitgebrachten Wäschekorb gefüllt. Auch Rollmops, Konserven, Bockwurst, eigentlich alles wird halbdankend gerne entgegengenommen. Als Gegenleistung verpflichtet sich der Politsachverständige der Botschaft, uns immer nach Einlaufen, in einem Vortrag über die weltpolitische Lage zu informieren.
Auch das noch.
Das Gesülze kommt jeden Tag in der Schiffspresse, um deren Empfang ich mir täglich das Futter aus der Uniform reiße.
Beim ersten Vortrag knallt Bestmann Schweinchen dem Diplomaten an den Kopf: "Ihr blast den Negern hier mit dem C-Schlauch klaren Zucker in den Mors und wir fahren Reise für Reise mit fast leerem Schiff wieder nach Hause!"
Damit wurde die gerade gegründete patenschaftliche Beziehung wieder nur auf das Brötchenholen beschränkt.
Die Botschaft der DDR, für deren Einrichtung die Revolutionäre Volksrepublik Guinea ja im Gegenzug reich beschenkt wurde, ist unheimlich happy, daß FRITZ REUTER und JOHN BRINCKMAN nun als ständige Versorgungslinie für ihr Wohlergehen sorgen. Wir allerdings haben damit nur Huddelei, da wir deren Versorgungsgüter in Rostock reinräumen und in Conakry wieder rausräumen müssen. Der Herr Botschaftsrat schleppt doch seine 200 Kisten "Radeberger Bier" nicht persönlich aus unserer Bierlast. Die Schweinehälften auch nicht.
Eine Flasche "Radeberger Bier" kostet in Conakry 200 Franc guineé. Wir verscheuern im Hafen eine Flasche Wodka (2,46 M) oder eine Taschenuhr (6,-M) für 1000 Franc und haben somit in Guinea immer ausreichend "Bewegungsgeld".
Ein Arbeiter auf den Bananenplantagen in Benti erhält einen Stundenlohn von 33 Franc guineé.
Als in Conakry die Botschaft der DDR Einzug hielt, stellten die Diplomaten auch etliche Bedienstete ein. Reinigungs- und Küchenpersonal, Gärtner und Kraftfahrer.
Zwecks Entlohnung machte sich der Kaderleiter kundig und ihm wurde eben dieser Stundenlohn von 33 Franc guineé für diese Bediensteten empfohlen.
"Das ist ja kapitalistische Ausbeutung" konstatierte der Botschafter. Die frisch eingerichtete Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik, die sich ohnehin ganz furchtbar auf den Bauch geklatscht fühlt, bezahlt allen guinesischen Bediensteten einen Stundenlohn von 200 Franc!
Jeden Tag ist Lohnauszahlung nach Feierabend. Das ist auch im Hafen so.
Montag ist in der Botschaft erster Arbeitstag.
Alle Bediensteten halten zum Feierabend nach ihrem ersten Arbeitstag bei ihrem diplomatischen Dienstherren die Hand auf und erhalten nun für acht Stunden Arbeit 1600 Franc guineé.
Nach einer Woche melden sich alle wieder zur Arbeit. So lange hat der fette Betrag gereicht, den sie Montag vor einer Woche ausgezahlt bekamen.
Wer in Guinea als Arbeitgeber täglich seinen Arbeitnehmer sehen möchte, zahlt einen Stundenlohn von 33 Franc. Dann reicht der abends ausgezahlte Lohn bis zum nächsten Morgen und der Mann erscheint täglich.
Dieser Landessitte hat sich nach dem ersten Zahltag auch die Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik angeschlossen.
Am 7. Oktober zum Tag der Republik, der Deutschen Demokratischen meine ich, werden dem Kapitän sechs Einladungskarten in pompösester Aufmachung zum Botschaftsempfang übergeben. Ich weile unter den sechs Auserwählten. D.h. ich reiße mich keinesfalls darum, ich werde dazu abkommandiert. Der Alte hat wohl Lunte gerochen und hält sich gleich von vornherein raus.
Freiluftveranstaltung im gepflegten Botschaftsgarten.
Bei dem ganzen Schnicki-Micki ist für mich eigentlich nur das Ochsenfrosch-Konzert aus dem nahen Feuchtbiotop von Interesse, weil ich das in so einer Besetzung noch nie gehört hatte. Wir halten uns an das "Radeberger Bier", das wir tags zuvor zur Versorgung der Botschaft mitgebracht haben.
Schließlich soll man ja bei der Hitze hier viel trinken.
Die vierte Runde müssen wir allerdings in guinesischer Landeswährung bezahlen.
Es waren nur drei Freibier pro Mann vorgesehen.
Wir stehen demonstrativ auf und verlassen das noble Gelände. Nicht durch den hinteren offiziellen Eingang, sondern gleich mit einer Fechterflanke über die verschlossene Gartenpforte zur Straße hin.
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Deutschen die im Ausland sind!
![]() MS HOPE
MS HOPE
Conakry hat uns wieder und mich zum zig-ten Mal. Schon von weitem auffällig liegt ein großes weißes Schiff an der Querpier. HOPE steht schwarz quer über der weißen Bordwand. Heimathafen Los Angeles.
Die HOPE ist ein ehemaliges Lazarettschiff der US-Navy. Dieses wird jetzt nach UNO-Bedarf durch die Welt geschickt. Es soll acht Monate in Conakry bleiben. Während dieser Zeit wollen 80 Ärzte und 80 Schwestern an Bord kostenlos den desolaten Gesundheitszustand der afrikanischen Bevölkerung verbessern.
Die Behandlung auf dem Schiff ist kostenlos, aber vor der Gangway steht ein guinesischer Posten und der verlangt vor dem Betreten des Schiffes von jedem seiner Landsleute zehntausend Franc guineé, bzw. eine Überweisung von einem guinesischen Arzt. Die Amerikaner sind empört und wegen ausbleibender Patienten kaum ausgelastet.
 Unser Schiff geht an die Pier. Es beginnt der Ladebetrieb. "Funker, könnse mal kommen", ruft der Gangway-Posten. Bei ihm stehen sechs hübsche, weißhäutige Mädels mit bunten Eimern und wollen was von unserem Wachmann am Gangway-Podest. Ich höre mir das Problem an: Die Mädels sprechen günstigerweise kalifornisch und nicht etwa texanisch: "Wir kommen von der HOPE. In unserem Operationssaal liegt eine Bluttransfusion und unser Kühlaggregat ist ausgefallen. Wir benötigen ganz dringend Eis, können sie uns helfen?" Der Koch kann, er hat jede Menge Stangeneis in seiner Last, nur die in der Tropenhitze spärlich bekleideten Mädels halten es in der grimmigen Kälte da drin nicht aus. Wir erfüllen rasch den Wunsch der Mediziner und diese schnell ihren Eid des Hippokrates.
Acht Reisen lang bilden wir mit den Leuten von der HOPE dann eine innige Symbiose.
Unser Schiff geht an die Pier. Es beginnt der Ladebetrieb. "Funker, könnse mal kommen", ruft der Gangway-Posten. Bei ihm stehen sechs hübsche, weißhäutige Mädels mit bunten Eimern und wollen was von unserem Wachmann am Gangway-Podest. Ich höre mir das Problem an: Die Mädels sprechen günstigerweise kalifornisch und nicht etwa texanisch: "Wir kommen von der HOPE. In unserem Operationssaal liegt eine Bluttransfusion und unser Kühlaggregat ist ausgefallen. Wir benötigen ganz dringend Eis, können sie uns helfen?" Der Koch kann, er hat jede Menge Stangeneis in seiner Last, nur die in der Tropenhitze spärlich bekleideten Mädels halten es in der grimmigen Kälte da drin nicht aus. Wir erfüllen rasch den Wunsch der Mediziner und diese schnell ihren Eid des Hippokrates.
Acht Reisen lang bilden wir mit den Leuten von der HOPE dann eine innige Symbiose.
Nur dürfen das die Politlandeier in Rostock nicht so mitkriegen.
Laut interner Anweisung der Politabteilung der Reederei vom Mai 1963 haben wir jeglichen Kontakt mit den Vertretern des Klassenfeindes zu meiden. Das gilt auch für Begegnungen mit dessen Seeleuten und auch mit der Lokusfrau vom Hamburger Hauptbahnhof. Das strafrelevante Delikt heißt "Kontaktaufnahme" und kann das Seefahrtsbuch kosten.
Die Reise später klagt ab den Kanarischen Inseln Chief Günther Böttcher über Bauchgrimmen. Peter Erbstößer, genannt "Erbse" ist II.Offizier und erwarb mit dieser Funktion automatisch seinen Doktor hc. wc. Erbse bekämpft die Leiden des Chiefs mit Haferschleim. Nach drei Tagen konstatiert er aber eine Blinddarmentzündung. Günther Böttcher wird unterhalb der Gürtellinie tiefgefroren, damit sein Appendix nicht perforiert. Auf Conakry Reede angekommen, wird der Patient auf eine Trage gebunden und in unsere ausgesetzte Barkasse weggefiert. Ab Hafenpier wird er nach "Donka", dem größten Krankenhaus des Landes verfrachtet. Drei Ärzte unterschiedlicher Nationen betasten nun den langsam auftauenden Unterleib des Patienten. "Erbse" beteiligt sich an der wissenschaftlichen Session mit der vorgegriffenen Diagnose: Appendicitis. Damit fängt er sich eine heftige Mißbilligung ein, da er keinen gehobenen medizinisch-akademischen Grad besitzt.
Die drei Ärzte konstatieren: Appendicitis.
Eine Operation überstehen Patienten, die mit dem Krankenhaus keine Erfahrung haben, darin nicht. Chief Günter Böttcher bekommt eine Einweisung für MS HOPE und wird augenblicklich auf dem Schiff operiert.
Ich besuche ihn im riesigen Krankensaal und bringe ihm ein paar persönliche Dinge. Der Tropf hängt noch an ihm. Er ist gerade dabei zu sich selbst zu finden, gesucht hat er sich schon.
Die Krankensäle sind in hellgrauer Kampfblechfarbe gestrichen. Alles nur Schiffbaustahl, nichts verkleidet. Wenn Not am Mann ist, werden die Betten vierstöckig übereinander in den Stützen eingehängt. Jetzt ist aber nur eine Seite zweistöckig gepackt. Günter Böttcher hat freien Blick an die Decke. Dort sieht es aus, wie in seinem Maschinenraum. Ein Gewirr an Rohrleitungen. Alle farblich gekennzeichnet und zusätzlich beschriftet. "Hot water, fresh water, sea water, steam" hat der Leitende Ing. der BRINCKMAN als Begrüßungsanblick nach seinem langsamen Erwachen nun vor Augen. Die Leitung mit dem "hot water" flößt ihm Respekt ein. "Hoffentlich bricht die nicht", äußert er seine Gedanken. Noch im Tran, hat er keine anderen Sorgen. Nach zwei Stunden scheucht ihn die Schwester schon aus der Koje. Es gibt Abendessen. Das bedeutet: "Vor dem Kacken, nach dem Essen - Händewaschen nicht vergessen!"
Nach zweieinhalb Tagen muß MS BRINCKMAN mangels Ladungsangebot den Hafen verlassen. "Felix, lauf mal rüber zur HOPE und versuche, dort den Chief rauszuhauen!" beauftragt mich Kapitän Düerkop.
"Yes, he can go", sagt die diensthabende Schwester und stellt auch ein Formular aus, daß der Germane Günter Böttcher nun keinen Wurmfortsatz mehr in sich trägt.
Ich frage dümmlich: "Wie jetzt, 'can go' etwa zu Fuß?" "Ja natürlich!" bestätigt die Schwester. "Na Günter" sage ich, "dann woll'n wir mal die lumpigen 500 Meterchen im leichten Trab nach Hause joggen."
Den Schlafanzug hat er schon ausgezogen, da kommt Doktor Tilbulski in Zivil von Land.
"Moment!", er bremst die Aktivitäten. "Schwester! Schere, Pinzette, erst noch die Fäden ziehen."
Nach fünftägiger Seereise macht das Schiff für ein paar Stunden, wegen was weiß ich nicht mehr, in Las Palmas fest. Da hüpft unser Chief schon wieder wie ein afrikanischer
Springbock über die Kanarischen Inseln.
Wir liegen schon zwei Tage geruhsam in Benti vor uns hin, da klopft zur nachtschlafendsten Zeit die Oberstewardeß Waltraut, die von allen Elvira genannt wird, beim Doc an das Schott. Die Frau steht im Bademantel mit wirrem Haar vor ihm und klagt über heftigste Unterleibschmerzen.
"Erbse" ist zwar Hobby-Gynäkologe, aber mit diesem Fall doch völlig überfordert.
Hier mitten im Busch ist die Situation sehr bedrohlich. Von Benti nach Conakry gibt es offiziell keinen Landweg.
Monsieur Moreau, der französische Pflanzer, kennt einen Schleichweg. Jetzt während der Trockenzeit müßte man auf diesem sich durchschlagen können.
Erbse und Elvira machen sich feldmarschmäßig fertig. Der Pflanzer kommt mit seinem Jeep, einem Helfer und Brückenbau-Material.
Sie schlagen sich mit dem Jeep, dem Helfer und den mitgeführten Balken durch den Busch bis zu einer befestigten Piste. Mit dem mitgeführten Baumaterial überwinden sie die vielfältigen Hindernisse durch die Wildnis. Schließlich erreicht die Truppe zivilisiertes Territorium, das verkehrsmäßig erschlossen ist.
Der Jeep fährt wieder zurück. Erbse und die sich quälende Elvira müssen sich jetzt alleine weiter durchschlagen. Geborgtes Geld haben sie genügend dabei.
An der staubigen Piste hält so ein landestypischer Kleintransporter. Mit Fahrgästen schon längst überladen und auf dem Dach auch noch zehn Zentner-Säcke, Hühner, Ziegen und Kokosnüsse.
Der Fahrer schickt zwei junge Männer in den Fahrtwind und den wirbelnden Pistenstaub. Erbse und Elvira haben Sitzplatz. Der Fahrer fährt auch nach Conakry, meint er. Nach vielen Stunden holpriger Fahrt, stellt sich aber heraus: So ganz nach Conakry fährt die Kutsche nicht. Nur hier bis zu dieser Abzweigung, beschließt jetzt der Fahrer. Aber sicher kommt da auch irgendwann einer seiner Kollegen und fischt die beiden aus dem Straßenstaub, beschwichtigt der Transportunternehmer.
Erbse macht das einzig Richtige, was ihm bleibt. "Wir haben kein Geld. Diesen Transport bezahlt unser Makler in Conakry. Das ist die sehr seriöse Firma "Entrat".
Dort mußt du uns schon hinfahren, wenn du dein Geld haben möchtest!"
Sämtliche Passagiere sind dagegen, nur der Fahrer ist dafür. Der beschließt eine Kursänderung und fährt nach Conakry. Vor dem "Entrat-Gebäude" hält er. Erbse dreht eine Runde hinter dem Gebäude und holt in voller Deckung aus seinem Brustbeutel die ausgehandelten guinesischen Franc hervor. Den ganzen Geldbestand kann er doch nicht ans Tageslicht bringen, sonst würde die Fahrt ganz genau soviel kosten, wie er Geld in den Händen hält.
Erbse und die tapfere Patientin wenden sich an die Botschaft. Diese empfiehlt natürlich vorschriftsgemäß Elviras Behandlung im Krankenhaus "Donka". Die beiden reißen die Hände hoch und fahren mit einer Taxe zur HOPE. Elvira muß sich nur noch kurz am Riemen reißen und festen Schrittes und lächelnd am guinesischen Wachposten auf die Gangway treten. Als Patient kann sie sich nicht hängen lassen.
Im Falle ihrer Enttarnung braucht sie eine kostenintensive Überweisung.
Erbse kann gerade noch die Kurve kratzen, erzählt er mir später, "da hat Elvira schon die Hosen runter und sitzt auf dem Pflaumenbaum im Gynni-Saal."
In diesem wird ihre schmerzhafte Huddelei mit dem Eierstock repariert.
Nach acht monatigem segensreichen Wirken versegelt MS HOPE von Conakry nach Boston und dann mit völlig neuem Personal wieder in ein anderes bedürftiges Land. Schade.
![]() Der Hinterhalt
Der Hinterhalt
In Conakry hat die DDR in ihrer nimmer versiegenden Güte eine riesige Druckerei aufgebaut und betreibt die auch in zehnprozentiger Auslastung mit deutschen polygraphischen Experten.
Die Jungs aus Leipzig und Karl-Marx-Stadt sind Kumpel: "Kommt, wir fahren euch mal ins Inland". Sie fahren uns in das Bergland zum Kakoulima. Der Kakoulima ist ein langgestreckter Berg, über seiner vorderen Erhöhung steht komischerweise nahezu ständig ein Wölkchen. Die Franzosen nennen den Berg daher den "rauchenden Hund".
Der "rauchende Hund" ist der Chefberg in dieser gebirgigen Gegend mit wilder, üppigster Vegetation, aber kühlem, angenehmen Klima. Der Framo der Drucker hält in einem Dörfchen. Die Bewohner laufen zusammen, wir aber schwärmen auseinander.
Wir gehen ströpen. Ich ströpe doch so gerne. Dietmar Hess, der Second, zieht mit mir los. Wie im Jahre 1849 David Livingston, so erkunden wir beide jetzt Afrika.
Das geht immer am einfachsten mit einem Flußlauf. Durch das Dorf fließt auch ein schöner kühler Gebirgsbach. Er ist wie jeder ordentliche Wildbach voller Steine.
Das Flüßchen verläßt das Dorf ohne große Schnörkel direkt hinein in den Busch. Dieses Dickicht wäre für uns uneinnehmbar, aber mit dem Wasserlauf geht das ganz prima. Wir springen von einem Stein zum anderen, oder waten auch mal mit den Sandalen durch das klare Gebirgswasser. Nur eins gefällt uns nicht, auf jedem zweiten Stein in dem Bach liegt ein Scheißhaufen. Wir verdächtigen die Dorfbewohner. Über uns wölbt sich ein grünes Dach. Wir wandern weiter, da bricht hinter uns der Krieg aus.
Wir fahren zusammen.
Links und rechts von uns und erst recht oben im Laubdach tobt eine Affenherde mit einem ohrenbetäubenden Gezeter an uns vorbei. Wir erstarren mit Händen an der Hosennaht. Diese King Kongs haben uns in ihren Verstecken passieren lassen und toben nun, aus dem Hinterhalt kommend, an uns vorbei. Dreißig Meter vor uns aber bauen sie sich quer über dem Bach auf. In vorderster Reihe drohen die großen Brocken, dahinter die schwächeren Krieger mit weniger Fronterfahrung. Große schwarze Tiere mit langem zottigen Fell. Weiß der Teufel, welcher Waffengattung die angehören. Sie schinden mit ihrer Kriegslist bei uns aber enormen Eindruck. Wir beschließen den geordneten Rückzug.
![]() Ici Radio Conakry
Ici Radio Conakry
Monsieur Camaras Familie winkt wieder in Benti an der Pier. Der Glückliche steigt wieder um.
Wir steigen nur auf die Barkasse und fahren den Melacoré flußaufwärts. Mittlerweile bin ich als Längerdienender in dieser Gegend auch auf dem Melacoré Insider.
Die nautischen und technischen Offiziere wechseln das Schiff häufiger, da auf ihrer Karriere-Leiter ständig Bewegung ist. Ich verharre in meiner Position und bin zusammen mit Kapitän Düerkop mittlerweile inventarisiert auf MS JOHN BRINCKMAN.
Der Fluß hat viele Nebenarme und jede Menge Tücken. Man kann sich mächtig verfransen und was das Unangenehmste ist, die schwere Barkasse bei Ebbe auf's Trockene setzen.
Mittlerweile kann ich auf jahrelange Erfahrungen zurückblicken.
Der Gezeitenunterschied beträgt über zwei Meter.
 Wir banden auf unserer ersten Erkundungsfahrt das schwere Boot möglichst dicht am Ufer an den Mangroven fest und gingen alle Mann ströpen. In so einem naturbelassenen Susu-Dörfchen gibt es allerhand Sehenswürdigkeiten. Ein jeder von uns schafft sich irgendwo und erkundet irgendwas.
Wir banden auf unserer ersten Erkundungsfahrt das schwere Boot möglichst dicht am Ufer an den Mangroven fest und gingen alle Mann ströpen. In so einem naturbelassenen Susu-Dörfchen gibt es allerhand Sehenswürdigkeiten. Ein jeder von uns schafft sich irgendwo und erkundet irgendwas.
Am späten Nachmittag wird dann lautstark zum Rückzug geblasen, die Vollzähligkeit festgestellt und - der Aufenthalt im Dorf um vier Stunden verlängert. Das Boot liegt hoch und trocken. Wir könnten es in Filzpantoffeln erreichen. Nur Winkerkrabben und Schlammspringer umringen es.
Unser Getränkevorrat erschöpft sich.
Die Dorfbewohner umsorgen uns. Eine Büchse Wasser ist immer drin. Sie wissen schon, das mit den bunten Fischchen und Kaulquappen.
Na ja, so groß ist der Durst nun auch wieder nicht, merci Madame!
Ein Susu-Junge holt für uns ganz akrobatisch Kokosnüsse von der Palme. Es findet sich auch ein eingeborener Fachmann der das Eröffnungsverfahren einleitet. Der weiße Mann ist dafür doch zu dusselig, was die Damen auf dem Dorfplatz zu Heiterkeitsausbrüchen veranlaßt. Die Winkerkrabben, die um unsere Barkasse herum auf dem Schlamm ganz angeberisch pausenlos mit ihrer großen Schere gewunken haben, verziehen sich nun in ihre Löcher und beginnen damit, den Eingang ihrer Erdhöhlen von innen zuzumauern. Die Flut kommt. Unser Transportmittel kommt endlich vom Grund frei. Nur haben wir jetzt das Pech, zwar den Fluß hinab zu fahren, aber dennoch gegen die heftig auflaufende Flut gegenan zuballern. In einem Strudel dreht das schwere Boot einen Vollkreis. Wir werden kurzfristig vorübergehend blaß. Im Dustern tauchen dann die Deckslichter des Schiffes flußabwärts auf. Wir fassen unsere Ausmecker ab.
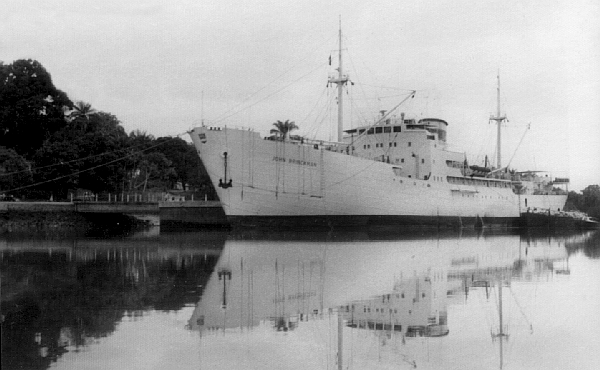 Alle weiteren Exkursionen ins Innere Afrikas laufen dann profihafter ab. Wir fahren so, wie die Susu-Einbäume schon seit tausend Jahren, mit der Flut zu Berg und mit der Ebbe zu Tal. Des weiteren nehmen wir Geschenke mit. Da achte ich nach dem ersten so diletantisch organisierten Besuch jetzt ständig darauf. Den größten Effekt bringen Toilettenseife, Kernseife und vor allem das DDR-Erfolgswaschmittel "WOK".
Alle weiteren Exkursionen ins Innere Afrikas laufen dann profihafter ab. Wir fahren so, wie die Susu-Einbäume schon seit tausend Jahren, mit der Flut zu Berg und mit der Ebbe zu Tal. Des weiteren nehmen wir Geschenke mit. Da achte ich nach dem ersten so diletantisch organisierten Besuch jetzt ständig darauf. Den größten Effekt bringen Toilettenseife, Kernseife und vor allem das DDR-Erfolgswaschmittel "WOK".
WOK heißt in Susu-Sprache "OMO". Als die französischen Kolonialherren das erste Waschpulver in diese Gegend brachten, da war das wahrscheinlich "OMO".
Die Susu-Sprache kennt ca. 2000 'Dingwörter'. Wörter für Fluß, für Fisch, Palme, Stock und Stein und 1995 weitere Substantive.
In diesem Wortschatz enthalten waren vor der Kolonialisierung natürlich nicht Begriffe für Verkehrsampel, Kilowattstunde, Rückversicherungsgesellschaft und eben auch nicht für Waschpulver. Das erste Paket Waschpulver, das den Melacoré aufwärts die Dörfer an dessen Ufer erreicht, ist das Fabergé-Fabrikat "OMO". Dieses Wort fügt sich so nahtlos in die Susu-Sprache ein, so daß fürderhin Waschmittel eben "OMO" heißt. "Weißer Riese", beispielsweise, hätte im Susu-Duden keinen Einzug gefunden.
 Ich drücke der First Lady auf dem Dorfplatz ein Päckchen des Spitzenproduktes vom VEB Waschmittelhersteller Genthin als erstes Kontaktgeschenk in die Hand.
Ich drücke der First Lady auf dem Dorfplatz ein Päckchen des Spitzenproduktes vom VEB Waschmittelhersteller Genthin als erstes Kontaktgeschenk in die Hand.
"WOK" steht auf der Packung, aber die Frauen können nicht lesen. Die Dame schaut mich fragend an: "OMO!, Madame, en petit cadeau pour vous!" erkläre ich ihr.
Der Gesichtsausdruck erhellt sich augenblicklich. Mit diesem Hilfsmittel verbessert die Hausfrau doch erheblich ihre Chancen, das schneeweiße lange Ausgehnachthemd ihres muselmanischen Gemahls auch wirklich, im trüben Flußwasser, weiß zu bekommen. Dazu schmettert sie es, immer wieder zum Batzen zusammengedrückt, fünfzig Mal auf einen Stein am Flußufer oder in der Regenzeit am Tümpel. Den jüngsten Säugling trägt sie auf dem Rücken geschnürt. Das Kind macht die pausenlosen Auf- und Abbewegungen mit, ohne zu meckern.
Jede Wäscherin hat am Waschplatz ihren eigenen Stein. Den hat sie von der Mutter, und diese von der Großmutter geerbt. Von dem dauernden Beschuß mit der weißen Leinwand ist er schon etwas ausgekehlt.
Wir gehen wieder ströpen. Schauen in die Töpfe auf dem gemeinschaftlichen Kochplatz und probieren uns an der ständig betriebenen Küchenmaschine, dem Mörser. Ich haue probehalber den Stößel auch drei Mal in das Holzgefäß, danach ist fast nichts mehr drin. Das erheitert die Damen wieder enorm.
Zwei Mädels stampfen nach mir wieder im Takt mit den großen und auch schweren Stößelstangen darin herum. Bei denen fliegt nicht eine einzige Nuß aus dem Topf. Mit ihrem Tun stoßen die Mädels die rote Schale von den Palmnüssen ab. Diese Schale ähnelt der unserer Hagebutten nur, daß darunter eine Nuß zum Vorschein kommt, die so ähnlich wie unsere Haselnuß aussieht. Die Palmnüsse werden getrocknet und zur Margarine- oder Palmin-Herstellung verkauft. Die rote Schale wird in einer Erdgrube eingemaischt und riecht dann aus der abgedeckten Grube heraus wie Sauerkraut oder auch Sauerfutter, womit bei uns zu Hause die LPG-Kühe über den Winter gebracht werden.
 Auf schräg gegen die Sonne gestellten Ebenen trocknen winzige Flußkrebse, nur etwa doppelt so groß, wie bei uns daheim die fettesten Wasserflöhe. So habe ich als Bengel früher auch mein Fischfutter getrocknet, nur hier essen das die Leute selbst.
Auf schräg gegen die Sonne gestellten Ebenen trocknen winzige Flußkrebse, nur etwa doppelt so groß, wie bei uns daheim die fettesten Wasserflöhe. So habe ich als Bengel früher auch mein Fischfutter getrocknet, nur hier essen das die Leute selbst.
Wir werden zum Mittagessen eingeladen. "Merci madame", das ist wirklich sehr nett, aber, zu dumm, wir haben keinen Hunger. Aber trotzdem, "merci beaucoup!"
Um nicht in Verdacht zu kommen, mich hier abfällig zu äußern: Wir haben sehr oft von Conakry guinesische Passagiere auf Einladung des Zentralrates der FDJ oder des FDGB mit nach Rostock genommen. Zum Abendessen stand dann gelegentlich unser hoch verehrter Harzer Käse auf der Back. Je zerlaufener, desto schmeckt!
Der Tisch unserer Passagiere war dann stets zu klein, um diese Distanz zu erreichen, in der sie den Stinkerkäse gern von sich geschoben hätten. Ist doch logisch. Wer in der Welt ißt denn sonst noch freiwillig so ein verpestetes Zeug?
Die Frauen versuchen, uns mit kleinen Hühnereiern von ihren Zwerghühnchen einen Gefallen zu tun. Die nehmen wir ihnen natürlich auch nicht ab. Die Leute hier haben doch kaum etwas und müssen für ihren Lebenserhalt ganz schön schindern.
Junge Männer sind in den Dörfern selten anzutreffen. Die arbeiten irgendwo auf "Montage".
Das eine Mal bringt uns der Dorfälteste ein Batterie-gespeistes Radio, das den Geist aufgegeben hat.
Ich untersuche die Kiste und finde einen ‚ab-ben' Draht.
Im Feuer der Gemeinschafts-Kochstelle auf dem Dorfplatz mache ich einen Schraubenzieher aus dem Bootswerkzeug warm und löte damit den Draht einigermaßen wieder an.
Nachdem die Blockbatterie, diesmal richtig gepolt, angeschlossen wird, rauscht es wenigstens wieder in dem Volksempfänger. Aber irgendwelche signifikanten Zeichen kriege ich nicht rein.
Der Häuptling ist dennoch ganz happy und meint, das ist völlig normal, "Radio Conakry" beginnt erst um 16.00 Uhr mit seinem Programm.
Dann ist es so weit, 16.00 Uhr, alle Dorfbewohner umringen das Radio.
Ein pompöses Erkennungszeichen des Senders dröhnt durch den Busch: "Ici Radio Conakry!"
Jetzt bin ich in dem Dörfchen am Ufer des Melacoré der Größte der Welt!
 Wir blasen zum Sammeln, die Ebbe muß gleich einsetzen.
Wir blasen zum Sammeln, die Ebbe muß gleich einsetzen.
Unsere Truppe wandert im geordneten Rückzug zum Fluß hinab.
Alarm! Das Boot ist nicht einsatzfähig!
Bis zum Dollbord wurde die große Barkasse von den dankbaren Dorfbewohnern mit Kokosnüssen zugeschüttet, nicht einmal die Duchten zum Hinsetzen sind freigeblieben. So viel ist dem Dörfchen das nun wieder brauchbare Radio wert. Wir müssen 90 Prozent der Ladung wieder löschen. Bambusstangen liegen auch noch längs über dem Boot, weil sich dafür einer im Dorf interessiert zeigte.
"Keule" Bürgin, der II. Offizier führt das Kommando.
Er flucht wie ein Rohrspatz über den ganzen Plunder, den jeder sonst noch am Mann führt und unbedingt mitnehmen muß, u. a. von zwei Hektar blühendes Grünzeug. Die meterlangen Bambusstangen werden schließlich achtern angebändselt und ins Schlepp genommen.
Diese Ausflüge haben was.
![]() Von Ziegen, Geiern und Kaimanen
Von Ziegen, Geiern und Kaimanen
Heute herrschen besondere Bedingungen auf unserem Bootsausflug. Der Kapitän persönlich ist Expeditionsleiter. Es geht in einen Flußarm, wo wir noch nie waren. Raimonde hat uns schon 4 Jahre lang, Reise für Reise eingeladen, ihn auch einmal auf seiner abgelegenen Plantage zu besuchen. Raimonde ist der jüngste der drei französischen Pflanzer und ein dufter Kumpel.
Wir nehmen Salami und ein paar Schachteln "Radeberger Bier" mit. Den Weg zu Raimondes Wohnsitz haben wir in die Revierkarte eingemalt, um uns nicht zu verfransen. Wir finden uns.
Raimonde haust idyllisch in einem Steinhaus zwischen blühenden Bouganville und Gummibäumen. Sein Herrenhaus steht auf einem Hügel. Daneben ragt ein hoher, verrosteter Mast mit einem Windrad in die Höhe. Mittels dieser Windkraftanlage wurde vor geraumer Zeit zum letzten Mal die Batterie des betagten Dienst-Jeeps geladen, dann gab die Windmühle, wie so vieles im Land, den Geist auf.
Die Autobatterie auch.
Nach dem Begrüßungszeremoniell sticht uns der Jeep ins Auge. Wir bitten um eine Probefahrt.
 "Na klar" meint Raimonde "pas de problem", d.h. zwei kleine Feinheiten sind schon zu berücksichtigen. Der Jeep hat keine Bremswirkung mehr und keine gebrauchsfähige Batterie. Daher darf er nur auf dem Hügel geparkt werden, um ihn während des Herunterrollens anzulassen. Das klappt. Wir hocken mit ca.10 Mann auf dem Geschoß und pirschen los. Der Feldweg hat zwei bauxitrote Fahrspuren. Dazwischen wächst hohes Elefantengras, die Stoßstange drückt es vor uns hinunter. Hinter unserer Fuhre richtet es sich wieder auf.
"Na klar" meint Raimonde "pas de problem", d.h. zwei kleine Feinheiten sind schon zu berücksichtigen. Der Jeep hat keine Bremswirkung mehr und keine gebrauchsfähige Batterie. Daher darf er nur auf dem Hügel geparkt werden, um ihn während des Herunterrollens anzulassen. Das klappt. Wir hocken mit ca.10 Mann auf dem Geschoß und pirschen los. Der Feldweg hat zwei bauxitrote Fahrspuren. Dazwischen wächst hohes Elefantengras, die Stoßstange drückt es vor uns hinunter. Hinter unserer Fuhre richtet es sich wieder auf.
Wir hirschen mit viel Hallo durch das buschige Gelände, in dem Raimonde seine Bananen anbaut. Peter Hallier, der I. Ing. sitzt am Ruder.
Die Aufgabenbereiche der vielköpfigen Jeep-Besatzung sind nicht klar umrissen.
Der Ausguck wird vernachlässigt. Daher werden die Umrisse einer Ziege vor uns auf dem Weg auch viel zu spät ausgemacht. Diese hat mit so einer Verkehrsdichte auch nicht gerechnet und zeigt sich überrascht.
Das Tier ist links am Hang an einem kleinen Busch festgelascht und frißt, mit gerecktem
Hals, auf der anderen Seite des Weges das dort noch verbliebene Gras. Weil sie sich danach recken muß, ist der Strick straff quer über den Weg gespannt.
"Oh Gott", denke ich während der drei Sekunden, die noch bis zum sicheren Exitus der Ziege verbleiben, "jetzt gibt es im Dorf Ziegenbraten, den wir bezahlen dürfen!"
Der Jeep brettert ungebremst gegen den straff gespannten fusseligen Strick der Zicke. Wir drehen uns alle gespannt nach achtern um, während im hohen Bogen der Busch samt Wurzelballen aus der Erde fliegt. Die Geiß reißt es zwar recht heftig von den Hufen, sie kommt aber gleich wieder auf die selben. Ein Schleudertrauma wird sie evtl. als Folgeschaden davontragen.
Wir parken nach dieser schönen Kaffeefahrt den Jeep vorschriftsmäßig auf dem Hügel.
Raimonde hütet schon seit Urzeiten eine Flasche Champagner in seinem Erdbunker.
Er hat aber auch einen Petroleum-betriebenen Kühlschrank. Wir sitzen auf der Terrasse seines Landhauses, blütenumrankt. Ein beeindruckender, blühender Gummibaum beschattet mit seinen fettlaubigen Blättern die Sitzecke. Raimonde läßt den Champagner-Korken knallen. Solche VIP's hat er nicht jeden Tag zu Besuch in seiner Wildnis.
Es tropft mir auf die Knie. Da, schon wieder!
Raimonde geht der Sache nach.
Mit seinem knallenden Champagner-Korken hat er ein Blatt von dem üppigen Gummibaum durchschossen und der ausfließende weiße Latex-Saft beträufelt mich nun dauernd.
Um für meine in Mitleidenschaft gezogene Paradeuniform nicht seine guinesische Haftpflicht-Versicherung zu strapazieren, läd mich Raimonde zur Jagd ein.
Ich verzichte auf eine Schadenersatzklage.
Wir spülen den trockenen Champagner mit ein paar "Radebergern" hinunter und gehen auf die Pirsch.
Raimonde hat ein Jagdgewehr, ich bekomme eine eingeschossige 9-Millimeter-Büchse und ein paar Patronen in die Hosentasche. Der Pflanzer kennt in einem seiner Bewässerungsgräben die Behausung von einem Krokodil. Kaiman heißt diese Sorte hier. Diesem Reptil wollen wir beide jetzt den Garaus machen.
Im gegenüber liegenden Hang des Bewässerungsgrabens ist ein Schlupfloch von der Größe eines Fuchsbaues. Vor diesem werde ich jetzt mit entsicherter Büchse postiert. Raimonde überwindet den Wassergraben und hüpft nun, gegenüber von mir, oben auf der Böschung ganz hektisch auf dem Dach der Kaimanen-Behausung herum. Ich bewundere seinen Mut. Schließlich könnte ich ihm ja, in einer Überreaktion, ein 9-Millimeter-Leck in seine Gummistiefel brennen.
Der Kaiman scheißt uns was! Er läßt sich nicht blicken.
Raimonde beendet unsere Hubertusjagd mit einem Blattschuß auf einen Nackthals-Geier. Diese Vögel hocken mit tropfendem Zahn auf einem trockenen Baum am Fluß und hoffen doch noch auf das Ableben der traumatisierten Ziege.
![]() Keine Leute, keine Leute
Keine Leute, keine Leute
Weihnachten, Silvester und den ganzen grimmigen Winter habe ich prima über die Runden gebracht. Um Weihnachten und Silvester tut es mir nicht sonderlich leid.
Ich habe nie unbedingt geflennt, wenn ich Weihnachten auf See verbringen mußte.
Das wochenlange Haleluja-Gesinge, die Hektik und der Streß vor dem Fest der angeblichen Ruhe und Besinnlichkeit machen mich nach einem überstandenen Landurlaub nach der Weihnachtszeit völlig urlaubsreif.
Jeder Volkskünstler, der einigermaßen gesund husten kann, behauptet alljährlich ab Mitte November: "Leise rieselt der Schnee". Man sollte die schlammigen Weihnachten, zusammen mit den weißen Ostern, zusammen mit dem ersten Mai, gleich hinter Pfingsten legen und den werktätigen Massen eine schöne Frühlingswoche zur Besinnung gönnen und den übertriebenen, heuchlerischen Kommerz dabei heraushalten!
Jetzt ist Frühling. JOHN BRINCKMAN und ich dampfen wieder los. Nicht das ich mich pausenlos darum reiße. Meine Kollegen und ich haben ein jeder Hunderte freie Tage auf dem Urlaubskonto. Ein jeder könnte ohne Ende Urlaub abgelten aber.... keine Leute, keine Leute. Davon natürlich unbeeindruckt schlägt die Stasi dennoch pausenlos zu und kassiert einen Sichtvermerk nach dem anderen.

 Die von der Stasi Verschonten müssen immer aufs Neue die Lücken schließen und fahren ohne Ende und ohne Urlaub. Dann später muß auch ich auf Befehl der Stasi die Seefahrt beenden und meine verbleibenden Kollegen wieder das aufgerissene Loch stopfen.
Die von der Stasi Verschonten müssen immer aufs Neue die Lücken schließen und fahren ohne Ende und ohne Urlaub. Dann später muß auch ich auf Befehl der Stasi die Seefahrt beenden und meine verbleibenden Kollegen wieder das aufgerissene Loch stopfen.
Meine längste zusammenhängende Anmusterung auf MS JOHN BRINCKMAN beträgt 24 Monate und 5 Tage. Danach werde ich am 8.2.65 abgemustert und am 9.2.65, also am nächsten Tag, wieder angemustert. Wieder für 8 Monate und 6 Tage. Urlaub hat nicht geklappt, keine Leute, keine Leute.
Die Funkoffiziere der Reederei sind pausenlos in Einsatz. Wer Urlaub ergattert hat, muß um diesen zittern. Vertretungsreisen in alle möglichen Richtungen heißt da das Damoklesschwert, das über dem Urlaubsplatz schwebt.
![]() Die Orangefarbenen
Die Orangefarbenen
Also JOHN BRINCKMAN und ich wir stechen wieder in See. Um Skagen natürlich, nach Conakry natürlich!
Das Schiff hat am 2. November 1962 Skagen umrundet, da dröhnt um 13.05 Uhr von der dänischen Küstenfunkstelle Skagen Radio ein SOS aus meinem Empfänger: "following received from.... Folgenden Notruf empfangen vom holländischen Küstenmotorschiff RANA.
Position 25 Seemeilen nordwestlich Hanstholm, Schiff macht Wasser, starke Schlagseite, gehen in die Boote.
Da wir vor kurzem Skagen passierten, sind wir annähernd in diesem Seegebiet.
Ich bestätige Skagen-Radio den Empfang dieser Notmeldung. Für alles weitere benötige ich die Entscheidung des Kapitäns. Um diese Tageszeit pflegen Kapitäne zu ruhen, nur Anfänger bezeichnen das als schlafen. Dennoch gilt für diesen Aggregatzustand: "Wecken nur bei Schiffsuntergang oder Gehaltserhöhung!" Ich unterbreche dennoch die Ruhe telefonisch. Der II.Offizier bereitet derweile die Schiffsposition auf und bestimmt die evt. vorzunehmende Kursänderung. Alfred Zimdarß ist I.Offizier. Er kommt zufällig des Wegs und entwickelt augenblicklich die erforderlichen Aktivitäten. Der Kapitän übernimmt jetzt das Kommando auf der Brücke. Der Eins-O bläst an Deck zur allgemeinen Mobilmachung. Wir halten auf das angegebene Seegebiet 25 Seemeilen nordwestlich Hanstholm zu. Die Sicht beträgt nur drei Seemeilen, aber das antike Radargerät funktioniert zufällig.
Nachdem sich der Kapitän zum Eingreifen entschieden hat, melde ich Skagen Radio unsere Aktivitäten:
"We proceed", wir suchen die holländische RANA. Jetzt herrscht auf der Funkwelle absolute Ruhe, kein weiteres Schiff befindet sich im Nahbereich. Nur Skagen-Radio und Delta Charlie Zulu Delta, german JOHN BRINCKMAN tauschen ihre Notmeldungen aus. Funkstellen, die nicht an der Hilfeleistung beteiligt sind, müssen bei Seenotverkehr auf dieser Welle ihre Sender schweigen lassen.
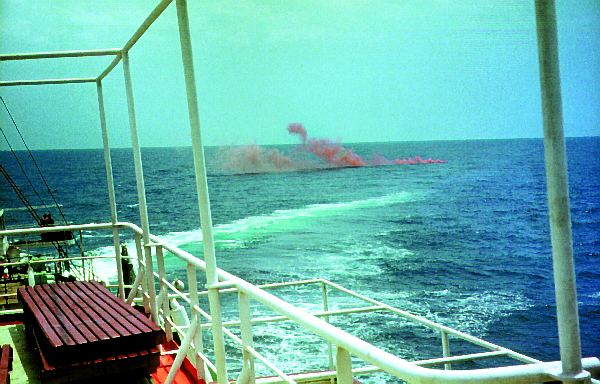 Der Chiefmate läßt an Deck alles, aber auch alles was sich außenbords hängen läßt, ausbringen. Von achtern brummt ein rotes Flugzeug über uns hinweg und dreht leicht nach steuerbord ab. Der Pilot wackelt mit den Tragflächen und läßt eine rote Leuchtkugel fallen. Wir fahren jetzt mit vollster Maschinenleistung dem Flugzeug nach, aber das hängt uns dennoch ab.
Der Chiefmate läßt an Deck alles, aber auch alles was sich außenbords hängen läßt, ausbringen. Von achtern brummt ein rotes Flugzeug über uns hinweg und dreht leicht nach steuerbord ab. Der Pilot wackelt mit den Tragflächen und läßt eine rote Leuchtkugel fallen. Wir fahren jetzt mit vollster Maschinenleistung dem Flugzeug nach, aber das hängt uns dennoch ab.
Schon bald haben wir recht voraus ein Echo auf dem Radar und sehen dann näherkommend das Malheur. Der holländische Kümo RANA hängt mit 60 Grad in einer hoffnungslosen Schlagseite.
In seiner Nähe treibt ein kleines Schlauchboot mit einer Person besetzt, näher zu uns dümpelt noch ein Boot im mäßigen Seegang.
Wir halten auf das Boot zu und fahren die Maschine herunter. Näherkommend zündet das Boot eine orangefarbene Rauchboje.
Wir manövrieren dicht an die Schiffbrüchigen heran, haben deren Boot jetzt 30 Meter an unserer Backbord-Seite, da werfen die Deppen ihre Riemen ins Wasser und können somit nicht einmal die noch nötigen zehn Meter zu uns heranrudern, um ihnen eine Leine zuzuwerfen. Jetzt muß der Berg wieder zu dem Propheten kommen. Beim zweiten Anlauf erwischen wir sie, bzw. ein Leinenwurf glückt. Im Schiff ist noch Fahrt, die Bootsbesatzung belegt die auf
gefangene Leine an einer Ducht (Sitzbank). Das Boot treibt nach achter ab und gerät hinten, in Propellernähe, unter die dort angeschweißten Ösen.
Unser leichter, weißer Schwan dümpelt natürlich auch zwei bis drei Meter in der See und droht das Boot unter Wasser zu drücken. Das Schiff macht noch Fahrt und hat jetzt ziemlich dicht vor dem Steven die schlagseitige RANA zu liegen. Die braucht nur noch einen ganz kleinen Stüber, dann söffe sie ab und wir wären es dann gewesen.
"Maschine zurück" dröhnt es aus der Brücke. "Geht nicht, das Boot ist achtern am Propeller. Wir drehen die sonst durch," ist das Veto vom WO auf der Brückennock. Kapitän Düerkop schwitzt Blut und Wasser.
Das Boot kommt frei, die beiden Propeller ziehen das Schiff zurück und die RANA kann noch zwei Stunden leben.
Der Kapitän der RANA, die einzelne Person im Gummifloß, krabbelt wieder auf seinen havarierten Dampfer zurück. Damit wir uns den nicht unter den Nagel reißen.
Wir ziehen das Boot jetzt ordentlich längsseits und fünf Mann springen schon von zwei Metern Abstand an unsere gut bestückte Bordwand. Die ausgebrachten Netze und Knotentaue bewähren sich jetzt. Es gibt nur einen Rippenbruch.
Alles roger!
Ich hielt die koordinierende Küstenfunkstelle ständig auf dem Laufenden. Jetzt melde ich die Bergung der fünf Leute. Es folgt zwangsläufig die Frage nach der Besatzungsstärke. Ich brülle zum Hauptdeck runter: "Bringt mir mal jemanden hoch!" Der Chiefmate der Holländer kommt, eine Decke umgehängt und einen Topf heißen Tee in der Hand. Der Mann sieht aus, wie ein geschminkter "Oranje"-Fußballfan. Die Jungens haben aus ihrem Boot die orangige Rauchbombe in Luvseite geworfen und sich gleichzeitig auch noch ihrer Ruder entledigt. Nun wurden sie alle rauchumwabert und hatten nichts mehr in den Händen, um diese Misere zu ändern.
Ich interviewe den Mann kurz. Jetzt kann ich der Leitstelle alle Angaben rüberhämmern, die sie benötigt.
Dann versuche ich mit der RANA auf Sprechfunk zu kontaktieren.
Der Kapitän harrt ja nun nach seiner reumütigen Rückkehr dort drüben wieder aus. Ich rufe das Schiff auf Sprechfunk. Der holländische Chiefmate tippt mir auf die Schulter und meint in diesem herrlichen Holländer-Deutsch: "Mötst du nit rufe, der antwortet dich niet. Der dreiht jetzt die Ventilen auf!"
Ich frage den armen Hund, der als einzige Habe sein Seefahrtsbuch in der Jeanshose gerettet hat: : "Wie kam's denn?" Er meint: "Weiß der Teufel wie und warum, aber das Schiff machte Wasser. Wir haben die Luken voller Getreide. Die Schlagseite wird immer größer. Wir pumpen und ackern wie die Kaputten auf dem Schiff. Das gequollene Getreide setzt die Pumpenleitungen dicht. Wir hätten Zeit gehabt das Schiff irgendwie an Land zu bringen. Aber der Alte will nicht.
Jetzt, wo nichts mehr zu machen ist, setzt er endlich ein 'Mayday' ab."
Ich verschaffe dem Holländer eine Telefonverbindung über Scheveningen Radio mit seiner Heimat. So werden dort die Angehörigen ihrer Sorgen entledigt.
Mittlerweile ist Betrieb um uns herum. Ein paar Kampfbleche sind eingetroffen. Die haben ohnehin Langeweile und können sich ja mit dem kapriziösen Alten der RANA amüsieren. Im Gegensatz zu denen, haben wir ja noch was vor.
Ich melde uns bei Skagen Radio ab und wir bekommen ein "thank you for cooperation".
Wir rauschen ab. Die RANA sinkt kurz darauf.
Die fünf Holländer an Bord ballern erst einmal einen und erfreuen sich des Lebens.
Ihr Chiefmate bekommt ein Pflaster auf seine Rippenfraktur.
Dann pennen die fünfe mehrere Runden. Über Scheveningen Radio werden die Übergabemodalitäten ausgekaspert. Das geht reibungslos. Ein Seenotkreuzer der Holländer kommt so weit wie möglich auf unsere Kurslinie bei Hoek van Holland heraus. Die Jungens sind's zufrieden. Blieb ihnen doch gerade noch Zeit, ihren Rausch auszupennen und schwupp, schon sind sie zu Hause. Die fünfe haben uns umarmt und gedankt. Die Reederei der RANA schickt dem Kapitän und der Besatzung später ein Dankschreiben.
![]() Die Fauna von Kassa
Die Fauna von Kassa
Conakrys Tropensonne hat uns wieder. Davon ist reichlich vorhanden, was fehlt sind Bananen im Schuppen.
Wir liegen in der Sonne. Der Einfluß der Botschaft der DDR in Guinea, um dessen Intensivierung die frisch anerkannten Diplomaten täglich verbissen ringen, ist weiter gestiegen. Behaupten die Ringer jedenfalls. Das Ladungsaufkommen, wegen dem wir eigentlich dauernd hierher kommen, hat sich allerdings weiter verringert.
Wir schauen mal wieder drüben auf Kassa nach dem Rechten. Auch auf Roum war ich schon lange nicht mehr. Der Kochsmaat ist Angler. Ich bin Angel-Legastheniker und habe dafür keinen Faible. Der Kochsmaat wirft vor Kassa seine Angel aus. So wie das ein Sportfreund des Deutschen Anglerverbandes der DDR gelernt hat. Die Kollegen Neger sind mit ihren Einbäumen auf diesem Fangplatz ganz heftig am Fischen. Sie befleißigen sich aber einer anderen Fangtechnik.
Unser Angler hat einen Biß nach dem anderen. D. h. ein Baracuda nach dem anderen beißt ihm immer den Fisch ab, den er gerade geangelt hat. Er holt nur geangelte, angefressene Fischköpfe in unser Boot.
Das Knoff-Hoff der Baracuda-Fischerei verschaffen wir uns von den Franzosen.
Storekeeper und I. Ing. bauen das Fanggeschirr.
Wir kreuzen mit unserer Barkasse und unserer Ausrüstung auf dem Fangplatz vor Kassa auf. Verglichen mit den schlanken Einbäumen der einheimischen Fischer, sind wir ja schon ein "Walfangmutterschiff".
Wir verbessern unser Knoff-Hoff durch intensive Beobachtung der Konkurrenz auf den kleineren Einheiten. Der Kollege Neger hat seine Angelsehne um den großen Zeh gewickelt, um beide Hände freizuhaben. Jetzt keult er mit einem Stechpaddel wie ein Wilder los. Je mehr sein Einbaum abzischt, je mehr wirbelt sein Blinker unter Wasser und dem kann dann kaum ein Baracuda widerstehen. Nur das Wegschmeißen des Stechpaddels und der schnellste Zugriff zur Angelleine, erscheint mir hier als echtes Problem. Aber es wurde während unseres Einsatzes auf diesem Fangplatz keinem Kollegen der große Onkel abgerissen. Auch 'Mann über Bord ' wurde nicht beobachtet. Jetzt hauen wir auch unser high-tec-Geschirr achtern raus. Nur muß bei uns niemand manuell loskeulen, wir lassen halt locker den Motor dudeln.
Wir überlisten zwei Baracudas. In Butter gedünstet, el mundo!
Wir dallern auf der Insel Kassa umher.
An dem Badestrand landet ein Einbaum an. Mit vier Mann Besatzung eigentlich überbesetzt. Im Schlepp hat das Boot einen Mordsburschen von Hammerhai.
An der Bordwand steht in säuberlichen Lettern "Quatre moteurs". Mich interessieren die vier Motoren ihres schlanken 5 Meter-Bootes: Die vier Fischer reißen demonstrativ ihr Stechpaddel hoch.
Die vier jungen Männer ringen uns Bewunderung ab. Das Boot hat mit vier Mann besetzt ein Freibord von wenigen Zentimetern. Damit besiegen sie einen drei Meter langen Hammerhai. Diese Körperbeherrschung und den Mut kann nur jemand gebührend würdigen, der die Tücken eines Einbaum's kennt. Ich kenne sie und kann mit den Dingern nicht ‚üm'!
Wir haben es am Melacoré mehrfach versucht und haben uns unwahrscheinlich bescheuert angestellt. Die Susu-Frauen haben dann auf dem Höhepunkt ihrer Heiterkeitsausbrüche eingepischert, wenn wir ihre Gefährte links bestiegen und rechts wieder rausflogen.
Matrose Ali Seliger kommt aus Lübben. Lübben im Spreewald. (Hallo Ali, falls du das hier liest.) "Ali" sagen wir alle unisono, "du kamst doch im Spreewald auf einem Gurkenkahn zur Welt. Du kannst doch mit so einer Möhre hier losziehen." Ali fühlt sich in seiner Ehre gekitzelt. Er hebt den rechten Huf ins Boot, zieht den Linken nach und fliegt prompt auf der anderen Seite in den Schlamm des gerade abebbenden Wassers. Die Schlammspringer und Winkerkrabben stieben erschrocken auseinander.
Die Betreiber dieses Einbaumes aber stehen später zu dritt darin in der Strömung des Flusses und holen ihre Netze ein.
Die vier Fischer des 'viermotorigen' Einbaums am Strand von Kassa schlachten ihre Beute. Gleich hier am Strand. Es ist ein Weibchen. Neun kleine Hammerhaichen werden per Kaiserschnitt tot geboren. Sie gelten als wertlose Innereien und schwabbeln in der Dünung nun den Strand hoch und wieder runter. Einer von uns nimmt sich einen mit und legt ihn an Bord in Spiritus ein. Den kleinen Fisch zieren auch schon vorn am Kopf die arttypischen Tragflächen mit Augen, so wie ein Flugzeug dort Positionslichter führt.
 Schade, daß mit dem großen Muttertier auch noch neun hoffnungsvolle Nachkommen keine Chance mehr bekamen.
Schade, daß mit dem großen Muttertier auch noch neun hoffnungsvolle Nachkommen keine Chance mehr bekamen.
Bei uns keimte in den sechziger Jahren erst langsam das Umwelt- und Artenschutzbewußtsein auf. Einem erlegten Hai hat damals noch niemand eine Messe gelesen. Die reichen Norweger und Japaner tun das heute noch nicht einmal für einen friedfertigen Wal.
Aber mir krampfte sich damals schon das Herz zusammen, wenn ich auf Kassa am Strand die Schleifspuren der Schildkröten sah, die oben am angrenzenden Grün nachts ihre Eier ablegten, die prompt morgens und zu hundert Prozent, von den Fischern wieder ausgebuddelt wurden.
Am Ende des Sandstrandes liegen riesige Klamotten.
Rund und abgeschliffen. Die Eiszeit muß hier früher auch einmal reingeschaut haben. Obersteward Charlie Dürr, der schon in Kuba den Seeigel breitgelatscht hat, gefährdet auch hier den Fortbestand bedrohter Tierarten.
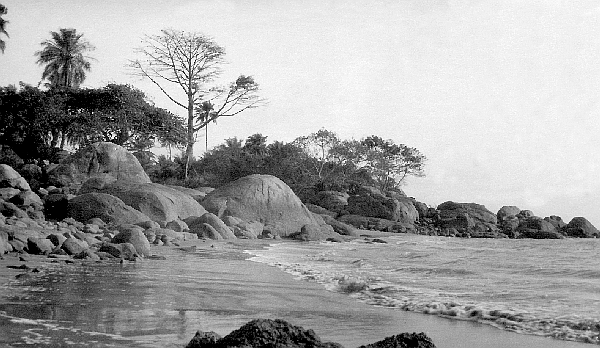 In einer Höhle zwischen den großen Steinen hängt eine Traube aus irgend etwas.
In einer Höhle zwischen den großen Steinen hängt eine Traube aus irgend etwas.
Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, obduziert er das Gebilde.
Um uns bricht die Hölle los. Die Viecher sind drei Zentimeter lang, haben vorn einen schlanken Kopf, einen dicken Mors, und nur einen hauchdünnen Faden als Taille.
Ich lasse meinen Fotoapparat schnell auf einen Stein fallen und mich selbst stehenden Fußes in den Bach.
Haie oder Wespen, das steht hier zur Auswahl. Wir haben schon X-Mal in dem trüben Gewässern um die Inseln herum gebadet. Nur jetzt, wo wir zum ersten Mal sehen, daß die Hammerhaie dort gleiches tun, keimen uns leichte Bedenken auf.
Auf den späteren Reisen siegen dann aber wieder die Badefreuden über die Bedenken.
![]() Im center court gegen "Wacker Benti"
Im center court gegen "Wacker Benti"
Wir versegeln nach Benti und sollen danach wieder nach Conakry zurückkehren. Das ist eine ganz neue Variante. Es schiffen sich die Diplomaten ein. Seemännisch gesehen, nicht urologisch. Die Leute sind nun schon vier oder fünf Jahre im Land und kennen davon außer Conakry nichts. Sie dürfen die Stadt so ohne weiteres nicht verlassen.
Wir nehmen vier DDR-Repräsentanten an Bord und den Tschechischen Botschafter nebst Gemahlin. Die Tschechen sind in Ordnung.
Das von uns in Benti infiltrierte kulturelle Leben gipfelt während dieser Hafenliegezeit in einem Fußballspiel. Wir haben Reisen vorher schon gegen "Wacker Benti" gespielt und hatten immer mächtig zu knacken. Wir, im out-fit wie die Stars von Benfica Lissabon, "Wacker Benti" in zerlumpten Hosen und barfuß. Wir haben ihnen nach unserem ersten Länderspiel unsere Dresse geschenkt und uns von der Reederei aus dem K&S-Fonds neu ausstaffieren lassen. Jetzt laufen beide Mannschaften auf wie bei einem Kontinente-Vergleich: Afrika gegen Europa. Selbst auf "Schalke" träumt man heute von so einer Zuschauerkulisse. Von etwa dreihundert Einwohnern sind wieder dreitausend gekommen. Nur der 'center court' läßt noch Wünsche offen. Rasenheizung ist nicht erforderlich. Aber der Sturzacker ist ziemlich stark geneigt, also nicht eben. Das eine Seitenaus liegt auf dem Berg, das andere demzufolge im Tal. An dieser Seite versucht auch ständig das Gesträuch über die nicht näher markierte Seiten-Linie hereinzuwuchern. Wenn der Ball in dieses Seitenaus fliegt, muß man zum Wiederauffinden sehr lange suchen und dabei die Schlangen nicht außer Acht lassen.
Ich stehe im Tor der Europaauswahl. Das habe ich schon für den TSC Wustrow als Student gemacht. In "Knochen"- Ewert's Mannschaft mit Hein Meier und Hanning Zemplin.
Das Tor im Zentralstadion von Benti ist eine gewagte Bambuskonstruktion in lockerer Lianenverbundbauweise.
Als ein Ball gegen die obere Bambuslatte knallt, fliegt die Kiste erst einmal um.
Die weiblichen Zuschauer haben oben auf dem Berg die Beine verschränkt, damit sie bei ihren Heiterkeitsausbrüchen nicht zu dolle einpischern.
Monsieur Moreau, der französische Pflanzer ist Sponsor, Präsident und Trainer von "Wacker Benti". Heute fungiert er auch noch als Schiedsrichter.
Wir einigen uns bei der Affenhitze auf eine Spielzeit von zwei mal fünfundzwanzig Minuten, sonst gehen wir ja konditionell völlig hoffnungslos krachen. Der parteiische "Schiri" läßt aber unwahrscheinlich lange nachspielen.
"Schweinchen", der beleibte Bootsmann, hat während des Spiels 13,5 Liter Wasser verloren.
Außer viel Flüssigkeit haben wir auch das Spiel verloren.
Das spielt aber in sofern keine Rolle, weil das ganze Weibervolk am Rande des Spielfeldes, das da keift und kreischt, daß es bis Kapstadt zu hören ist, nicht die Bohne einer Ahnung hat, worum es auf dem Sturzacker überhaupt geht. Wenn ein Blaßgesichtiger sich ordentlich hinpackt, ob nun mit, oder ohne Feindeinwirkung, spielt keine Rolle, dann bricht der Jubel von den Rängen. Und das macht hier den eigentlichen Schauwert eines Fußballspieles aus.
Ich verletze mich bei meinem Torwart-Engagement am Knie. Eine ziemlich großflächiger Tapetenschaden.Vorerst regelt Peter Erbstößer das wieder in seiner Bordpraxis. Monsieur Moreau lädt abends zum Diplomatenempfang. Er bewohnt am 'Stadtrand' von Benti ein Steinhaus und wenn er will, kann er mit einem Dieselgenerator auch elektrischen Strom herstellen. Wechselstrom, brennt, brennt nicht, brennt....
Wir finden seine Benzinlampen besser, da stellt er den knattrigen Diesel draußen wieder ab.
Zur Ausgestaltung der schönen Party hat das Schiff mit Naturalien natürlich kräftig beigetragen, aber der Pflanzer besticht uns mit seinen Naturprodukten. Sein Boy verabreicht uns eine Erdnuss-Soße und eine Zwiebelsuppe, dazu ein französisches Baguette a la bonheur. Auch ein kaltes Buffet ist im Angebot, belegte Baguette-Scheiben. Die meisten Belege kennen wir, sie stammen aus unserer Proviantlast. Aber eine ganz vorzüglich mundende Pastete ist neu. "Erbse" und ich, wir baggern uns gerade genüßlich durch die Brötchen mit der Pastete, da tritt Monsieur Moreau hinzu und meint: "Cela serpent pithon" und grinst ganz hämisch. "Das ist Python-Schlange, hat-ta g'sagt Erbse" sage ich. " Na und, schmeckt doch", sagt der und verdrückt das letzte Brötchen aus dem Angebot.
Nach 23.00 Uhr wird's schweinisch gemütlich, da hauen die Diplomaten ab. Wir tanzen mit Raimonde "French Can-Can"."Ohne Hosen", schlägt Moreau vor.
Mit meinem verbundenen Knie kann ich der Choreografie aber nur unvollkommen folgen.
Monsieur Moreau, der Schelm, hat seinem Boy die Frau abgekauft. Das ist ein recht hübsches Persönchen mit hellerem Teint und langen Haaren, nicht nur die kleinen landesüblichen Lockenkringelchen auf dem Kopf. Einer ihrer Ur-Opas war wohl ein Blaßhäutiger. Dementsprechend teuer war die Dame auch. Er mußte fünfunddreißigtausend Franc guineé den Brautwerbern in den Rachen werfen. Ich rechne schnell in die uns geläufigere "Schilkin-Wodka-Währung" um. 2,46 Mark pro Flasche gleich tausend Franc. 35 mal Zweimarkfünfzig = knapp 90 DDR-Mark. Dafür hätte sie ein jeder von uns auch gerne gekauft!
Nur aus Sicht der Susu ist das ein stattliches Vermögen.
Sie wissen doch 33 Franc Stundenlohn!
Der Boy wird mit dem lukrativen Erlös aus dem Verkauf seiner Ex-Frau nicht lange Single bleiben, kann er sich doch jetzt mindestens drei taufrische neue Gemahlinnen zulegen und die müssen dann für ihn nicht nur nachts arbeiten! Die Leute hier sind Moslems. Die Gepflogenheiten der Muselmänner sind für die Muselfrauen nichts Außergewöhnliches.
Im Prinzip hätte ich gegen die Einführung dieser schönen Verfahrensweise bei uns zu Hause auch nichts einzuwenden. Sehr praktisch, finde ich!
Wir versegeln zurück nach Conakry.
Mein in Benti abgeschürftes Knie suppt und sieht nicht sehr appetitlich aus.
Die Diplomaten fahren auch mit uns zurück zu ihrer Residenz. Der Kapitän haut sie bezüglich meines lädierten Knies an, zwecks einer ärztlichen Versorgung im renommierten hauptstädtischen Krankenhaus Conakry-Donka.
Ich hätte diese Leute nie angebettelt!
"Aber natürlich, ist doch selbstverständlich" beteuert der ranghöchste Diplomat ganz diplomatisch "nur, na ja unser Fuhrpark, also momentan, muß das gleich sein...?
Der tschechische Botschafter legt mir die Hand auf die Schulter. Er spricht perfekt deutsch: "Ich fahre sie hin. Nur muß ich schnell meine Frau nach Hause bringen. In 30 Minuten bin ich zurück und hole sie."
Ein jeder der Deutschen wird von seinem Fahrer abgeholt.
Der große schwarze tschechische Tatra fährt bald darauf wieder vor die Gangway. Der Botschafter chauffiert eigenhändig. Wir fahren nach Donka. Am Schildhäuschen vor der Schranke baut der guinesische Wachposten ein gewaltiges Männchen. Der schwarze Tatra trägt ein "CD"- Kennzeichen und den Stander.
Der Tscheche fährt neben den Treppenstufen des Haupteingangs dicht an das fünfstöckige Gebäude heran. Hier stände der Wagen auch im Schatten. Wir wollen gerade aussteigen, da trommelt es auf dem schwarzen Autodach. "Oh weh, schütten sie wieder alles aus dem Fenster" sagt der Diplomat und steckt den Zündschlüssel wieder in das Schloß. Er verholt den dicken Dampfer unter die Palmen auf dem vertrockneten Rasen gegenüber dem Hauptportal.
Wir betreten das Krankenhaus.
Ich bin schockiert. Allerorts, auf Treppen und Fenstersimsen, hocken fliegenumschwirrt Menschentrauben, Kranke, furchtbar Elende, aber auch deren Besucher und Angehörige, die ihren kranken Familienmitgliedern hier das Essen bringen. Eine Verpflegung seiner Patienten bietet das Krankenhaus nicht. Vor den Behandlungszimmern und Krankensälen gibt es keine Türen, nur Vorhänge. Die sind aber meist nicht zugezogen. Auch Fensterscheiben sind nicht vorhanden. Grobe Jalousinen-Bretter sind beweglich gegen die Sonneneinstrahlung verstellbar. Gegen Moskitos, Fliegen und Ungeziefer ist anscheinend kein Schutz vorgesehen.
Die Ärzte dieses Krankenhauses sind, bis auf zwei, sämtlich Ausländer. Die revolutionäre Volksrepublik Guinea verfügt über zwei einheimische Ärzte. Während der Hafenliegezeit des Lazarettschiffes MS HOPE waren diese die Alleinberechtigten zur Ausstellung einer Überweisung auf dieses Schiff. Dafür hatte der Kranke dann die zehntausend Franc zu bezahlen. Für den Ärztemangel ist die vormalige französische Kolonie sicher nicht allein verantwortlich, aber von der UNO kostenlos erbrachte Heilbehandlungen kapitalbildend auszunutzen, das ist schon mehr als pervers.
Der tschechische Botschafter bringt mich in den fünften Stock zu Doktor Konetschny, einem Landsmann von ihm. Doktor Konetschny leitet die Kinderabteilung und spricht ebenfalls hervorragend deutsch. "Meine Tante stammt aus Brünn, Herr Doktor, die heißt auch Konetschny" beginne ich den Dialog.
Der Doktor betrachtet mein Rummenige-mäßiges Fußballerknie. "Haben sie eine Tetanusimpfung?" fragt der Doktor als erstes. "Sie können es ruhig sagen und vor meiner Spritze keine Angst haben, ich habe nämlich kein Serum."
Und ich keine Tetanus-Impfung.
Einen Verband hätte der Arzt, aber er macht sich auf die Suche nach etwas anderem.
Ich unterhalte mich unterdessen mit seinem Landsmann. "Wissen sie", sagt der Botschafter
"in diesem Krankenhaus herrschen schlimme Zustände. Es mangelt an allem. Dem Doktor hier sterben auf seiner Kinderstation im Durchschnitt täglich sechs Säuglinge und er hat keine Möglichkeiten etwas dagegen zu unternehmen."
"Der traurige Anblick auf dem Weg hierher", sage ich "hielt mir ja schon das Leid in diesem Hause vor Augen. Noch dazu, wo es sich um die renommierteste Gesundheitseinrichtung des Landes handelt."
Doktor Konetschny kommt zurück. Bei einem befreundeten Arzt hat er sich im dritten Stock eine kleine Tube Salbe ausgeborgt. Davon schmiert er mir etwas auf meine Verletzung, dann drückt er mir die schon arg ausgeknitschte kleine Tube in die Hand: "Das ist Penicillin-Salbe. Damit bestreichen sie noch zweimal dünn ihre Verletzung und bringen mir die Tube wieder. Nicht vergessen!" Der Botschafter gibt seinem Landsmann für die Rücklieferung sein Diplomaten-Ehrenwort und bringt mich zurück zum Schiff.
Meine nässende Abschürfung verheilt jetzt gut. Vor dem Auslaufen des Schiffes kommt ein Mitarbeiter der tschechischen Botschaft zwecks Rückführung der Salbe. Ich hätte gerne eine große Tube dieses Heilmittels beigefügt aber 1965 gehört diese Rarität auch nicht zum Bestand unserer Schiffsapotheke.
![]() Bananenstauden, Schlangen, Tausendfüßler
Bananenstauden, Schlangen, Tausendfüßler
Das im vorherigen Hafen angeladene Schiff bringt während des Abgammelns im nächsten Ladehafen den Kapitän immer in mächtige Schwulitäten.
Der Wartezeit sind reifetechnische Grenzen gesetzt. Schließlich lohnt es sich nicht, in Conakry endlos auf das Eintreffen von weiteren 150 Tonnen Bananen zu warten, während in den Luken die 200 geladenen Tonnen aus Benti schon anfangen zu rauchen.
Der Buschfunk funktioniert nur in Benti so hervorragend.
In Conakry weiß in der Regel keiner, wo sich der angekündigte Bananenzug überhaupt befindet. Ob er sich verfahren hat, oder in der Regenzeit wegen unterspülten Gleisen den Bahndamm hinabgepurzelt ist.
Während der neuntägigen Heimreise wird unsere Ladung dann täglich gewissenhaft auf den Reifezustand der Früchte kontrolliert.
Die Fruchttemperatur wird mit einem Einstichthermometer gemessen. 11,5 Grad Celsius ist die Wohlfühltemperatur einer grünen Banane. Unter 10 Grad wird sie schwarz und nicht mehr reif.
Die Früchte kommen meist auf 28 Grad Celsius hochgepowert in die Laderäume. Angenommen dreitausend Tonnen würden, wie es sich gehört, in 24 Stunden in die Laderäume verbracht, dann ist schon ein imenser Energieaufwand erforderlich, so eine aufgeheizte Masse von 28 auf 11 Grad abzukühlen. Der Stern knallt ja auch noch mit 60 Grad auf Oberdeck und Lukendeckel.
Mit Rainer Schulz, dem III.Offizier, robbe ich sehr oft auf Schnuppertour durch die einzelnen Decks, in Wattekombi und Helm, wie ein Bergmann bei einer Stollenhöhe von ca. 80 cm.
Die harten Strunkse der Stauden drücken auf die Knie. Wir transportieren ja die Stauden im Ganzen. Die altmodische horizontale Kühlung des Schiffes kommt mit Kartonware nicht klar, falls es Kartons in Conakry gäbe.
Bei diesen Kontrollgängen ist die Nase das wichtigste Utensil. Selbst eine leicht gelblich angelaufene Banane ist auf dem Überseetransport etwas ganz Unwillkommenes. Sie muß herausgerochen werden. Wird eine Staude gelb, entwickelt sie bei der Reife CO2. Das ermutigt sofort die Nachbarstauden, auch schnell reif zu werden. Also wehret den Anfängen. Im fortgeschrittenen Stadium zerrt man dann aus der Mitte eines solchen Nestes einen Triefsack heraus. Ein evt. schon durchnäßtes triefendes Paket. Dann wird in harter aufwändiger Knochenarbeit der ganze Reifeherd ausgeräumt. Auch Früchte, die nur leicht gelb angehaucht sind, fliegen dann außenbords. Das Herbste, was ich auf 46 Conakry-Reisen erlebte, waren 1220 geworfene Stauden Bananen.
36 Tonnen aus der Enge der Räumlichkeiten an Deck ziehen, erfordert eine Generalmobilmachung der gesamten Besatzung unabhängig von Rang und Person.
Auf der Heimreise liegen auf den Luken die schönsten reifen Früchte zentnerweise. Die Affen und die Passagiere essen davon, von der Besatzung nur Neueinstellungen.
Wir schlagen den Verantwortlichen in Rostock vor, die letzte Charge der herausgeräumten Bananen nicht in die Biscaya oder noch in den englischen Kanal zu werfen, sondern auf der Luke liegen zu lassen. Sofort nach dem Festmachen in Rostock könnten die dann per LKW an Altenheime, Kindergärten, Krankenhäuser oder ähnliche Einrichtungen verteilt werden.
Dieser Vorschlag scheitert am Veto der Zollverwaltung. Bevor der LKW-Fahrer, nur zum Beispiel, seine reife Bananenladung in einem Kindergarten abkippt, könnte er sich ja eine ganze Staude Bananen zum Eigenbedarf unter den Nagel reißen. Auch könnte, nur zum Beispiel, die Stationsschwester im Krankenhaus gleichfalls fünf Bananen selbst aufessen.
Das darf nicht sein!
 Wir werfen weiterhin Hunderte Stauden noch im englischen Kanal außenbords und hinterlassen eine Spur wie ein Minenleger, jede halbe Kabellänge schwimmt eine Staude Bananen samt Reisstroh und Packpapier.
Wir werfen weiterhin Hunderte Stauden noch im englischen Kanal außenbords und hinterlassen eine Spur wie ein Minenleger, jede halbe Kabellänge schwimmt eine Staude Bananen samt Reisstroh und Packpapier.
Bei dem Herumgewühle in den Bannen spielt die Begegnung mit der Bananenschlange eine gewisse Rolle. Mancher hat auch Respekt vor Spinnen. An jedem Lukeneinstieg sind daher in Apothekenkästen Injektionsspritzen mit dem Gegengift für den Biß der Mamba angebracht. Die Beschaffung dieses Serums stellt die Reederei vor ewige Schwierigkeiten. Der Alleinhersteller ist das Pasteur-Institut in Paris. Hat die Reederei eine frische Lieferung des teuren Zeugs besorgt, muß sie dem Schiff irgendwo zugestellt werden, dann ist oft das Verfallsdatum schon nicht mehr weit weg. Das Schlangenserum hat nur eine Frischegarantie für ein halbes Jahr.
Nach dem Biß der schwarzen Mamba bleibt dem Betroffenen noch eine Lebenserwartung von etwa fünf Minuten. In dieser Zeit muß der zweite Mann aus dem Bergwerkstollen zum Lukenausstieg robben, die Eisenleiter hinaufsteigen und mit der rettenden Injektionsspritze den gleichen Weg zurücklegen. Dort muß dem Gebissenen rund um die Beißstelle(!) das lebensrettende Gegengift injiziert werde.
Höchstwahrscheinlich spürt er die unsachgemäß gestocherten Spritzen dann schon nicht mehr.
Das Serum wurde nicht gebraucht. Wir fanden eine schwarze Mamba in der Ladeluke, aber die war vor Kälte schlotternd selber froh, daß sie keiner beißt. Eine zweite allerdings hüpfte ganz agil an Deck herum, als wir eine Decksladung Bananen mit einer Netzbrook in Dakar an Land setzten.
Was uns allerdings stets auf's Neue erschrecken läßt, sind die stattlichen Exemplare von Tausendfüßlern. Die bringen es auch locker auf eine Länge über alles von 25 cm. Zusammengerollt imitieren sie dann auch beim flüchtigen Hinsehen eine Schlange. Den größten Effekt erzielte so ein Lindwurm frühmorgens auf dem Teppich vor meiner Koje.
Den habe ich zusammen mit acht Eimern afrikanischen Mutterboden in meine tropisch grüne Blumenbank umgesiedelt. Nachts ist er dann herausgekrochen und hat sich auf meinem Teppich unter der Klimaanlage 1000 kalte Füße geholt.
![]() Jah so, crocodiles
Jah so, crocodiles
Conakry und der leere Bananenschuppen haben uns wieder. Mich nunmehr schon zum paarundvierzigsten Male.
An der Querpier liegt ein norwegisches Fruchtschiff.
Das ist selten, daß außer den zwei sowjetischen Fruchtschiffen KURA und ARAQUI und FRITZ REUTER und JOHN BRINCKMAN noch jemand hier Bananen aufstöbern möchte.
Ich gehe am späten Nachmittag an Land und möchte im Postamt nachsehen, ob die Republik Guinea neue schöne Briefmarken herausgegeben hat. Manchmal hat sie das.
Am Hafentor verhandeln drei Seeleute mit dem Wachposten.
Die drei Norweger möchten an Land gehen, die Wache läßt sie nicht passieren. Die Torwachen stellen ihre Argumente in französisch dar, die Norweger diskutieren in englisch. Keiner versteht vom Anderen ein Wort. Einer der Landgänger hält dem kommandierenden Torwächter ständig ein paar winzige Fusselchen unter die Nase. Als ich mich gerade an der Diskussionsrunde vorbei drängen will, höre ich die englisch vorgetragenen Argumente. Der Seemann behauptet, er hätte seine Jeanshose gewaschen und mit dieser auch sein Seefahrtsbuch. Die Fusselchen, die er dem Kommandanten nun zur ständigen Besichtigung unter die Nase hält, das seien nun die Reste seines Ausweisdokumentes.
Ich kriege das Grinsen und biete den Norwegern meine Dolmetscherdienste an.
Ich übersetze den ganzen Quatsch, den der Landgänger dem Wachposten unter den Troyer jubeln möchte. Die Hafenwachen grinsen zwar auch, sie stellten dem Seemann aber einen "zeitlich begrenzten Landgangsschein" aus. Jetzt können die drei an Land gehen. Zwei von ihnen haben ja Seefahrtsbücher. Nun frage ich den Kumpel: "Was ist denn das für ein Käse, den du da der Behörde untergejubelt hast? Dieser Fingernagel voll Taschendreck ist doch nicht dein gewesenes Seefahrtsbuch!" Die beiden anderen Norweger, ein nautischer und ein technischer Offizier, zeigen mir ihre grünen "Seefahrtsbücher" Ich lese: "Norske Fohrerkort" und lache mich scheckig. Sie sind mittels ihrer norwegischen Fahrerlaubnis an Land gegangen und erklären mir die Situation: "Der da, ist unser Obersteward, und Ire, nicht Norweger. Eine Fahrerlaubnis hätte der zwar auch, aber die ist rosa. Mit zwei grünen und einem rosafarbigen Passport riechen die am Tor doch gleich Lunte. So hat sich die ganze Besatzung auf grüne Fahrerlaubnisse geeinigt." "Und warum geht ihr nicht mit einem richtigen Seefahrtsbuch an Land, wie jeder ehrenwerte Seemann auf dieser Welt?" frage ich nun. "Die hat unser Alter weggeschlossen, damit ihm keiner von uns achteraus segelt!" klärt sich nun endgültig die nebulöse Situation. "Aha" sage ich "dann dient ihr auf so einer Art Seelenverkäufer."
Die Norweger haben vor dem Hafentor einen Leihwagen stehen. Wo man ein Auto herbekommt, haben sie herausgefunden, wo aber ansonsten etwas abgeht in der Landeshauptstadt, wissen sie nicht. Sie sind zum ersten Mal hier. Ich dagegen stehe mit meinem vierzigsten Besuch dieser Stadt kurz vor der Anerkennung zum Ehrenbürger. Die drei Amüsierwütigen zerren mich als Stadtführer mit. Wir tingeln von einem 'Nobelschuppen' zum anderen, mehr als drei sind das nicht. Im Palmengarten des "La Payote" ist ganz vornehmes 'dancing'. In einem gemauerten Springbrunnen langweilen sich etliche Kaimane.
"Jah so" sagt der Norweger "crocodiles" Er springt über die Brüstung und marschiert mit hundert Zentimetern Kaiman am gestreckten Arm zwischen die Tanzenden.
Furchtbar vornehme Ladys der guinesischen besseren Gesellschaft wackeln sehr rhythmisch dort im Takt der Tam-Tams mit sämtlichen Popos. Sie sind in sehr weit geschnittene glitzernde Gewänder gehüllt.
Die Damen flüchten zuerst.
Der Kaiman strampelt mit den kurzen Beinchen und versucht den Kopf zu heben.
Ich tue mein Möglichstes.
Drei Kellner nehmen auch allen ihren Mut zusammen. Der Norweger klatscht das Tier zu den übrigen zurück.
Ich glaube, der Kapitän hat seine Gründe, die Pässe dieser Truppenteile unter Verschluß zu halten.
Spät in der Nacht fahren wir mit dem Auto zurück. Nachts durch Conakry zu fahren ist ein besonderes Erlebnis. Nach Landessitte wird der Blinker generell nicht betätigt. Meistens ist auch bei noch neuen Autos die Lichterführung rundherum ohnehin schon zerbröselt. Dennoch wird stets gewissenhaft eine Fahrtrichtungsänderung angezeigt. Dazu legt beim beabsichtigten Rechtsabbiegen in der schwarzen Nacht, der Fahrer seinen schwarzen Arm auf das schwarze Mercedesdach. Beim beabsichtigten Linksabbiegen hängt der Arm an der Fahrertür betont lässig herab. Das Beachten solcher Signale ist sehr gewöhnungsbedürftig.
![]() "Wer frißt dich denn?"
"Wer frißt dich denn?"
Wir fahren mit dem Boot rüber zu unseren Inselparadiesen. Es ist noch früh am Tag. Als wir mit der Barkasse um die schützende Insel Kassa fahren, empfängt uns die offene See mit einer ordentlichen Brise. Eigentlich wollen wir nach weit draußen zur Insel Roum. Das Boot übernimmt heftig Spritzwasser. Einer ist ständig am auspützen. Die See kommt schräg von vorn. Nun getrauen wir uns in den Wellenbergen nicht mehr zu wenden. Also durch!
Von den Einbäumen ist jetzt keiner unterwegs. Ziemlich durchnäßt erreichen wir den Windschutz der Insel und kommen mit dem Boot auch sicher durch die Brandung. Auf den Felsen am Strand flitzen schöne bunte Geckos umher. Auf den kleinen Freiflächen grasen ein paar Ziegen. Ansonsten überwuchert die Insel eine üppige Vegetation. Wir erforschen alles ganz eingehend, da trampelt einer durch den Busch. Zu sehen ist nichts, aber es knackt und prasselt. Dann kreuzt ein Krokodil unseren Trampelpfad und straft uns mit völliger Nichtachtung. Es ist ein Waran, so ca. eineinhalb Meter lang. Wir lassen ihm die Vorfahrt. Mich reizt es, ihm am Schwanz zu zupfen. Reisen vorher, begegnete ich auf meinen Forschungsstreifzügen einer größeren Python. Danach ringelte sich eine grüne Mamba einen Palmenstamm empor. Als ich näher trat, um sie zu fotografieren, ließ sie sich auf den Boden ins Gras fallen. Da zog ich mich dann lieber diskret zurück.
Das ist natürlich alles nicht so atemberaubend. Aber für mich als Seemann, ohne Buscherfahrung, ist das die ersten Male doch beeindruckend. Nach den späteren Reisen laufen die Spaziergänge im Busch dann cooler ab.
Mit zunehmender Sonneneinstrahlung beruhigt sich die See. Jetzt keulen auch wieder die Baracuda-Angler mit ihren Einbäumen los, um ihre Blinker zum Wirbeln zu bringen. Unser Wahlfangmutterschiff mischt nun auch auf dem Fangplatz mit. Wir schleppen in Richtung Kassa und legen auf der Insel eine Picknick-Pause ein.
Dort sind die Werftingenieure gerade dabei, einen neuen Einbaum anzufertigen.
 Das Boot ist fast fertig und sehr gut gelungen. Es hat rundherum nur eine Stärke der Bordwand von ca. zwei Zentimetern. Das ist für eine Axt schon Filigranarbeit. Würde in der Endphase ein Axtschlag zu heftig ausgeführt, haut dieser ein Loch in die Außenhaut. Das schöne Boot wäre unbrauchbar und monatelange Arbeit umsonst.
Das Boot ist fast fertig und sehr gut gelungen. Es hat rundherum nur eine Stärke der Bordwand von ca. zwei Zentimetern. Das ist für eine Axt schon Filigranarbeit. Würde in der Endphase ein Axtschlag zu heftig ausgeführt, haut dieser ein Loch in die Außenhaut. Das schöne Boot wäre unbrauchbar und monatelange Arbeit umsonst.
Die Bootsbauer erhitzen an einem offenen Feuer kopfgroße Feldsteine. Die verkohlen dann in dem ausgehöhlten Baumstamm das harte Tropenholz, das sich so leichter aushacken und glattschaben läßt.
Unsere Bootsbauer keilen gerade Stützstreben zwischen die beiden Bordwände, damit sich ihr fast fertiges Werk bei den Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen nicht verwirft.
Ich ärgere mich heute noch, daß ich in Guinea nicht feilschenderweise einen Einbaum erworben habe.
Damit hätte ich doch auf der Warnow den absoluten Chef gemacht. Nur hätte ich in Benti vorher ein Trainingslager absolvieren müssen.
Wir fahren von Kassa zurück zum Schiff, ziemlich spät dran, es war wieder so furchtbar interessant.
Nachdem wir die letzte Landzunge von Kassa umrunden, haben wir in drei Meilen unseren
weißen Schwan vor uns auf Reede liegen. Die beiden Forellemotoren schnärpseln recht munter. Wir passieren einen dicken schwimmenden Bambus-Knüppel. Rumms, beide Motore schweigen augenblicklich. "Was ist Peter, Motorschaden?" frage ich den I. Ing. Peter Hallier. "Doch nicht beide zur gleichen Zeit, du August!"
Der neben uns vorbeitreibende Bambusstamm war die Aufhängung und Markierungs-Boje eines Fischernetzes. Dieses haben wir nun in einem riesigen Fitz in beiden Propellern der Außenbordmotoren. Ein Matrose holt schon mal Hand über Hand das Netz innenbords. Fische zappeln darin. Das Netz hat kein absehbares Ende.
Drei Mann fitzen hinten an den dicken Nylonfäden des Fanggerätes. Diese haben sich unheimlich fest um die Propellerwellen gewurschtelt.
Die Sonne geht unter.
Die Dämmerung setzt schnell ein. Uns umringen murmelnd schwarze Einbäume, schwarze Fischer mit schwarzen Stechpaddeln.
Wir werfen den schon eingeholten Ballen Netz samt der darin zappelnden Fische wieder außenbords und zerschneiden mit einem Messer das Netz, das sich unlösbar fest um unsere Propeller genudelt hat. Je ein Mann wird als Sicherheitswache eingeteilt, damit wir von den zu erwartenden Stechpaddel-Attacken nicht völlig überrascht werden. Einen Motor bekommt die Technik wieder zum Laufen und wir schlagen uns schleunigst in die Büsche.
Wir waren am Morgen mit dem Boot wieder aufgebrochen wie die Frisöre. Das Boot hat keine Sprechverbindung zum Schiff, auch keine Lampe. Als wir im Fischernetz festkamen, haben wir einen triefend nassen alten Feudel ausgewrungen, ihn mit Benzin getränkt und angezündet. Auf dem Bootshaken geschwenkt, sollte er dem Schiff signalisieren, daß wir noch vorhanden sind.
An Deck gehen alle Lampen an, Bootsmanöver!
Auch das noch, jetzt kommen die uns holen. Bootsmanöver auf MS JOHN BRINCKMAN ist ein besonderer Akt und schwere Handarbeit. Die Sorte Aussetzvorrichtungen wurde schon zur Zeit des Pyramidenbaus auf den Nilschiffen durch modernere Technik verdrängt..
"Keule" der II. Offizier ballert mit dem schweren Rettungsboot mit Volldampf auf uns zu. Wir wackeln wieder mit unserem brennenden Feudel. "Keule" findet uns und passiert uns in zehn Meter Abstand. Er meldet mit seinem Walky-Talky Vollzug: "Die Barkasse ist gefunden."
"Du Knaller", belegen wir ihn hinterher an Bord. "Die Barkasse ist gefunden. Wir waren guter Dinge und hielten wacker auf den Dampfer zu. Du hättest ruhig mit deinem Hobel zu Hause bleiben können!"
Keule hat uns also gefunden, stellt fest, daß wir auch Fahrt machen und setzt nun seinerseits zu einem großen Drehkreis an, um wieder auf Kurs zu seinem Mutterschiff zu kommen. Rumms, jetzt herrscht bei diesem Boot augenblicklich Stille. Wir kuppeln unseren Motor aus. Ich rufe rüber: "Keule, ist was?"
"Wir sitzen in einem Fischernetz!" hallt es über See durch die Finsternis.
"Was denkst du denn, wo wir die ganze Zeit waren", rufe ich zurück.
Na, dann haben wir ja Glück. Wenn die ausgesandte Suchexpedition in den gleichen Hinterhalt tappt, dann können wir ja auf mildernde Umstände hoffen.
Wir gehen bei unseren Lebensrettern längsseits. "Habt ihr mal ein Messer?" ist deren erstes Hilfeersuchen. Sechs Matrosen an Bord, keiner hat ein Messer dabei. Aber eine Lampe führen sie mit. Damit beleuchten sie den Schaden. Diesmal einen halben Meter unter Wasser in einer noch viel größeren Schraube. Zum Entfitzen muß getaucht werden. Freiwillige vor! "Und wenn ein Hai kommt?" "Hab dich nicht so mädchenhaft. Wer frißt dich denn schon!"
"Bubi, geh du ins Wasser. Vor dir haben die Haie Respekt!" meint 'Keule' Bürgin der Bootsführer. Matrose 'Bubi' Bölk ist nicht gerade ein haifreundlicher Brocken, er wiegt 148 Kg!
Die Einbäume in ihrer schwarzen Tarnfarbe haben uns wieder eingekesselt. Es murmelt bedrohlich aus allen Himmelsrichtungen.
Uns tun die Kameraden schon leid. Sie haben jetzt eine Menge Arbeit mit ihrem beschädigten Netz und sicher in dieser Nacht auch keinen Rekordfang. Aber nur ein paar schwimmende Bambusknüppel sind im Dunkeln auch nicht die rechte Navigationshilfe, um ein hundert Meter langes Netz zu orten und um diesem auszuweichen.
Die Ausmecker hält sich in Grenzen. Aber wegen des Bootsmanövers müssen wir Ausflügler einen ausgeben. Na ja, das ist normal und entspricht internationalem Seerecht.
![]() Eine Affenschande
Eine Affenschande
Der Kapitän hat vor ein paar Reisen in Conakry einen Tierfänger kennen gelernt.
Der Mann ist Belgier und hat außerhalb der Stadt sein großes Gehöft voller afrikanischer Tiere. Ich war mit dem Kapitän schon öfter zu Besuch in seinem kleinen Privatzoo.
Am meisten hat es mir ein Zwergflußpferd angetan.
Es ist ein ausgewachsenes Tier mit einem prallen Knackarsch, aber trotzdem noch ganz handlich zum knuddeln. Das Flußpferdchen hat der Staatschef Sékou Touré von einem anderen afrikanischen Fürsten geschenkt bekommen. In sein Schlafzimmer stellen wollte er das Tier nicht, einen Tierpark gibt es im Land nicht. Jetzt logiert das kleinwüchsige Flußpferd bei dem Belgier.
Ein ganzer Karnickelkäfig voller Giftschlangen flößt mir Respekt ein.
Der Jäger klopft an das Gitter, da bäumt sich hinter dem Draht eine schöne Kobra auf. Eine Spuckschlange, die französischen Pflanzer nennen sie "naja cracher" (nascha crajör). Sie hat ein gelbes Halsschild und einen dunklen violett schimmernden Körper. Raimonde erzählte mir, daß er bei einem Kontrollgang durch seine Plantagen einer solchen, sich aufbäumenden Schlange gegenüberstand. "Ab einer Entfernung von zwei Metern spuckt sie dir äußerst treffsicher einen Strahl ätzende Flüssigkeit in die Pupillen, falls du so leichtsinnig bist, die Schlange weiterhin offenen Auges zu betrachten. Wenn du angespuckt, brennenden Auges einen Bewässerungsgraben am Plantagenrand erreichst, kannst du dir die Augen auswaschen. Wenn kein Wasser in der Nähe ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß du erblindest. Außerdem ist der Biß der 'naja' auch noch giftig. Aber den kannst du mit einem kräftigen Herz überleben. Wenn dich allerdings die schwarze oder grüne Mamba beißt, ist alles vorbei. Bei der einen schon in drei, bei der anderen erst in fünf Minuten."
Solche Raritäten hat der Belgier in seinem Karnickelstall untergebracht.
Wir sind im Hafen in seinen Jeep gestiegen und auf seinem Innenhof, unter einem riesigen Baum von dem Auto geklettert. Der Kapitän unterhält sich mit dem Belgier, da kommt ein
stattliches Schimpansenweibchen mit seinem gekrümmten Witwenbuckel auf allen dreien auf mich zu. Die vierte verbleibende linke Hand streckt mir das Tier schon von drei Metern Entfernung entgegen. Ich sehe darin eine freundliche menschliche Geste der Begrüßung und reiche der Affendame gleichfalls meine linke Hand. Die Affenwitwe ergreift diese, richtig wie ein Mensch auch, läßt aber nicht wieder los.
Der Griff ist sehr fest.
Das Tier ist sehr großzügig angekettet und hat einen Aktionsradius von etwa 25 Metern.
 Auf dem großen Baum, hoch droben, hat es seine Behausung, ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Baumhaus.
Auf dem großen Baum, hoch droben, hat es seine Behausung, ein sehr geschmackvoll eingerichtetes Baumhaus.
Die Affenfrau nimmt mich jetzt mit, vorerst bis zu dem dicken Baumstamm. Sie geht schon mal vor und zieht mich mit sanfter Gewalt nach. Hier scheitert das Vorhaben der Affen-Lady allerdings an meinen schlecht ausgebildeten Kletterkünsten und dem mangelnden Willen, die Einladung, auf eine Tasse Kaffee, zu ihr nach Hause auch anzunehmen. Hochschleppen will sie meine 78 Kilo nun auch nicht gerade.
Der belgische Tierfänger schlägt dem Kapitän ein utopisch klingendes Geschäft vor. "Ihr seid doch Ostdeutsche" sagt er, "euer Carl Zeiss Jena baut gute Ferngläser. Ich brauche ein gutes Jagdglas. Bringt mir so eins mit, ich gebe euch zwei junge Schimpansen dafür. Wilde Tiere aus dem Busch, Affenbabys!"
Kapitän Düerkop und ich sind keine Insider in dieser Branche, aber als ein prüfenswertes Angebot erscheint uns das schon. Wir versprechen dem Jäger, uns in Rostock diesbezüglich zu verwenden.
Der Kapitän trägt den Tauschhandel dem Rostocker Zoodirektor Dr. Schwarz vor.
Der kommt zu uns an Bord und hört sich die Story an.
Nur weil er ein höflicher Mann ist, drückt er die landläufige Redewendung: "Verscheißern kann ich mich alleine" mit gewählteren Worten aus. Er klärt uns über die herrschenden Konditionen im weltweiten Menschenaffen-Geschäft auf: "Eine Fanggenehmigung für einen wildlebenden Menschenaffen ist so gut wie überhaupt nicht mehr zu bekommen. Wenn doch, dann generell für ein einziges Tier, zum Stückpreis für mindestens zehntausend Dollar. "Da wollen sie mir für ein lumpiges Fernglas gleich zwei Tiere bringen? Sind sie sich da sicher?" Wir sind uns einigermaßen sicher, wir kennen den Mann. Er ist kein Spinner.
"Wissen sie", erläutert uns Dr. Schwarz, "mit welchem Aufwand sie im Regenwald ein Menschenaffen-Junges unversehrt fangen können?" Wir wissen nicht. Der Doktor klärt uns auf: "Vorausgesetzt, sie haben eine teuere Fanggenehmigung erworben, muß die Herde möglichst auf einen einzeln stehenden Baum getrieben und mit affenartigem Tempo alle umstehenden Bäume gefällt werden. Außerhalb das Fallradius des Baumes, auf dem die Herde sich geborgen hat, werden dann auf der beräumten Freifläche Netze gespannt und der Baum, mit samt der Affenherde zu Fall gebracht. Jetzt versuchen die Affen auf dem Boden zu entkommen und verfangen sich in den Netzen. Hier dürfen sie nun, gemäß ihrer Fanggenehmigung, das Jungtier ihrer Wahl der Mutter aus dem Pelz nehmen."
Dr. Schwarz kennt den Aufwand zur Beschaffung eines wilden Affen und glaubt uns natürlich unsere Story nicht, aber, sagt er: "Das bißchen Kindernahrung, Badewanne, Thermometer, Nuckelflasche und Windeln, soll mir der Versuch Wert sein. Derartige Utensilien für eine sachgemäße Babypflege bringt demzufolge ein Zoobediensteter vor unserem erneuten Auslaufen an Bord.
Wir kümmern uns um das Zeiss-Glas. So ein DDR-Kultobjekt kurzerhand außer Landes zu bringen, wäre ein Zollvergehen ersten Ranges. Der Kapitän wendet sich an den Generaldirektor der Deutschen Seereederei.
Dieser zeigt sich seinem Heimatzoo gegenüber generös und beschafft das besagte Fernglas, als Spende für den Rostocker Tierpark. Auch eine Ausfuhrgenehmigung kann der Kapitän dem Zoll beim Auslaufen präsentieren.
In Conakry übergeben wir vertrauensvoll das mitgebrachte Fernglas unserem potentiellen Geschäftspartner.
Zwei Hafenliegezeiten besuchen wir den Belgier mit seinen vielen Tieren vergebens. Er vertröstet den Kapitän mangels Jagdglück auf die nächste Reise. Ich knuddle derweile das Zwergflußpony und mache ein Schwätzchen mit der Affenlady.
Beim nächsten Anlegen in Conakry können wir es nicht fassen, unser Geschäftsfreund bringt ein Schimpansen-Baby an Bord. Ein kleiner Junge, wenige Wochen alt, ganz hilfsbedürftig und furchtbar anhänglich. Er will pausenlos auf den Arm und krallt sich sofort am Hemd fest. Wieder abgesetzt, heult er sofort los. Einer muß ihn ständig herumschleppen. Zum Glück haben wir ein Passagierehepaar an Bord, das den Affenwinzling rührend betuddelt.
Als erstes wird er auf der Brücke gebadet. Nicht draußen, damit er keinen Zug bekommt. Er ist ganz verschorft zu uns gekommen. Danach wird der süße Bengel mit Babyöl massiert. Schön gekämmt und gewindelt bekommt er das Fläschchen mit Ki-Na. Wir haben ja alles an Bord und müssen nur in den Aufzeichnungen nachschauen, wie warm das Badewasser und die Babynahrung sein darf. Die Maschinenleute durchstöbern die Putzlappenballen und staffieren den kleinen Mann so aus, daß seine Adoptiveltern ihn täglich etwas neues, hübsches anziehen können.
Wir liefern den Burschen im Rostocker Tierpark gesund und gut erhalten ab.
Das Schiff kehrt nach Conakry zurück. Unser Freund hält Wort und ein zweites Schimpansenbaby für uns bereit. Ein kleines Mädchen, schon ein wenig größer als der vorherige Junge. Das Mädchen ist nicht mehr ganz so babyhaft pflegebedürftig, aber dennoch muß es viel herumgeschleppt und betuddelt werden.
Abends muß immer erst jemand Händchen halten und ein Affenliedchen singen und sich dann ganz langsam davon schleichen, wenn das Waisenkindchen eingeschlafen ist.
 Beide Äffchen sind nämlich Waisen.
Beide Äffchen sind nämlich Waisen.
Mir kommen die Tränen, als ich mich bei dem Belgier kundig mache: Das kleine Affenmädchen hat ein gespaltenes Ohr. "Wie ist das denn passiert?" frage ich den Jäger. Der druckst etwas herum und ich bohre weiter. Jetzt, bei dem zweiten Affenkind interessiert es mich ohnehin ganz brennend, wie er zu diesen Babys gekommen ist.
Ich bin entsetzt, als der Weidmann seine Fangmethode erläutert:
"Ich habe lange dafür im Busch gelegen, bis es mir gelang, eine Mutter mit dem Baby von der Herde zu trennen. Die Tiere halten in ihrem Verband fest zusammen.
Die Mutter von dem Affenmädchen habe ich mit Schrot erschossen. Dabei hat ein Schrotkorn dem Baby das Ohr gespalten."
Nie und nimmer hätten Kapitän Düerkop und ich bei so einem fiesen Geschäft einen Finger gerührt, wenn uns diese in Guinea noch gebräuchliche Wilderei bewußt gewesen wäre.
Aber auch, wenn das Folgende jetzt Proteste provozieren wird: Es wäre für die beiden bedauernswerten Affenwaisen dennoch besser gewesen, wenn wir sie auf der Reise außenbords geworfen hätten. Ihnen blühte eine grausame, lebenslängliche Haft im Rostocker Affen-KZ. Als sie im Teenager-Alter in ihrem winzigen kahlen Käfig zu Tode betrübt in die Zuschauer blicken, da stehe ich auch vor den Gittern. Ich muß mich abwenden, um meine Tränen zu verheimlichen.
Jetzt bin ich zum zweiten Mal entsetzt. Dieser Tierpark hat nicht einmal andeutungsweise die Voraussetzungen, solchen Wildtieren wenigstens in einer winzigen Andeutung ihren ursprünglichen Lebensraum nachzubilden. Die bedauernswerten Teenager dürfen jetzt ihre unterdrückten geballten Energieen auf einem Steinfußboden, drei gefliesten Wänden und einem Autoreifen am Baumstamm abreagieren. Diese Tiere hätten im Austausch in einem anderen Tierpark mit entsprechenden Möglichkeiten verbracht werden müssen.
Aber um den Zuschauermagneten "Menschenaffe" präsentieren zu können, heiligt in diesem Zoo auch so ein Pferch die Tierquälerei. Ich habe mir nach 1970 diesen Anblick nicht mehr angetan. Das Schuldgefühl gegenüber diesen Geschöpfen bedrückt mich aber noch heute.
 In dem am 23.1.1999 veröffentlichten Zoobericht der Ostseezeitung erfährt der Rostocker Freund dieses Tiergartens:
In dem am 23.1.1999 veröffentlichten Zoobericht der Ostseezeitung erfährt der Rostocker Freund dieses Tiergartens:
"Menschenaffen-Frau Sanga bekommt wieder Gesellschaft" und beim Weiterlesen: "Die Haltungsbedingungen für Menschenaffen sind in Rostock alles andere als ideal. Ein neues Haus für die großen Tiere ist lange geplant. Es wird allerdings einige Millionen kosten, die momentan nicht beisammen sind."
Aha, momentan sind die Millionen nicht beisammen. Das sind sie seit 1967 für die kleinen Schimpansen schon nicht. Und weil der Mann der Gorillafrau Saga in der gekachelten Gefängniszelle hinter der Glasscheibe im Rostocker Zoo verreckt ist, weil ihm nichts anderes übrig blieb, werden ersatzweise zwei neue Häftlinge dort eingelocht!
Jedem Kind wird heutzutage klargemacht, daß es ein Meerschweinchen nicht im Schuhkarton halten kann und einen Schwarm Neonfische nicht im Gurkenglas, wenn das Geld für eine artgerechte Tierbehausung fehlt.
Nur Zoologischen Gärten wird gestattet, mit ihren Zuschauermagneten im erbärmlichsten Pferch hinter einer Glasscheibe mit gesalzenen Eintrittspreisen die Besucher anzulocken. Daß ausgerechnet Zoologen eine solche Tierquälerei übers Herz bringen, ist mir unverständlich! Ich glaubte, das Verständnis für Natur und Umwelt und die Ehrfurcht gegenüber der Kreatur hätte sich in den letzten Jahrzehnten zum Besseren gewendet. Das gilt anscheinend nur für laienhafte Tierfreunde, auf keinen Fall für Zoobetreiber mit einer Kasse vor dem Eingang ihrer kritikwürdigen Tierbehausungen.
Mittlerweile verbietet die europäische Gesetzgebung den Zoologischen Gärten so eine kommerzielle Tierquälerei. Von alleine wären die Zoobetreiber in Rostock wohl darauf nie gekommen.
![]() MS JOHN BRINCKMAN und seine Viecher,
MS JOHN BRINCKMAN und seine Viecher,
wäre schon fast ein Buchtitel für sich.
Auf manchen Reisen ist das Schiff schon ein fahrender afrikanischer Heimatzoo.
Einleitend muß ich erklärend darauf hinweisen. Ich tat auf diesem Schiff von 1962 bis 1968 Dienst. Das Umweltbewußtsein und das Artenschutzabkommen kam erst später in die Welt. Aber das gerade geschilderte Drama mit den Schimpansen-Babys und die weiteren Tiergeschichten verdeutlichen nach meinem Erachten, wie zwingend notwendig die weltweit getroffenen Abkommen zum Schutz der Wildtiere dieser Welt sind und die Aufklärungsarbeit engagierte Tierschützer.
Nur wenn dem Tierfänger die gefangenen Produkte nicht mehr abgenommen werden, stellt er den Tieren auch nicht mehr nach.
Besonders in Benti schleppt uns die Bevölkerung ein Tier nach dem anderen an. Aber auch alle Arten Felle, Häute und Hörner.
 Ein paar Schachteln Zigaretten, eine oder zwei Flaschen Schnaps und schon haben wir wieder einen Kartoffelsack voll Pythons. Wir transportieren auf diese Weise, eine ganze Kiste voll Giftschlangen. Eine "Ginette", so nannten die Franzosen das luxartige Tier, einen großen Waran, mehrere Papageie, eine mächtige Wasserschildkröte, ein ganzes Nest mit sechs jungen Kaimanen und Affen. Affen in allen Ausführungen und Mengen. Die Tiere werden allerdings nicht für den Privatbesitz mitgenommen.
Ein paar Schachteln Zigaretten, eine oder zwei Flaschen Schnaps und schon haben wir wieder einen Kartoffelsack voll Pythons. Wir transportieren auf diese Weise, eine ganze Kiste voll Giftschlangen. Eine "Ginette", so nannten die Franzosen das luxartige Tier, einen großen Waran, mehrere Papageie, eine mächtige Wasserschildkröte, ein ganzes Nest mit sechs jungen Kaimanen und Affen. Affen in allen Ausführungen und Mengen. Die Tiere werden allerdings nicht für den Privatbesitz mitgenommen.
Wir schenken sie stets dem Zoo unserer Patenstadt Güstrow, nur muß sich dieser kleine Tierpark irgend einem Zooaufsichtsrat beugen, der vorschreibt, für die Wasserschildkröte ist der Tierpark Halle zuständig. Für die Ginette eben dieser und für den Waran eben jener.
Das ist auch richtig so, nur wer die entsprechenden Voraussetzungen hat, soll Tiere halten.
Gleich auf der zweiten Reise nach Benti haben wir einen eisernen Käfig an Deck aufgestellt. Irgendwas hockte da immer drin auf der Heimreise.
Affen verursachen streckenweise das absolute Chaos auf dem Schiff. Meistens sind die Tiere an Menschen gewöhnt, aber die Meerkatzen und besonders die Paviane haben es knüppeldicke hinter sämtlichen Ohren.
Im Anfangsstadium unserer Tierpflegerkarriere hat die wilde Bande mit uns Katze und Maus gespielt und unser Herz für Tiere schamlos ausgenutzt. Tagsüber lassen wir die Horde an Deck herumtoben. Sie gehen auch gar nicht mal so weit, sondern bleiben bei den Freiwachen, die sich mit den Schmusebedürftigen beschäftigen und ihnen ein Schmankerl schenken. Auch zeigt sich jeder Affe sofort erkenntlich und durchsucht, nach den empfangenen Streicheleinheiten, nun seinerseits das Haupthaar und, falls vorhanden, auch das Brusthaar seines Ansprechpartners.
Abends schnappt sich dann jeder sein Schoßhündchen und sperrt es für die Nacht in den Käfig. Am nächsten Tag geht das schon nicht mehr so reibungslos ab und am dritten Tag ist alles zu spät.
Die Biester haben einen absoluten Riecher dafür, wenn sie wieder in die Heia sollen.
 Sie verziehen sich in die Masten, auf die Windenhäuser und veräppeln uns nach Strich und Faden. Schließlich verhärten sich die Fronten so, daß man mit Feuerlöschschläuchen versucht, ihrer wieder habhaft zu werden.
Sie verziehen sich in die Masten, auf die Windenhäuser und veräppeln uns nach Strich und Faden. Schließlich verhärten sich die Fronten so, daß man mit Feuerlöschschläuchen versucht, ihrer wieder habhaft zu werden.
Danach gibt es Ausgang nur noch am Tampen um die Hüften. Das erfordert aber gegen Abend immer noch ein ganz beherztes und ziemlich robustes Zugreifen. Auch eine kleine Meerkatze strampelt mächtig mit den Hufen und beißen kann sie auch ganz prächtig.
Die großen Pavianmännchen haben in ihrer Hackordnung sogar den Kapitän noch weit unter sich angeordnet. Wie dann erst noch z. B. den Bäcker an Bord. Und gerade dieser legt sich mit einem großen Pavian-Alpha-Männchen an.
Auch die Paviane sind ganz zugänglich, wenn es nach ihrem Willen geht. Sie sind auch verschmust, holen sich gerne Streicheleinheiten ab und zeigen sich auch ihrerseits erkenntlich. Nur jetzt, eingangs der Biscaya, wird es im Käfig an Oberdeck kälter und wir quartieren die Dreierbande hinten im Judentempel in ein kleines wärmeres Kabuff um. Wir haben ja ein Herz für Tiere und lassen sie nicht frieren. Später bei einem winterlichen Zoobesuch in Güstrow dallerte die ganze Bande quietschvergnügt im Schnee herum und setzte sich sogar mit dem blanken Mors in den kalten Schnee. Unsere aufwändige Verhätschelung an Bord hätte gar nicht Not getan.
Wir liegen in Rostock an der Pier. Der Güstrower Zoo ist benachrichtigt. Eine Abordnung unserer Patenstadt kann uns besuchen kommen. Außer dem Affendomteur haben wir auch noch eine elfte Klasse der "John-Brinckman-Oberschule" eingeladen.
Die Jugendlichen sind starke Esser. Sie stopfen an Bord soviel Bananen in sich hinein, daß es aus ihren Ohren schon kleine Würstchen wieder herausdrückt.
Mit einer Banane kann man in der DDR nicht nur Affen begeistern.
Bevor aber der Güstrower Besuch eintrifft, bekommt der Bäcker den seinigen, Onkelns, Nichtens, Neffens und so und alles. "Wollt ihr mal sehen, da hinten sind drei Affen eingesperrt" schwärmt er den Kindern vor? Die wollen natürlich!
Die Verlegung in das finstere Kabuff unter Deck hat die drei dort Einsitzenden arg vergnatzt.
Der Bäcker ist nicht gerade ein Packer, nur etwas größer als der große Pavian und eher noch schmalschultriger als dieser. Als diesem King-Kong nun in dem Eisenschott ein kleiner geöffneter Spalt geboten wird, drückt er mit seiner kräftigen Schulter die Tür ganz auf. Was soll der Geiz! Nun zeigt er sich dem Besucher auch erkenntlich und führt bereitwillig vor, was er so auf der Pfanne hat.
Als erstes springt er am Achterschiff auf den Schiffszaun. Auf dem oberen Handläufer balanciert er bis ganz nach achtern und schwingt sich in einem kühnen Satz auf die dicke Achterleine und ....geht von Bord. Einfach so.
Im großen Verwaltungsgebäude des Hafens ist ein Postamt untergebracht. Ich versende über dieses zehn Kilo Bananen. Nun bin ich auf dem Rückweg zum Schiff, da entwickelt sich unter dem vielen Volk im Hafen Betriebsamkeit. 100 Leute bilden auf einer Freifläche bereits einen großen Batzen. Immer mehr gesellen sich noch dazu. Ziemlich außer Atem kreuzt auch unser Bäcker meinen Heimweg.
Als ihm auf dem Schiff der Affe entfloh, hat dieser vor ihm einen Vorsprung von mehreren hundert Metern. Der Bäcker konnte ihm ja auf der Achterleine nicht an Land folgen, sondern mußte umständlich mittschiffs zur Gangway hasten und dann ab Achterschiff dem Pavian hinterher hirschen. Schließlich hat den Ausbrecher die Menschentraube, die sich mittlerweile dieser Hubertusjagd angeschlossen hat, auf einem freien Containerstellplatz eingekesselt. Jeder der Großwildjäger hält zu dem wilden King-Kong aber respektablen Abstand. Der hockt im Zentrum des Kessels und fletscht bedrohlich die Zähne. Besonders seine beiden imposanten Reißzähne halten jeden seiner Verfolger auf gebührlichen Abstand. Der Bäcker schiebt die Umstehenden auseinander und betritt wie ein Torero die Arena. Ich folge ihm. Wir versuchen unseren Bekanntheitsgrad bei unserem Schoßäffchen auszunutzen. Aber sein Erinnerungsvermögen hatte bei der Hetze durch den Hafen wohl gelitten. Er faucht und kreischt und geht auf uns los.
Ein LKW hält bei der Menschentraube.
Der Fahrer will sich dieses Gladiatorenschauspiel auch nicht entgehen lassen. Er schaut zu, wie wir beide mit dem Affenmann unsere Scheingefechte abwickeln. Dann geht er zu seinem LKW und bringt uns eine Decke. "Versucht's doch mal damit", sagt er und reicht uns die Decke in die Arena. Der Bäcker, von seinem Schuldbewußtsein getrieben, stürzt sich mit der ausgebreiteten Decke auf den Wildfang. Ich hechte hinterher. Der Affe kreischt und strampelt, verfitzt sich dabei aber ganz praktisch in der Decke. Der Bäcker hat ihn im Schwitzkasten. Ich greife mir seinen fetten Schwanz. Den des Affen natürlich! So ziehen wir mit unserer Beute los.
Immer, wenn uns die Aktivitäten des Affenmannes zu bedrohlich werden, kneift ihm der Bäcker vorn die Luft etwas ab. Das beruhigt den Randalierer dann immer.
Die Decke ist zusätzlich um seinen Leib geschlungen, ein paar Beine schauen zwar als zusätzliche Bedrohung aus dem Bündel hervor. Aber die brauchen auch Luft zum Strampeln und die wird ja vorne, nur bei gutem Benehmen zugeteilt.
So schleppen wir ihn zurück zum Schiff.
Der Weg ist weit, der Bursche wird ganz schön schwer. Der LKW-Fahrer folgt uns, er braucht ja seine Decke wieder.
Die Rückführung in die Zelle ist das nächste Problem, denn die beiden Kollegen des Ausbrechers wittern beim vorsichtigen Öffnen des Schotts ihrerseits nun eine Chance, auch einmal einen Ausflug zu unternehmen. Wir weisen den Kraftfahrer ein: "Mach mal vorsichtig das Schott auf und hau den beiden gleich ordentlich was auf den Pinsel. Die stecken sowieso gleich ihre Rübe durch den schmalen Türspalt." Der Trucker verfährt, wie ihm geheißen. Nun werfen wir den Ausbrecher zu seinen Mitgefangenen zurück. Natürlich samt der ihn noch umschlingenden Decke. Die möchte unser Helfer aber wieder haben, hauptsächlich deswegen ist er ja überhaupt mitgekommen und nebensächlich natürlich, weil wir Bananenschiff unter Ladung sind.
Wir bauen uns einen langen Drahthaken und einen kurzen Besenstiel als Domteurhilfe. Die Dreierbande sitzt in dem kleinen Kabuff an der Rückwand in ihrem Schlafregal. Aus der Decke hat sich der Dicke nun selbständig heraus gefitzt. Aber alle dreie zerren in trauter Einigkeit nun verbissen an der Decke und wir mit dem Drahthaken am anderen Ende auch. Mit dem Besenstiel hauen wir ihnen auf die Finger. Als wir die Decke schließlich haben, hat ihr Gebrauchswert arg gelitten. Wir beschenken den Kraftfahrer reichlich mit reifen Bananen, der Bäcker legt noch ein paar Schachteln Pall Mall drauf. Das kompensiert die Wertminderung seiner Leierkastendecke.
"Bild war dabei!" ist DDR-mäßig noch kein Thema. So hat von aller offiziellster Seite zum Glück niemand etwas mitbekommen. Wäre der Affe in die Kräne geklettert, hätte man ihn wohl von Amts wegen erschießen müssen. Hinzu kommt, daß so ein frisch importiertes Tier erst einige Wochen in Quarantäne gehört. Wir haben den Rostocker Hafentierarzt von unserem Tierimport vor Anlaufen Rostock nicht benachrichtigt, schließlich hat der Tierpark Güstrow diesbezüglich ja eigene Sachverständige.
Wie der Tiergartenmensch von Güstrow die drei Juckigen von unserem Schiff nach Güstrow verbracht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Mehr Ahnung und Geschick als wir, hat er sicher.
Der Affe und der Bäcker sind gerade noch aus Teufels Küche wieder entkommen.
![]() "Robby" blamiert die ganze Innung
"Robby" blamiert die ganze Innung
Wir pflegen zum gegenseitigen Vorteil mit der Stadt und der "John-Brinckman-Oberschule" Güstrow unsere Patenschaft. Nicht weil sie von staatlicher Stelle verordnet wird, sondern weil sie beiden Seiten das Leben bereichert.
Die Stadt Güstrow schenkt uns einen Schäferhund-Welpen.
Ein schönes Tier mit Papieren.
Er kommt ganz jung als Welpe an Bord.
Unser Kapitän heißt Robert, der Hund wird im Hinblick auf diesen Namen durch Mehrheitsbeschluß "Robby" getauft.
Robby wächst heran und kann ganz gut Schiff fahren. Aber auch nur das!
Robby kennt alle paarundvierzig Besatzungsmitglieder haargenau, auch nach einem viertel Jahr Urlaub noch.
Dann springt er mir schon auf dem Gangwaypodest am weißen Trenchcoat hoch, vor Freude, daß ich auf der nächsten Reise wieder mit ihm umher dallere.
Der Hund hat wenig Auslauf und ich, als dynamischer Typ auch zu wenig. Wir bilden eine Interessengemeinschaft. Robby besucht mich sehr oft, oben hinter der Brücke in meinem Funkchap. Dann spielen wir eine Runde fangen.
Auf dem Brückendeck kann man durch die geöffnete Brücke und dem Außengang hinter dem Funkraum und meiner Kammer eine volle Runde drehen.
Bis es dem Wachoffizier auf der Brücke zu blöd wird.
Draußen auf dem bitumösen Decksbelag kriegt mich Robby regelmäßig ein. Dann bin ich dran und er keult vor mir her in die Brücke hinein. Die aber ist mit Linoleum ausgelegt, seine Krallen drehen hier durch, er hat keinen Grip und ich erwische ihn am Schwanz. Dann wirbele ich ihn eine Runde auf dem blanken Kunststoffbelag herum und er muß wieder fangen.
Das grämt ihn immer maßlos.
Sehr oft jagen wir den Hund zum Konditionstraining auch über eine Ladeluke. Dann werfen wir uns zu zweit einen hölzernen Lukenkeil zu und er hechtet unermüdlich Luke-auf Luke-ab hinter dem fliegenden Holz hinterher.
Wir hatten vorher schon ein paar Pudel-Mops-Doggen als Bordhund. Die hießen "Whiskey","Fusel" oder "Nutte".
Einer von denen war ein Zirkushund.
Wenn der Bootsmann kommandierte: "Nutte, wie machen die Mädels in Wismar?", dann knallte sich der Hund auf den Rücken und streckte alle Viere von sich. Diese Hunde waren alle hoffnungslose Alkoholiker.
Gelegentlich laufen auch nüchterne Hunde ja etwas quer auf ihrer Kurslinie. Bei Seegang haben natürlich auch Vierbeiner gewisse Stabilitätsprobleme, dann laufen sie noch querer zur Schiffslängsachse. Wenn sie dann aber zusätzlich noch einen geschnasselt haben, dann spielen sie sämtliche Varianten tierischer Fortbewegungsmöglichkeiten durch.
Als wir Robby an Bord bekommen und ihn während einer Bordversammlung "Robby" taufen, vergattert der Kapitän seine Mannen, diesem Hund keinen Alkohol anzubieten!
Der Hund bleibt auch 'clean'.
Den größten Teil seiner 40 Herrchen findet Robby so lala.
Fünf Mann hat er ins Herz geschlossen. Ich gehöre dazu.
Unsere Kammertüren haben wegen der Klimaanlage über dem Boden Gitteröffnungen. Die Türen bleiben wegen der gewollten Kühle in der Kammer auch geschlossen. Robby schnürt dann durch die Gänge und schnuppert an jedem Türgitter. Nach so einer Nase voll, weiß er genau, wo wer etwas veranstaltet. Dann kratzt er zwei, dreimal mit seinen Krallen am Mahagoni-Furnier die Tür herab. Danach hat die Tür wieder ein paar Kratzer mehr, aber Robby hat sie auf und tritt gelassen ein. Wer die zerkratzteste Tür hat, hatte bisher den häufigsten Besuch.
Der Besuchte muß dann aufstehen und hinter dem hohen Gast das Schott wieder schließen, oder warten, bis es bei Seegang alleine ganz furchtbar herb ins Schloß ballert.
In den Tropen hat der Hund dauern Brand und tritt sich dann auf die Zunge. Einer hat dann mal mit ihm eine Trainingsstunde absolviert und ihm die Bedienung unserer Wasserhähne erklärt. Auf einem Schiff gibt es zwar keine Wasseruhren, aber gespart werden muß dennoch! Es sei denn, das Schiff hat einen Seewasserverdampfer. Wir haben diese Hochtechnologie nicht und daher Wasserhähne, die nur etwas hergeben, so lange man die Pfote auf diesen beläßt. Das wird nun Robby erläutert und befähigt ihn danach, seinen Wasserhaushalt selbständig zu regulieren. Dazu betritt er ganz locker die erstbeste Kammer, Türen öffnen kann er ja. Springt am Waschbecken hoch, haut seine Pfote auf den Wasserhahn und schlabbert sich satt. Danach zieht er wieder Leine. Tür zumachen ist nicht sein Ding.
Auf dem Dampfer kommt Robby, der nun zur vollen Größe ausgewachsen ist, ganz gut über die Runden.
Ansonsten aber ist er der dusseligste Schäferhund der Warschauer Vertragsstaaten. "Reisen bildet" trifft für den überhaupt nicht zu, er wird von Tag zu Tag blöder und blamiert in jedem Hafen die ganze Innung.
Robby kann Neger und alle Sorten von Besoffenen nicht leiden. Ein alkoholisierter Afrikaner läßt bei ihm alle Glocken läuten.
Das berühmte MS HOPE brachte für seinen langen Aufenthalt in Conakry auch Mauersteine und Zement mit und mauerte mit Bordmitteln innerhalb des umfriedeten Hafengeländes einen schnukligen Seemannsclub hin.
In diesem sind nun für Guinea-Franken amerikanisches Budweiser-Bier, Cola, Fast food und Brathändeln für Seeleute erhältlich.
Murphy, seine Kumpels und Ruthy, die Chefin der Diätküche laden zum gemütlichen Beisammensein.
Robby und ich lassen 'open air' im Klub eine Kuh fliegen. Der Schäferhund und die amerikanische Köchin sind bald ein Herz und eine Seele. Das Mädchen knuddelt das respekteinflößende Tier und schwärmt von dem "german shepherd".
Murphy erzählt mir, von Robby ermuntert, eine Geschichte, die kürzlich durch die amerikanische Presse ging:
Im Vietnamkrieg hatten die amerikanischen GI's mit 'Charlie', wie sie ihren im Busch verschanzten Gegner nannten, unüberwindliche Schwierigkeiten.
Ein pfiffiger Öberschter kam auf den Gedanken, 'Charlie' mit scharfen Hunden aus dem uneinnehmbaren Dickicht zu jagen.
Die US-Kriegsführung kaufte von Germany ein paar hundert scharfgemachte Schäferhunde zum Stückpreis von 700 US-Dollars. "Du weißt sicher" setzt Murphy seine Schilderung fort "in Vietnam bereichert Hundefleisch auch in fetteren Zeiten die Speisekarte. Jetzt, in diesem entbehrungsreichen Krieg aber herrscht Hungersnot. Somit hat die US-Army 'Charlie' eine äußerst willkommene Ladung Proviant in den Wald geschickt. Mit Hunden können die Vietkong umgehen. Es kam kein 700-Dollar-Hund wieder zurück aus dem Wald."
Wir sitzen alle Mann im Innenhof des Seemannsclub und trinken amerikanisches Budweiser Büchsenbier. In der einen Ecke des Hofes liegt ein riesiger Haufen der ausgezechten Büchsen. Irgendwo darunter steht eine mittlerweile völlig zugeschüttete Mülltonne. Wer seine Büchse geleert hat, wirft sie in diese Ecke. Sie kullert dann den Berg hinab. Dafür fühlt sich dann jedes Mal Robby zuständig. Er erhebt sich, springt ganz freudig erregt in die Müllecke und zerkracht mit seinem starken Gebiß eben diese Büchse, die gerade geworfen wurde. Die anderen alle gehen ihn nichts an.
Das steigert augenblicklich den Umsatz in dieser Bar.
Ein jeder schluckt nun heftig seine Bierbüchse leer und Robby rennt in nimmermüder Wiederkehr zu dem Blechhaufen und zerknittert das handwarme Behältnis.
In den Trinkpausen buhlt zusätzlich jeder Gast noch um die Gunst des Hundes.
Wenn ich einen auf der Lampe habe, dreht Robby schon immer angewidert vor mir ab, aber ich bin sein Kumpel!
Die weniger Symphatischen knurrt er an.
Die weißhäutigen Zecher der HOPE gleichfalls, nur von Ruthy läßt er sich betuddeln, aber die stinkt ja auch nicht so gräßlich nach Alkohol.
In der fröhlichen Runde sitzen auch ein paar dunkelhäutige Amerikaner. Die fangen nun gleichfalls an, mit dem Hund anzubandeln. Ich komme in ziemliche Schwulitäten, zu erklären, warum der Hund anscheinend ein Rassenhetzer ist.
Einer der Dunkelhäutigen steigt nun auf ein Fahrrad, um an Bord etwas zu holen.
Der blöde, weltfremde Robby hat doch noch nie ein Fahrrad gesehen, noch dazu eins, was von einem angetrunkenen Neger bedient wird. Er spitzt so schnell die Ohren und keult aus den Startlöchern, daß ich nicht mehr eingreifen kann. Er rennt neben dem Radler her und macht mit dem Kopf jede Bewegung mit, die dessen Fuß auf der Pedale vollführt. Auf dem unteren Todpunkt schnappt er zu. Erst fällt der Radler um, dann das Fahrrad und der Hund ist ganz begeistert von seinem Werk und tänzelt freudig erregt um die Unfallstelle.
An dem Tisch lachen alle Tränen.
Alle loben den Hund und beschimpfen mich, weil ich den Blödian ordentlich zusammenfalte. Jetzt muß er an die Leine und darf keine Bierbüchsen mehr entsorgen.
In Havanna nehme ich Robby im Linienbus mit an den Strand von Santa Maria. Ich schwitze Blut und Wasser und halte ihn kurz an der Leine.
Er hat vorher im Hafen von Rotterdam schwimmen gelernt.
Der Passat bläst ganz kräftig, so läuft am Strand eine heftige Dünung auf.
Das mißfällt dem Hund.
Er kläfft als erstes die ankommenden Wellen an und wirft sich diesen ganz grimmig entgegen. Dann sieht man von dem Wauwi abwechselnd den Kopf oder den Schwanz aus der Brandung ragen und er kullert mit der auflaufenden Welle den Strand hinauf. Das macht ihn dann noch wütender.
Zwei Mädels werfen sich am Strand einen kleinen Ball zu. Ziemlich weit weg von uns. Robby stellt seine Ohren auf und ab geht's. Keiner kann ihn halten.
Das Werfen von Gegenständen kennt er von Bord und meint in seiner Weltfremdheit, das geschieht auf der ganzen Welt ausnahmslos nur für ihn. Er jagt den Mädels den Ball ab und alle übrigen Erholungssuchenden in die Flucht. Mit dem Ball keult er nun in der gleichen Richtung weiter. Er verschwindet als Punkt am Horizont.
Jetzt sind wir ihn los!
Nach einer Stunde ist er wieder da und tritt sich auf die Zunge.
Wir kaufen ihm ein Selterwasser.
Den Ball hat er nicht zurückgebracht. Navigieren kann er wenigstens als Schiffshund, er hat uns wiedergefunden. Wir geben den kubanischen Mädels ein paar Pesos für einen neuen Ball.
In Benti bringt einer einen großen Waran an Bord.
Der ist lebig, ganz agil und mißt ungefähr hundertunddreißig Zentimeter.
Wir binden der Echse einen Tampen um die Lende und bändseln sie damit unter dem Rettungsboot im Schatten an Oberdeck an.
Robby eilt herbei und zeigt sich hoch erfreut über die Bereicherung der Fauna an Bord.
Wenn er begeistert ist, springt er immer mit allen Vieren zur gleichen Zeit in die Höhe. Schlußsprung hieß das glaube ich im Turnunterricht.
Robby hüpft also um den Waran herum und der dreht seinerseits mit dem Hund. Dabei hält er immer einen bestimmten Winkel zum dummen Robby ein und seinen langen Schwanz elegant gebogen.
Ein klatschender Peitschenhieb trifft den Schäferhund quer über die Nase.
Der ist jetzt entrüstet, mißachtet jede Vorsicht und wird nun seinerseits aggressiv. Da knallt es zum zweiten Mal. Wieder ein Volltreffer. Der Hund schwenkt die weiße Fahne und wir lachen ihn alle aus. "Robby du Weichwurst, du läßt dich sogar von einer Eidechse verwackeln!"
Den Hund auszulachen ist unfair. Hätte ich damals auf der Insel Roum, den ebenso großen Waran, der uns dort so rücksichtslos über die Schuhspitzen getrampelt ist, am Schwanz gezupft, wie ich es fast vorhatte, dann hätte der mir sicher auch ein paar heiße Ohren verschafft.
Das wehrhafte Verhalten hätten wir der Eidechse keinesfalls zugetraut.
An der Pier von Dakar, wo das Schiff sich für die Kubafahrt ausrüstet, schnürt eine schöne schwarze Katze auf und ab. Der Gangwayposten erschleicht sich ihr Zutrauen und holt sie an Bord.
Das Tier hat schwer Ahnung. Die muß auf einem anderen Schiff achteraus gesegelt sein, denn sie kommt an Bord sofort klar. Die Katze überwindet jede Leiter und sieht voll durch.
Im Gegensatz zu Robby, der alles frißt, ist unsere neue Katze ganz fürchterlich verwöhnt. Sie frißt nur rohes Fleisch, und davon auch nur ganz besonders zarte, schiere Stücke.
Den vulgären dummen Robby straft die vornehme Katzendame mit völliger Nichtachtung. Das grämt den Hund täglich auf's Neue und er versucht immer wieder mit der Versnobten anzubandeln.
An Oberdeck steht, auf zwei U-Profilen angeschweißt, eine Feuerlöschkiste mit Sand. Die Katze paßt da genau darunter, wenn sie der Sonne oder dem zudringlichen Robby aus dem Weg gehen möchte. Zum Sonnen sitzt sie aber auch ganz gerne auf dem Deckel der Kiste. Bei diesem Sonnenbad wird der Hund nun wieder zudringlich. Der Katze mißfallen seine Anzüglichkeiten, sie knallt ihm, wie üblich, mit ausgefahrenen Krallen links und rechts ein paar ordentliche Pfoten um die Nase. Henry Maske würde sagen: "Sie setzt Akzente!" Das kann der Hund natürlich nicht auf sich sitzen lassen, daß grundsätzlich jede dahergelaufene Kreatur sich in der Hackordnung über ihn erhebt. Er wird ganz gnatzig und die Katze entzieht sich den drohenden Handgreiflichkeiten durch Flucht unter die besagte Kiste.
Robby schaut nach.
Dazu muß er den Kopf seitlich neigen und schnüffelt unter die Kiste. Dann zuckt er zurück und jault. Seine Nase ist ziemlich zerfranst. Er begibt sich in ärztliche Behandlung, bekommt Jod auf die Nase und einen Nifucin-Verband auf sein sensibelstes Ortungsorgan!
Streckenweise hat es der Hund nicht einfach.
In Westafrika brennt ihm der Stern mit lockeren 40 Grad auf den Pelz. Innerhalb der Aufbauten herrschen ca. 24 Grad.
Damit läßt es sich aus Hundesicht mit Sommerfell ganz gut aushalten. Im winterlichen Rostock fröstelt es dem Hund dann aber bei Minusgraden in seinem luftigen T-Shirt. Er hüllt sich in einen Angorapelz.
Nach dem Passieren der Kanarischen Inseln in Richtung Süden stellt Robby fest, daß er winterlich 'over dressed' ist, er läßt Haare wie Hund!
Ansonsten kommt er aber ganz gut klar. Er ist mit Leib und Hundeseele 'Seehund'.
Wir mögen den Hund alle sehr, aber schließlich ist es mit dem Dummi an Bord nicht mehr zu machen. Er blamiert im Hafen die ganze Innung, weil er immer etwas ausheckt, womit keiner rechnen kann. Horst Fieting, der Storekeeper nimmt ihn mit zu sich auf's Land.
Sicher ist der Hund mit seiner Abmusterung mental schlecht fertig geworden, so wie ich ein paar Jahre nach ihm dann auch.
"Zum Schluß", erzählt uns der Storekeeper später, "kann ihm nur noch meine kleine Tochter im Zwinger das Futter bringen. Jeden anderen giftet er an. Der Tierarzt bescheinigt zusätzlich noch eine eigenartige Krankheit, die er sich in den Tropen zugezogen haben muß.
Wir mußten ihn einschläfern lassen."
![]() Die Gänse der Behörde
Die Gänse der Behörde
Matrose Matz hat nachts in Benti die Gangway-Wache.
Der Job ist langweilig.
Zwischen der Pier und dem Schiff gurgelt das zur Ebbe ablaufende Wasser. Im nahen Busch fiedeln die Grillen, die Ochsenfrösche bedienen die Blasinstrumente. Vom hellen Schein der Decksleuchten angelockt, stoßen sich bunte Schmetterlinge am Lampenglas die Köpfe. Manche von ihnen tragen Schutzhelme und überstehen die Crashs unbeschadet. In der Luft sind noch einige Moskitos und unten an der Pier etliche Kakerlaken unterwegs. Ansonsten rührt sich nichts in der lauen Tropennacht am Melacoré.
Plötzlich aber kommt Leben auf die Pier. Eine Flugstaffel großer Vögel der Gattung Gänseähnliche, landet auf der festgefahrenen Kiesfläche vor dem Schiff und sucht nun nach Brosamen. Zertretene Bananen, Packpapierfetzen und Kakerlaken.
Matrose Matz begibt sich mit einem Netz auf die Pirsch. Es gelingt ihm das Einfangen der sechs zoowürdigen Großvögel. Im Käfig an Deck ist gerade noch Kapazität frei.
In diesem begrüßen die Vögel zu Beginn des morgendlichen Hafenbetriebes die überrascht grinsenden Hafenarbeiter.
Matrose Matz hat sich nach seiner Nachtwache, beseelt vom Erfolg seines Pirschganges, in die Koje gepackt.
In diesem kleinen Hüttendorf kennt nicht nur jeder jeden, sondern jeder kennt auch eines jeden Papagei oder Kanarienvogel. Erst recht natürlich, das stattliche Gänserudel von Mamadou Ahmed Makasouba, dem Oberzollbeamten der Hafenstadt Benti!
Nur der Vollmatrose Matz ist zoologisch noch nicht so fortgeschritten, die nachtaktive domestizierte Säbelzahn-Steilschwanz-Hängebauchgans aus der Zucht des Zollbeamten von einem gänseartigen Wildvogel zu unterscheiden.
Als am Morgen das Gänse-Geschwader vom Feindflug nicht in den heimatlichen Hangar zurückgekehrt ist, meldete der exzellent funktionierende Buschfunk dem Würdenträger sofort den Verbleib der vermißten Flugstaffel.
Nach dem Frühstück wird der Zollchef des Hafens Benti bei Kapitän Düerkop vorstellig.
Unser bemitleidenswerter Kapitän hat eben erst beim Frühstück von der schnatternden Gänseherde im Käfig an Deck erfahren.
Nichts Genaues weiß er selber nicht!
Er macht vor dem Oberzöllner im weißen Nachthemd mit rotem Fez drei Verbeugungen und entschuldigt sich sechs Mal.
Die Gänse werden wieder an die Pier gesetzt.
Dann wird der höhere Beamte, gemäß der Schwere des Vergehens, reichlich beschenkt. Das ist in aller Welt das verkürzte Verfahren, Gesetzesübertretungen schnell und unbürokratisch aus der Welt zu schaffen!
Im Entgegennehmen von Präsenten sind Zollbeamte sehr geübt.
MS JOHN BRINCKMAN hätte mit dem halben Wert der Geschenke wahrscheinlich die doppelte Menge afrikanischer Breitschnabel-Gabelschwanz-colour pointed Gänse käuflich erwerben können.
Matzi hat übereifrig sein Möglichstes getan.
Der uns patenschaftlich sehr ans Herz gewachsene Güstrower Tierpark muß sich vorläufig noch mit der Zurschaustellung des heimatlichen Höckerschwans begnügen.
![]() Tauziehen
Tauziehen
In meinem Umformerraum liegt ein Kartoffelsack, ab und zu bewegt er sich.
Aber das ist sehr selten.
Darin werden drei Pythonschlangen nach Rostock überführt.
Monsieur Moreau meint, die brauchen nur Wärme und ab und zu eine warme Dusche. Also begieße ich sie, wie meine Tropenflora im Raumteiler.
Unser neuer III. Offizier ist Peter Feike. Feige ist er aber keinesfalls, nur neugierig. Ihm drängt es zu erfahren, welche Ausmaße die Pythons aufzuweisen haben.
Ich schleppe den schweren Sack auf Luke III.
 Der Neugierige greift sich in dem Sack das dickste Ende und hebt es heraus, das Geschlinge links und rechts davon streift er ab.
Der Neugierige greift sich in dem Sack das dickste Ende und hebt es heraus, das Geschlinge links und rechts davon streift er ab.
Nur gut, daß nichts verknotet ist.
Nachdem die drei Schlangen entfitzt sind, wird die Längste von ihnen sanft gereckt. Die Kinken lassen sich nicht ganz strecken, es sei denn, man würde sie über die Winde nehmen.
Das Tier ist ein würdiger Vertreter seiner Gattung. Das beruhigt uns zu wissen, wir wollen ja auch keinen Scheiß verschenken!
![]() Dem Seemann lacht nicht nur die Sonne
Dem Seemann lacht nicht nur die Sonne
Am 18.September 1967 verläßt MS JOHN BRINCKMAN mit Südkurs seinen Heimathafen. Am 21.September schalte ich um 08.00 Uhr morgens zu Beginn meiner Funkwache den Empfänger ein. Auf der Seenotwelle 500 KHz läuft Notverkehr. Noch sehr leise, anscheinend im Seegebiet südliche Biscaya / spanische Küste. Die spanische Küstenfunkstelle "Coruna Radio" hat den Hut auf. Ich lasse im Hintergrund die 500 KHz laufen und erledige die anliegenden Arbeiten. Hat "Rügen Radio" etwas vorliegen, was sagt der Wetterbericht vom englischen "Land's End Radio"?
Ich fahre zusammen, im Notverkehr höre ich ein Rufzeichen der Reederei. Das Rufzeichen von MS Fiete Schulze spielt in dem Notverkehr eine gewisse Rolle. Ich drehe den Empfänger lauter. Mit der sich verringernden Distanz zu dem Ort des Geschehens, verbessert sich auch die Erkennbarkeit der Zeichen. Man sucht im Seegebiet auf 45 Grad N und 10 Grad W nach Schiffbrüchigen des MS Fiete Schulze. Ich rufe den Kapitän an, der wird jetzt genau so blaß, wie ich es schon bin. MS JOHN BRINCKMAN hält sich auf dem Kollisionsschutzweg des englischen Kanals nun hart an Steuerbord, um nach Passieren der letzten englischen Landmarke schnellstmöglichst auf das Seegebiet zuzusteuern, in dem die Fiete Schulze wahrscheinlich in der Nacht gesunken ist.
Der Chief legt noch ein paar Propellerumdrehungen zu. In der Biscaya steht noch erhebliche Restsee vom durchgezogenen Tiefdruckgebiet.
MS Fiete Schulze hatte in Rotterdam 8.000 Tonnen Roheisen in Form von Masseln geladen, um diese via Panama-Kanal nach Japan zu verbringen.
Für so eine Ladung ist der Stückgutfrachter nicht gerade optimal ausgelegt.
Am 21.September 1967 verrutscht kurz nach Mitternacht in den Laderäumen in einzelnen Partien die Ladung. Das Übergehen der Ladung führt schließlich zu einer Krängung des Schiffes von mehr als 70 Grad. Diesem Wasserdruck halten dann Schotten und Bulleye's der oberen eingetauchten Decks nicht mehr stand. Evt. haben beim Übergehen der Ladung die Eisenmasseln auch ein Leck in die Bordwand geschlagen.
MS Fiete Schulze versinkt um 01.35 Uhr über den Achtersteven. Das Schiff wird ohne erkennbare Organisation in dramatischen Einzelaktionen verlassen.
MS Fiete Schulze sendet am 21. September 1967 um 00.47 Uhr per Tastfunk auf 500 KHz eine Seenotmeldung. Dieser Notruf wird von der englischen Küstenfunkstelle "Land's End Radio" empfangen. Die SOS-Meldung läßt mein Kollege auf MS Fiete Schulze automatisch tasten. Dafür benutzt er den Notrufgeber, in dem er mittels Drehknöpfen die einzelnen Ziffern für die Position vorher einstellen muß. Auch N oder S für die Breitenangabe und O oder W für die Länge muß berücksichtigt werden. Ein gewissenhafter Funkoffizier hält in diesem Gerät den gegenwärtigen Schiffsort ohnehin immer auf dem laufenden. In dem empfangenen Notruf fehlt in der Positionsangabe der nördlichen Breite die Ziffer, die die Minuten des Schiffsortes angeben müßte. Entweder hatte die Abtastautomatik des Notrufgebers bei der Übermittlung dieser Zahl einen Hacker oder dem englischen Kollegen von Land's End ist ein Hörfehler unterlaufen.
Das Versagen der Technik erscheint mir wahrscheinlicher.
Bei Land's End Radio sitzen keine heurigen Hasen.
"Coruna Radio", in dessen Seegebiet sich die Katastrophe in der Nacht abspielt, weiß erst einmal von gar nichts. Der englische Funker weckt den spanischen Kollegen auf 500 KHz und setzt diesem nun den Hut auf, um die Leitung im Funkverkehr zu übernehmen.
Die Unglückstelle liegt westlich des Trampelpfades durch die Biscaya, auf dem sich auf der Kurslinie Ushant (d'Ouessant)-Finisterre ständig zahllose Schiffe bewegen.
Aber nur drei Schiffe erfahren in der Nacht von der Katastrophe.
FIETE SCHULZE sendet das Alarmzeichen in der falschen Modulationsart. Demzufolge springen auf den umliegenden Frachtschiffen die automatischen Alarmanlagen nicht an, die die Funkoffiziere aus den Kojen holen und "Coruna Radio", dessen unbedingte Pflicht es gewesen wäre, den Notruf mit Alarmzeichen mit mehreren Wiederholungen auszustrahlen, unterläßt das.
So passiert bis zum nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr so gut wie nichts.
Auch mein Kapitän erhält erst vormittags, nach meinem Wachbeginn, von der Tragödie Kenntnis. Unser Schiff hätte auch schon acht Stunden lang am Unglücksort vorbei dampfen können.
Wir sind von dem Seenotgebiet noch sehr weit entfernt, um entscheidend eingreifen zu können. Dennoch hält Kapitän Düerkop mit vollster Maschinenleistung auf die Notposition zu.
Endlich um 11.30 Uhr erfahren alle an der Suche beteiligten und noch hinzueilenden Schiffe den vermeintlich genauen Ort des Unglücks. Der amerikanische Tanker JASMINA meldet die Bergung von sechs Leuten aus einem Rettungsboot.
Alles hält nun auf den von der JASMINA angegebenen Ort zu. Eine halbe Stunde, nach der ersten Meldung, teilt der Tanker uns allen die Übernahme von 12 Personen aus einer Rettungsinsel mit. Auch die geringfügige Korrektur dieser Position zu der ersten Positionsmeldung ist berücksichtigt.
Wir erreichen die von der JASMINA angegebene Position erst bei fortgeschrittener Dämmerung und drehen bis zur völligen Dunkelheit nur noch wenige Suchrunden.
Nahezu 20 Schiffe durchpflügten bis jetzt das Seegebiet, gemäß der von der JASMINA herausgehauenen Positionsangabe. Zeitgleich mit unserer Ankunft gesellen sich noch zwei spanische Kriegsschiffe und ein französisches Flugzeug hinzu. Schließlich sind erst 18 Besatzungsmitglieder von 42 gerettet worden und das Schiff ist schon vor 19 Stunden gesunken.
Keines der ca. 20 Schiffe und das Flugzeug der französischen Streitkräfte haben während des ganzen Tages weder Treibgut, noch den amerikanischen Tanker JASMINA gesichtet.
In der Nacht werden alle Suchaktivitäten unterbrochen.
Einige Schiffe verlassen jetzt das Seegebiet.
Am Morgen des nächsten Tages sind aber sieben DDR-Schiffe auf Position sowie die BRD-Schiffe STRASSBURG, CEUTA, BORUSSIA und ST. PETRI.
Bei Sonnenaufgang kommt wieder Leben auf die Seenotfrequenz.
Die JASMINA allerdings meldet die Bergung von drei toten Besatzungsmitgliedern.
Sofort wird das Schiff wieder hochnotpeinlich nach seiner Position befragt. Dieses Schiff treibt ja als einziges zwischen Öllachen und Treibgut. Der Tanker übermittelt uns allen seinen Schiffsort.
Kapitän Pfafferott des MS RHÖN koordiniert alle Aktivitäten der Suchschiffe. Die RHÖN war das erste Reederei-Schiff, das die vermeintliche Unglücksposition tags zuvor erreicht hatte. Die Küstenfunkstelle "La Coruna" hält sich diskret zurück. Wir können den Notverkehr, bis auf wenige Ausnahmen, in deutsch führen.
Der Funkoffizier der CEUTA reagiert auf die Positionsangabe der JASMINA nun in der einzig richtigen Form. Er teilt uns in deutscher Sprache mit: "Der spinnt, wir sind genau hier auf dieser Position. Der Tanker ist weit und breit nicht zu sehen. Der soll mal Peilzeichen geben!"
Er haut die JASMINA an und bittet um Peilzeichen.
Jetzt geht es los.
Die JASMINA sendet Peilzeichen. Auf den Schiffsbrücken wird der Tanker eingepeilt und die Koordinaten ausgewertet und ausgetauscht.
Jetzt keult alles mit Brassfahrt auf die JASMINA zu.
Die CEUTA ist als erster bei ihr. Von ihr kommt nun die alles entscheidende Meldung:
"Your correct position found by Decca is: 45° 35 N 10°12 W.
Am Vortag fuhrwerkten demzufolge zeitweise mehr als 20 Suchschiffe in einem Seegebiet ca. 30 Seemeilen südlich vom tatsächlichen Ort des Unterganges von MS FIETE SCHULZE herum.
Die spanischen Fregatten und das französische Suchflugzeug gleichfalls!
Für meine Leser, die nicht so im Stoff stehen, zur Erläuterung:
Das wäre ungefähr die gleiche Dimension, als wenn man in der Gegend von Wismar, bei schlechter Sicht, nach einem Verunfallten sucht, der aber in der Gegend von Rostock Hilfe erwartet. Oder globaler gesehen, nach Opfern einer in Davos hernieder gegangenen Lawine im Schnee von St. Moritz herum stochert.
Der amerikanische Tanker JASMINA ist das einzige Schiff auf der tatsächlichen Unglücksposition.
Im Nachhinein ist das völlig unfaßbar, aber keines der Suchschiffe ist auf den so furchtbar naheliegenden Gedanken gekommen, den Funkoffizier des JASMINA einmal eine Minute auf die Morsetaste drücken zu lassen und auf dem Peilstrahl dem Schiff entgegen zu dampfen.
Der amerikanische Tanker hatte den Atlantik bei schlechtem Wetter überquert und daher nur einen ungenauen "gegißten" Ort. Im Jahre 1967 werden Schiffspositionen vorwiegend noch mit dem Sextanten aus dem Sonnenstand und den Gestirnen ermittelt. Dafür benötigt der Nautiker einen klaren Himmel und einen deutlichen Horizont.
Zu dieser falschen Position hat die JASMINA nun annähernd 36 Stunden lang sämtliche zur Hilfe eilenden Schiffe und das französische Suchflugzeug "umgeleitet". Auch der JASMINA fällt anscheinend nicht auf, daß sie während diesen eineinhalb Tagen von nicht einem einzigen Schiff passiert wird, während teilweise sich zwanzig bis dreißig Schiffe in der Hilfeleistung engagieren.
Mit dem neuen europäischen Funknavigationssystem Decca haben die Amerikaner nichts am Hut. Die Schiffe meiner Reederei zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, bzw. nicht die entsprechenden Decca-Seekarten an Bord.
Die CEUTA aber ist gut ausgerüstet und leistete nun zur genauen Ortsbestimmung die Pionierarbeit.
Nach der CEUTA erreichen nach 13.00 Uhr nahezu zeitgleich die sieben DDR-Schiffe, die drei BRD-Schiffe BOURUSSIA, STRASSBURG und ST. PETRI sowie MS DIMITRI (Heimathafen Liberia) und die holländische Fregatte VAN NES F805 nun die richtige Position, auf der sich nunmehr vor 36 Stunden die Tragödie abgespielt hat.
Kapitän Pfafferott vom MS RHÖN ordnet jetzt die Suchstaffel. Wir stellen uns alle im Abstand von zehn Kabellängen in einer Reihe auf.
Jetzt unterhalten wir uns alle auf deutsch und per UKW-Sprechfunk. Nur dem MS DIMITRI wird jede Mitteilung in englisch und per Morsetaste übermittelt. Das Schiff ist nicht mit UKW-Sprechfunk ausgerüstet. "Ja und was machen wir mit VAN NES" fragt Kapitän Pfafferott, der Koordinator auf MS RHÖN. Im Umgang mit Kriegern ist doch kein Handeltreibender geübt. Es knackt im UKW-Gerät: "VAN NES hört!" meldet sich der holländische Krieger in gutem Deutsch. Er hatte ohnehin schon alle Manöver mitgefahren und sich, ohne an der allgemeinen Diskussion zu beteiligen, nahtlos im "Kollektiv" eingefügt. Die goldene Regel der Militärfunker: Alles hören, aber nichts sagen!
Kapitän Pfafferott hat das Seegebiet ganz proper abgesteckt und an der östlichen Kante seinen Suchkonvoi formiert. Eine kartographische Meisterleistung!
MT JASMINA wird von ihm als westliche Begrenzungstonne postiert. Das ist auch besser so!
Die Formation fährt nur ein einziges Mal mit gleicher Geschwindigkeit und gleichbleibenden Abstand zueinander über das abgesteckte Terrain, dann sind innerhalb von 90 Minuten alle Rettungsmittel und alle, die nach dieser Katastrophe noch leben, geborgen.
Jetzt hatten engagierte Fachleute die Regie übernommen, die ihr Handwerk hervorragend verstehen.
MS CEUTA birgt fünf Männer von einem kieloben treibenden Rettungsboot. Ursprünglich waren sie zu siebent. Zwei haben in der Nacht aufgegeben.
Eine Stunde später nimmt das Schiff zwei Überlebende aus dem Arbeitsboot der FIETE SCHULZE auf. Diese Überlebenshilfe haben sich der Storekeeper und der II. Koch bei dem unorganisierten Verlassen des Schiffes klargemacht.
MS BORUSSIA birgt eine beschädigte Rettungsinsel mit einer Stewardeß, dem Bootsmann und einem Lehrling. Ursprünglich war vier Personen die Besetzung des Rettungsmittels geglückt. Eine Stewardeß hat nach dem mehrfachen Kentern der beschädigten Rettungsinsel diese nicht wieder erreicht.
Gegen 15.00 Uhr sind alle Rettungsmittel, die MS FIETE SCHULZE zur Verfügung standen, auf drei Schiffen verteilt, samt der Überlebenden aufgenommen.
MS JOHN BRINCKMAN passiert innerhalb der Suchformation einen Rettungsring. Wir stoppen die Maschine und fischen den Ring auf. Er stammt laut Aufdruck vom MT JASMINA. Ich frage bei den Amerikanern nach und höre einen bedrückenden Situationsbericht: "Wir sahen während unserer Suchfahrt eine lebende Person, die sich an Treibgut über Wasser hielt. Beim Passieren warfen wir dieser den Rettungsring zu und fuhren einen Törn, zur Abbergung des Schiffbrüchigen. Als wir den Ort wieder erreichten, fanden wir nur noch das verlassene Treibgut und unseren leeren treibenden Rettungsring.
Später findet die MATHIAS THESEN den leblosen Körper in der Schwimmweste treibend.
Auf Grund seiner Schwimmwesten-Nummer erkennt man den Leitenden Ingenieur Rolf Gelbert.
Die kleine KRAKOW wird zur Bergung herbei gerufen.
Auf Grund ihres geringeren Freibords gelingt ihr das leichter, als dem Schwesternschiff der FIETE SCHULZE, dem Zehntausend-Tonner MATHIAS THESEN.
Diese erschütternden Meldungen gehen jedem an den UKW-Geräten sehr nahe.
MS JOHN BRINCKMAN wird vom MT JASMINA gerufen.
Nicht amerikanisch mit "Jaahn Brickmään" sondern in norddeutsch.
Bodo Greve war lange Zeit auf unserem Schiff der E.-Ing. Ihn hat gestern die JASMINA mit elf seiner Kameraden aufgepickt.
Er meldet sich bei uns.
Wir gratulieren Bodo zu seiner Rettung und sprechen unser Beileid zum Untergang von vierzehn Besatzungsmitgliedern seines Schiffes aus.
Nur kurz eingeflochten
Später unterhalte ich mich mit Bodo während der Seeamtsverhandlung in Warnemünde zum Untergang seines Schiffes: Die JASMINA hat ihn zwar gerettet, aber die Aktivitäten dieses Schiffes findet Bodo sehr kritikwürdig. Er erzählt mir, während wir Herrn Echlep's Seeamtsverhandlung kritisch verfolgen: "Wir schossen dem Tanker des nachtens unsere gesamte Signalmunition fast in die Brückenfenster und er dampfte trotzdem an uns vorbei."
Der Kapitän der BORUSSIA spricht jetzt aus, was auf allen Schiffen verdrängte Gewißheit ist:
"Herr Kapitän Pfafferott, wir haben jetzt alle Rettungsmittel geborgen, die ihren Kameraden vom MS FIETE SCHULZE zur Verfügung standen und alle, die mit deren Hilfe überlebten. Das Schiff sank vor ungefähr vierzig Stunden. Sie wissen das so gut wie ich, außerhalb eines Rettungsmittels lebt hier niemand mehr. Mein Schiff hat einen festen Fahrplan und wir sind zwei Tage im Verzug. Ich spreche den Schiffen ihrer Reederei mein Beileid für ihre auf See gebliebenen Kameraden aus. Wir setzen unsere Reise mit Zielhafen Hamburg fort. Dort übergeben wir auch die von uns geborgenen drei Besatzungsmitglieder der FIETE SCHULZE."
Auch jetzt nachwendisch lese ich immer noch in einschlägigen Veröffentlichungen, die seltsame Formulierung: MS VÖLKERFREUNDSCHAFT übernahm nach dem Untergang der FIETE SCHULZE die Leitung des gesamten Notverkehrs, da Coruna Radio den Aufgaben nicht gewachsen war.
Aber in diesem Falle veröffentlichen die Autoren auch heute noch die Lesart der DDR-Parteistrategen zur Kaschierung des Politikums, das sich damals dort draußen in der Biscaya an der Front des kalten Krieges abspielte.
Die VÖLKERFREUNDSCHAFT steuert mit Bestimmungshafen Algier, aus dem englischen Kanal kommend, die Position unseres Suchkonvois an. Ab Mittag gibt sie auf der Notwelle 500 KHz schon ihren "Senf" dazu. Anders kann ich es nicht bezeichnen.
Nun, gegen 16.00 Uhr als sich BORUSSIA und CEUTA nach hervorragend getaner Arbeit (!) verabschieden, übernimmt die VÖLKERFREUNDSCHAFT den Notverkehr?? Im Gegenteil, sie jodelt schon aus weiter Ferne und fordert die westdeutschen Schiffe BORUSSIA und CEUTA auf, unbedingt vor Ort zu bleiben und ihr die geborgenen Schiffbrüchigen zu übergeben.
Das hat absolut nichts mit der Leitung eines Notverkehrs zu tun, der war längst bewältigt!
Der Kapitän der VÖLKERFREUNDSCHAFT besteht sehr hartnäckig auf seiner Forderung. Auf allen Schiffsbrücken der DDR-Suchschiffe schämt man sich dafür.
Die DDR-Schiffe setzten die Suche währenddessen weiter fort, hören natürlich den Funkverkehr mit.
Die VÖLKERFREUNDSCHAFT hat einen Sender direkt nach Berlin geschaltet und von den dortigen Landeiern die Weisungen zu befolgen. Der Kapitän ist nicht zu beneiden.
Wiederum die BORUSSIA sagt jetzt dem hartnäckigen Kapitän der VÖLKERFREUNDSCHAFT sehr deutliche Worte: "Herr Kapitän, die von uns geborgenen Überlebenden schlafen jetzt. Sie sind gut versorgt und untergebracht. Wir sind ein Schnelldampfer und laufen 22 Meilen und damit direkt nach Deutschland. Sie gehen nach Algier und verlangen gegen jegliche seemännische Vernunft bei dieser Wettersituation das erneute Ausbooten der soeben Geretteten?
Diese Unvernunft kann ich nicht unterstützen. Mein Schiff ist ohnehin schon in erheblichem Verzug. Ich laufe ab nach Hamburg, over and out!"
Die JASMINA wartet auf ihrer Position. Sie möchte ihre 18 Logiergäste und die drei tot Geborgenen schon loswerden.
Die CEUTA reagiert nicht ganz so konsequent, wie der Kapitän der BORUSSIA, meldet aber doch erhebliche Bedenken an. Das Schiff geht nach Las Palmas und würde ohne weiteres die sieben geretteten Männer dort an Land absetzen.
Während diesen Disputs suchen alle DDR-Schiffe das Seegebiet weiterhin ab, aber alle hören mit, schütteln mit dem Kopf und schämen sich.
Ein jeder sagt: "Die VÖLKERFREUNSCHAFT könnte mich am Arsch lecken, wenn ich 40 Stunden in 19° warmer, aufgewühlter See gelegen hätte, jetzt, bei diesem Wetter, noch einmal in ein Boot zu steigen um statt nach Hamburg, nach Algier gekarrt zu werden!"
Die CEUTA wird auffordernd gebeten, auf das Eintreffen der VÖLKERFREUNDSCHAFT zu warten. Dieses Schiff hat die am härtesten betroffenen Schiffbrüchigen geborgen. Diese fünf Männer haben unter ständiger Aufmunterung des I. Offiziers sich auf dem kieloben treibenden Rettungsboot eineinhalb Nächte und eineinhalb Tage festgeklammert. Nun verlangt der Kapitän der VÖLKERFREUNDSCHAFT das erneute Ausbooten der jetzt versorgt schlafenden Männer. Der Kapitän der CEUTA befürchtet gesundheitliche Schäden und möchte die Schlafenden nicht wecken und sie erneut in ein Boot schicken. "Ich schicke ihnen meinen Arzt rüber" ist die Reaktion des Kapitäns der VÖLKERFREUNDSCHAFT.
Nun macht endlich einer mit Zivilcourage diesem blamablen Eiertanz, der damals als "Leitung des Notverkehrs" bezeichnet wurde, ein schnelles Ende.
Der Schiffsarzt der VÖLKERFREUNSCHAFT ruft von Bord der CEUTA seinen Kapitän: "Ich habe den I. Offizier geweckt. Er ist ansprechbar. Aber die sieben Männer bleiben an Bord dieses Schiffes. Es ist unverantwortlich, die Leute wieder in ein Boot zu setzen!"
Na endlich! Auf allen Schiffsbrücken unseres Suchtrupps plumpsen große Steine vom Herzen, eine ganze Geröllhalde! Nur nicht bei den Landeiern im Berliner ZK. Aber die sitzen ja auch hoch, trocken und warm.
Diese beauftragen nun ihren Frontberichterstatter an der vordersten Linie des kalten Krieges mit der Erläuterung der Situation in der Biscaya.
Karl-Eduard von Schnitzler, im Volksmund sehr treffend "Sudel-Ede" genannt, zieht in einer abendlichen Sondersendung auf seinem "Schwarzen Kanal" über die Kapitäne der BORUSSIA und CEUTA her. Diese haben in menschenräuberischer Absicht die Herausgabe der von ihnen (fast widerrechtlich) aus der See gefischten DDR-Bürger "verweigert".
Am Schluß der Seeamtsverhandlung in Warnemünde dankt der Vorsitzende der Seekammer, Friedrich Elchlepp gerade diesen, von "Sudel-Ede" auf Bestellung geschmähten Kapitänen für ihr hohes Engagement zur Auffindung und Rettung der Überlebenden des MS FIETE SCHULZE.
P. S.
Sudel-Edes Schwarzen Kanal konnte ich damals nicht sehen, da ich ja auf See war. Um jetzt hier keine falschen Anschuldigungen zu veröffentlichen, bat ich Sybille Walter vom NDR in Schwerin mir diese "Danksagung" von Sudel-Ede aus dem Archiv zu suchen. Im DDR-Archiv ist die Aufzeichnung nicht mehr vorhanden, aber unter den Mitschnitten, die damals die "Bonner Ultras" von jeder DDR-Sendung machten, fand die Journalistin Schnitzlers deplazierten Kommentar. Im Rahmen der NDR-Serie "Zeitreise" wurden die traurigen Geschehnisse zum Untergang der FIETE SCHULZE nun nochmals kommentiert. Aber nun als Tatsachenbericht und nicht nach Schnitzlers Art. Karl-Eduard von Schnitzler verstarb übrigens am Tag der Ausstrahlung dieses Beitrags.
![]() Die Elfen von der Elfenbeinküste
Die Elfen von der Elfenbeinküste
Das Bananenangebot in Guinea ist zunehmend rückläufig. Die Ursachen erkennen wir an den Bananenplantagen in Benti, auf denen wir ja selbst herumstreifen.
Die Pflanzer dort klären uns auf. Eine Bananenpflanzung bringt sechs Jahre lang brauchbare Erträge. Immer wenn das Büschel Früchte mit der Machete abgeschlagen ist und von einem Träger zum Sammelplatz getragen wird, haut der Mann mit der Machete nun die Staude kurz und klein. Der Schredder düngt und beschattet nun den Boden, damit er nicht austrocknet. Aus dem Wurzelstock sind zum Zeitpunkt der Ernte der Früchte schon mehrere Schößlinge hochgetrieben. Der kräftigste, in die Reihe passende, wird stehen gelassen. In neun Monaten trägt er dann wieder ein Früchtebüschel. Das größte, was ich in sechseinhalb Jahren als Deputatstaude mit nach Hause nahm, wog 48 Kg.
Nach sechs Jahren muß die Plantage umgepflügt und neu angelegt werden. Diese Erneuerung ist nach dem Ende der Kolonialzeit auf den verstaatlichten Plantagen in der Revolutionären Volksrepublik Guinea nicht vorgenommen worden. Auch die Wartung der Bewässerungssysteme wurde vernachlässigt. Ständige Unkraut- und Schädlingsbekämpfung ist die Voraussetzung für gute Ernten. All dies überließ die neue Staatsführung dem Selbstlauf. MS FRITZ REUTER und JOHN BRINCKMAN ziehen sich zunehmend aus dem unattraktiven Geschäft an dieser Küste zurück.
Diese Reise geht nach Abidjan. Abidjan ist die Hafenstadt der Republik Elfenbeinküste und das Attraktivste, womit sich die Westküste Afrikas schmücken kann. "Eckweich" und ich gehen an Land. Diesmal, vom Hafen aus gesehen, rechts über die Brücke. Treichville heißt dieses Viertel der Einheimischen. Hier steppt der Bär.
Links von der Brücke ist alles stinknobel arrangiert, dort ist nichts los und das auch noch teuer.
Für's erste landen Eckweich und ich in einer größeren Hütte, die sich laut Firmenschild "Bar" nennt. Um den Tresen stehen hohe hölzerne Hocker. Aus Edelholz natürlich. In dem Land ist aber auch jeder Donnerbalken aus Mahagoni.
Tropenholz ist hier Exportartikel Nr.1.
Reichlich viele volle Flaschen schaffen in der Hüttenbar eine beruhigende Atmosphäre. Die Bar ist landestypisch mit Masken dekoriert, die aus den stammseitigen Enden der Strunkse von Palmwedeln geschnitzt sind.
Wir besteigen die hohen Hocker am Tresen und erfreuen uns an kalten Drinks. Lange bleiben wir nicht alleine. Allerhand dunkel-pigmentiertes Weibsvolk zieht alle Register der circensischen Künste. Wir ziehen unsererseits an den Perücken der Mädels. Wo sich ein solcher Kopfputz anlüften läßt, stellt sich darunter Betroffenheit ein. Mit den kleinen verdeckten schwarzen Kringellocken auf dem Haupt, schwinden die Geschäftschancen der so benachteiligten Schönen ganz rapide. Aber jetzt zupfe ich vergeblich an solch einem Skalp, es reckt sich nur der Hals der Dame.
Das provoziert Entrüstung.
Wer schließlich die tausend Mark in sein Geschäft gesteckt hat, um aus den feingeringelten Drahthaar-Locken langes, glänzendes Haar frisörtechnisch hervorzuzaubern, der möchte nun seine Haarpracht nicht angezweifelt bekommen.
Ich spendiere der echthaarigen Schönen eine Cola.
Nun rückt sie mir vom Nachbarhocker noch heftiger auf den Pelz.
Eckweich stößt mich an und deutet mit einer verdeckten Kopfbewegung zu sich herab.
Seine Ische ist ihm noch näher gekommen. Sie massiert voller Inbrunst unterhalb der Griffleiste des Bartresens Eckis bestes Stück. Die feste Konsistenz dieses Gerätes und die beachtliche Ausbuchtung in der Khaki-Hose, bestärkt das Mädchen in seinen Bemühungen. Ecki langt in die Hosentasche seines gut sitzenden Beinkleides. Er muß sich am Tresen dazu etwas anlüften und zieht nun aus der Hosentasche seine Tabakspfeife hervor. Nun verbleibt in der Hose nur noch die handelsübliche Ausbuchtung. Der Pfeifenkopf, von seiner Tabakspfeife, zeigt deutliche Abriebspuren.
Das Mädchen guckt jetzt sehr betroffen. Nachträglich tut sie mir leid. Schließlich würde jeder Mann genauso bedeppert drein schauen, wenn er sich an einem schönen knackigen Busen echauffiert und die Betörte zieht danach eine Pampelmuse aus dem Mieder.
Wir ziehen lachend ein Haus weiter, anscheinend in das führendste Haus am Platze.
Es wir durch ein Wellblechdach beschirmt und läuft im Gaststätten- und Hotelführer unter dem Firmennamen "Wellcome-Bar".
Da drinnen geht's zu.
Die Bar ist fest in deutscher Hand. Ein Duzend Seeleute eines Schiffes der Rickmers-Reederei führen Regie. Sechs Matrosen des französischen Kriegsschiffes, das an der Bananenpier vor uns festgemacht hat, leisten aber auch bereitwillig ihre Kulturbeiträge.
Auf dem festgestampften Lehmfußboden in der Mitte der großen Hütte bitten meist die Elfenbein-Küsterinnen die Seeleute zum Reigen. Da die Mädels außer ihren hauptberuflichen Darbietungen auch das gut können, werden hier wahre Turniertänze zelebriert.
Wenn eines der Mädels ihren Galan weichgeklopft hat, (natürlich unter sorgfältiger Aussparung des wichtigsten Körperteils), zieht sich das Paar an der Bar vorbei auf den Innenhof dieser Begegnungsstätte zurück. Der Hof wird an seinen drei Seiten von flachen Gebäuden umschlossen. Der Baustil entspricht den Umkleidekabinen eines Freibades. Die Türen, der vielen kleinen Einzelkabinen, lassen bis zum Fußboden 30 Zentimeter Freiraum. Oben, bis zum Wellblechdach, bleibt ebenfalls ein halber Meter frei. Ein sehr luftiger Wohnkomplex aneinander gereihter Einraumwohnungen. Die Elfenbein-Küsterinnen sind zu jedermann freundlich und laden jeden Gast gerne zu sich nach Hause ein. Ein richtig hübsches Mädchen sitzt bei mir auf dem Schoß. Ich zupfe probehalber an ihrem Haupthaar, dabei reckt sich ihr Hals. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ecki wird gleichfalls heftig um den Bart gegangen.
Er und ich wollen nun die Gastfreundschaft der Langhaarigen nicht mit Füßen treten. Sie zeigen uns ihre Einraumwohnungen. Ecki betrachtet dabei die Wohnung Nr. 17 und ich glaube die Nr. 6, oder so.
Die Mädels sind so verliebt in uns, es kommt zum Äußersten. Das Mädchen ließ sich nur das Haupthaar frisörtechnisch lang ziehen, wie ich nach ihrem Entkleiden jetzt beiläufig bemerke.
Sie ist am ganzen Körper gleichmäßig unwahrscheinlich braun. Nicht einmal ein Bikinistreifen oder die Stelle vom BH-Verschluß ist heller. Nur die Fußsohlen und die Handflächen haben etwas weniger Sonne abbekommen.
Der Kontrast auf dem weißen Bettlaken ist schön anzuschauen.
Das Mädchen zieht zwei Kondome, nicht etwa drüber, sondern nach einander von mir wieder herunter. "Je suis pas malade!", ich bin nicht krank, beteuert sie trotzig. Zwischen ihrer wahren Liebe zu mir möchte sie keine solche Trennwand. Jetzt ist sie beleidigt und zickt mit mir. Das gibt mir Zeit das dritte Gerät aufzurollen.
Sie fügt sich jetzt in diesen Partnerschaftskonflikt.
Zur allgemeinen Erbauung stimmt sie während unseren gegenseitigen Liebesbezeugungen ein Liedchen an. Sie singt in ihrer afrikanischen Stammessprache, wahrscheinlich ein
elfenbein-küstisches Liebeslied von ewig Lieb' und Treu'. Die Leute sind nun mal sehr musisch veranlagt. Ecki, der Kunstbanause, stört den schönen Gesang. Er erkundigt sich lautstark quer über den Hof bei mir über den Fortgang der Dinge. Durch meinen Zeitverlust beim Anlegen der Schutzkleidung bin ich anscheinend etwas spät dran.
Wir gesellen uns im Foyer des Hauses wieder zu den übrigen honorigen Gästen und bestellen uns ganz entspannt einen großen kühlen Drink.
Unser Kommen und Gehen bleibt weitestgehend unkommentiert. Die Mitglieder der Rickmers-Besatzung beeindrucken durch Team-Geist. Sie leisten jeden Zögernden ihrer Truppe seelischen und moralischen Beistand, sich doch auch einmal auf dem Hinterhof etwas umzutun.
Bei der Rückkehr von diesem Erkundungsflug wird der Kampfflieger dann mit standing ovations von der ganzen Gang bejubelt und beklatscht. Das hebt erneut die Stimmung in dem Laden.
Die französischen Marinesoldaten in ihren chicen weißen Uniformen werden von den unschuldigen Schwarzäugigen natürlich erst recht angehimmelt. Die Mädels bemühen sich geradezu rührend, den schneidigen Burschen alles recht zu machen.
Dennoch sind die Mariners allesamt sehr unschlüssig. Ich erforsche den Grund: Sie haben keinen Kampfanzug dabei.
Ecki hat in der gewissenhaften Vorbereitung unseres Landgangs sich und mir einen Meter Verhüterli in die Brusttasche des Khakihemds gesteckt. Er entnahm sie seiner Schiffsapotheke. Die Dinger sind als Meterware an ihren Verpackungen aneinander geschweißt. Derart ausstaffiert, spielte es daher keine so entscheidende Rolle, daß meine Volkssängerin so verschwenderisch damit umging.
Ecki und ich entschließen uns zur spontanen Hilfeleistung. Wir ziehen unsere Meterware aus den Brusttaschen. Ein Beispiel gelebter internationaler Solidarität zur Linderung von Not und Bedrängnis.
Unsere zusammengelegten Restbestände von eineinhalb Meter Gummieerzeugnissen werden unter den Kriegern kameradschaftlich geteilt. Sie berücksichtigen dabei meinen Hinweis, daß, bevor das Kondom den Mann schützen kann, zuvor der Mann erst das Kondom vor den Angriffen der Geliebten schützen muß.
Mit den entsprechenden Nahkampfmitteln versorgt, ziehen nun die Franzosen in die Schlacht.
Ich veröffentliche solche "Anrüchigkeiten" so bedenkenlos, weil sich tiefgründigere Gedanken darüber nicht lohnen. Das ist männlicherseits doch nur Männerulk mit halberotischem Hintergrund und weiblicherseits die Erhaltung von Arbeitsplätzen und oftmals das Durchbringen einer vielköpfigen Sippe.
![]() Es scheppert mächtig gewaltig
Es scheppert mächtig gewaltig
In Abidjan empfange ich die Reederei-Order, eine Teilladung Bananen für Nantes in Frankreich zu übernehmen. Das produziert wieder das übliche Seekartenproblem. Ich werde abkommandiert, bei den "Heinzis" die Revierkarte für Nantes zu schnurren. Kurioserweise werden die sowjetischen Freunde sehr häufig mit "Karl-Heinz" umschrieben. In Anlehnung dessen laufen die Russen daher bei uns auf dem Schiff unter dem Kosewort: "die Heinzis".
Ich marschiere los, als Kontaktgeschenk führe ich eine Flasche Wodka mit. Ich finde den vorher ausgeguckten Dampfer an einer Pier in Treichville.
Nachdem ich bis zum I.Offizier weitergereicht werde, prüft der als erstes mein Dokument.
Mein Seefahrtsbuch ziert in russischer Anlehnung der Ährenkranz mit Hammer und Zirkel. Jetzt darf ich das Schiff bis zum Brückendeck betreten. Der Offizier bewaffnet sich dort mit einem Fernglas. Ich zeige ihm unseren weißen Schwan an der Bananenpier, am anderen Ende der Lagune. Die Schornsteinmarke der riesigen DDR-Flotte ist den Russen ja auch bekannt. Er überprüft visuell meine Angaben. Nun setzt er das Glas ab und sagt "prawilno, charascho". Er möchte mir die Seekarte gern heraussuchen nur kann er mit meiner Angabe des Hafens nichts anfangen. Ich spreche das Nantes französisch aus und schreibe es ihm auf. Erst als ich ihm den Hafen auf der Weltkarte zeige, sieht er durch. "Ah, Naant", sagt er und sucht mir die Karte aus seinem riesigen Fundus heraus. "HAHT" steht da auch tatsächlich in kyrillischer Schrift an dem Platz an der Loire, wo auf allen übrigen Karten der Welt NANTES steht.
Kapitän Düerkop findet sich Dank der russischen Seekarte bis zur Lotsenstation in der Loire-Mündung. An einem Tag sind die paarhundert Tonnen Bananen mit Elevatoren gelöscht. Wir machen uns auf die Socken nach Rostock. Die Biscaya ist an diesem Herbsttag unerwartet ruhig. Das trifft uns nicht unvorbereitet. Schließlich lege ich vor dem Auslaufen den Wetterbericht auf den Kartentisch.
Nahezu bleierne See empfängt uns nach dem Verlassen der Loire. Nur die Sicht ist bei dieser herbstlichen Hochdruckwetterlage miserabel. Das Schiff passiert Ushant und fährt auf dem nördlichen Kollisionsschutzweg durch den englischen Kanal.
Frühmorgens, kurz vor dem allgemeinen Wecken fliege ich im hohen Bogen aus der Koje. Bei der bleiernen See hatte ich das Kojenbrett weggelassen. Ich rolle bis zur gegenüberliegenden Seite meiner Kammer und prelle mir die Rippen an der Stütze des Tisches.
Es bedarf keiner näheren Erklärung, nur eine Kollision konnte dem Schiff die jähe Backbord-Krängung beibringen. Auf 36° steht der Zeigerausschlag des Krängungsmessers auf der Brücke.
Ich rapple mich unter dem Tisch hervor und ziehe hastigst die Uniform über den Schlafanzug. Der Funkraum grenzt gleich an meine Kammer. Hier klappe ich die Verschlußklappe des Notzeichengebers hoch und schalte den Mittelwellensender ein. Dann fliege ich in den angrenzenden Kartenraum, um mir die Position zu besorgen. Gleichzeitig mit mir stürzt der Kapitän herein. Er ist unwahrscheinlich schnell auf der Brücke. Ein Blick aus den großen Brückenfenstern zeigt uns eine fehlende Sicht und ein fehlendes Vorschiff. Das Schiff, das uns so übel zugerichtet hat, ist nicht zu sehen.
Kapitän Düerkop leitet die entsprechenden Maßnahmen ein. Er hat die Situation im Griff.
Bootsalarm wurde bereits ausgelöst. Chiefmate, beide Boote ausschwingen lassen, der Second und der Wachsmatrose zum Vorschiff. Kontrolle des Kollisionsschotts auf Wassereinbruch. Der I. Ing im Maschinenraum erhält seine Anweisungen vom Chief, der ist nun auch auf die Brücke gekommen. Auf UKW meldet sich unser Kollisionsgegner, der in dem unsichtigen Nebel immer noch nicht zu sehen ist. "Felix, mach mal", sagt mein Kapitän. Es meldet sich der Kapitän des MS V.S. TUBMAN, Heimathafen Monrovia. "Jaahn Brinckmään", may I help you?" Ich bitte ihn, stand by zu bleiben, bis der Kapitän sich einen Überblick verschafft hat. Der Erhalt unserer Schwimmfähigkeit muß noch ermittelt werden. Ich tausche mit V.S. TUBMAN unsere taktisch, technischen Daten aus, genau wie nach einem Autocrash die Beteiligten das auch machen sollten, nur haben die bei aller Aufregung wenigstens die absolute Gewißheit, daß die Straße unter ihnen nicht noch plötzlich absäuft und sie schwimmen müssen.
"Keule" Bürgin, II.Offizier kehrt von der Inspektion des Vorschiffes zurück: "Das durchgehende Kollisionsschott ist nicht beschädigt, das Schiff macht kein Wasser".
Auch die Maschine meldet eine trockene Bilge.
Allerdings fehlt dem Schiff vorn ein Stück an seiner Länge. Auch das Ankerspill ist verschrottet. Aus dem zusammengeknitterten Blechhaufen ragt aber die Ankerkette ins Wasser.
Das Schiff liegt nun hier auf dem Kollisionsschutzweg auf 40 Meter Wassertiefe manövrierunfähig vor Anker. Die gesamte Kettenlänge des Steuerbord-Ankers ist aus dem Kettenkasten gerissen und liegt nun am Meeresgrund und hält das Schiff auf Position. Nur mit ihrem Gewicht, ohne Anker!
"Ihr Anker hängt bei mir mit einer Fluke im Laderaum", informiert uns der Kapitän vom V.S. TUBMAN. Das Schiff hat beim Touchieren unseres Vorschiffes sich unseren Anker in seine Außenhaut gedrückt und die gesamte Kette aus dem Kettenkasten gerissen. Dann brach der Ankerschäkel. Die Kette sank auf den Meeresgrund, der Anker verblieb in der Bordwand des riesigen Massenguters.
Ein Ankerspill zum Hieven der Kette ist nicht mehr vorhanden.
Unser kleiner weißer Schwan hat sich mit seinen lumpigen 4850 BRT beim Feuerschiff Nord Hinder mit der zehnfachen Masse eines Schüttgutschiffes angelegt.
"Erbse", der I.Offizier und der IV.Offizier versehen gewissenhaft ihre Wache. Ein Ausguck steht auf der Brückennock, der Rudergänger in der Nähe des Ruders. Es lenkt der eiserne
Gustav. Das Schiff fährt wegen der schlechten Sicht auf 10 Knoten reduziert.
Unser neues Radargerät aus Leipzig vom Typ KSA3 ähnelt ganz stark den Geräten, die die alliierten Streitkräfte gegen die deutsche Wehrmacht 1944 bei der Ardennenoffensive verwendeten. Zudem steht der Radarmast auf dem Peildeck an Backbord-Seite und vor diesem der dicke Vormast des Schiffes. Dieser produziert einen Schatten auf dem Radarbildschirm. Ein Schattensektor von ca. 15°, so ein bis zwei Strich an Steuerbord ist fatal. Auf See gelten die gleichen Verkehrsregeln wie bei der STVO auch. Ohne vorfahrtsregelnde Verkehrszeichen gilt rechts vor links. MS V.S. TUBMAN kommt von Rotterdam mit kreuzendem Kurs zu MS JOHN BRINCKMAN. Er kommt von rechts - und wie! Mit voll Sprutz. "Erbse" sieht ihn im Radar nicht und wäre ausweichpflichtig. Der Dicke streift nur unser Vorschiff, aber auf Grund seiner Korpulenz und seiner 16 Knoten Marschfahrt, scheppert das mächtig gewaltig. Hätte er uns mittschiffs erwischt, wären wir in wenigen Minuten auf Grund gegangen oder gleich unter Wasser gedrückt worden.
 Das Kollisionsschott ist eine durchgehende Stahlwand vom Hauptdeck bis zum Schiffsboden. Dahinter liegt der erste Laderaum, davor als Knautschzone der Bug des Schiffes. Diese sinnvolle Konstruktion bewahrt nun das Schiff vor dem Totalverlust.
Das Kollisionsschott ist eine durchgehende Stahlwand vom Hauptdeck bis zum Schiffsboden. Dahinter liegt der erste Laderaum, davor als Knautschzone der Bug des Schiffes. Diese sinnvolle Konstruktion bewahrt nun das Schiff vor dem Totalverlust.
Als nach der Kollision Bootsalarm gedrückt wird, bedarf es keinerlei nähere Erklärungen, daß es sich diesmal nicht um eine der vielen Übungen handelt. Wer ohne eingehängtem Kojenbrett schlief, braucht sich jetzt nicht aus der Koje bemühen. Diese hat ihn ohnehin hinaus katapultiert, so wie ein störrischer Mustang seinen Rodeo-Reiter.
Unten im Matrosengang kleidet sich Matrose Matz in Windeseile an. Laut Bootsrolle hat er mit festem Schuhzeug, Kopfbedeckung und ordnungsgemäß geschnürter Schwimmweste auf seiner Manöverstation zu erscheinen. Dann reißt er sein Kammerschott auf und tappt dabei draußen im Gang ins Wasser. Fünf Zentimeter hoch steht es schon im unteren Gang. Er reißt das Schott von seinem Nachbarn auf, der trödelt noch. "Los, wir müssen raus, das Wasser kommt schon!"
Als das Schiff Nantes verließ, lag es ruhig wie ein Bügeleisen in der See. Keiner hat sich der Mühe unterzogen, alle losen Gegenstände seefest zu laschen oder wegzustauen. Der vorliegende Wetterbericht gab auch keinen Grund zur Veranlassung.
An der vorderen Stirnseite des Matrosenganges waren infolge der 36° Schlagseite unter anderem 148 volle Bierkästen vom Stapel gekracht. Die Flutwelle ausgelaufenen Biers passiert im Gang gerade Matzi's Kammer, als der schlaftrunkig über die Schwelle in das Bier-Selters-Cola-Gemisch tappt.
So hat die zusammengetrommelte Mannschaft in der O-Messe jetzt lange etwas zu lachen.
Wir liegen im Nebel auf der Fahrstraße und können uns nicht rühren. Eine Notmeldung brauche ich nicht rauslassen, die Position habe ich mir als erste Amtshandlung vom IV.Offizier geben lassen und sie vorsorglich im Notzeichengeber eingestellt. Der Zettel mit den Angaben liegt noch auf meinem Arbeitstisch. Ich sende an alle Fahrzeuge in diesem Seegebiet eine Sicherheitsmeldung, daß wir als Sicherheitsrisiko im Nebel mitten auf der Autobahn stehen. Zusätzlich tuten wir alle paar Sekunden mit dem Typhon. An steuerbord und backbord passieren uns im Nebel schemenhaft die dicken Dampfer.
Falls uns von denen einer auf die Hörner nimmt, sind bei ausgeklappten Booten, alle Mann zum Ausbooten mit Schwimmwesten in der höher gelegenen O-Messe versammelt. Nur die Wachen sind besetzt.
Nach meiner Sicherheitsmeldung haut mich die englische Küstenfunkstelle "North Foreland Radio" an, mit der Frage: "Ihre Position, bei uns hier in den englischen High Lands?" Ich ahne Schreckliches und schaue in die Seekarte. Nach meiner übermittelten Position liegt das Schiff tatsächlich in den englischen Bergen von Wales.
Peinlich, peinlich. Ich belege den IV. Nautischen Offizier. Er hat mir in seiner Streßsituation statt der östlichen Länge ein "W" hinter die Längenangabe geschrieben und damit den Dampfer im gepflegten Vorgarten von Rosamunde Pilcher ankern lassen.
Das Schiff hat vor kurzem Greenwich-Null überquert. Nachdem die Nautiker wochenlang hinter den Längenangaben ein "W" schrieben, gilt just kurz nach der Kollision ein "O" bzw. im englischen ein "E" hinter der Längenangabe.
Ich übermittle auf Weisung meines Kapitäns unserem Kollisionspartner nach üblicher seemännischer Praxis die juristische Floskel, daß wir ihn für alle entstandenen Schäden und Folgeschäden haftbar machen: "I hold you responsible for all damages and all damages of result!" Nahezu die gleiche Formulierung schickt mir sein Funkoffizier zehn Minuten später per Taste gleichfalls rüber.
Im Namen meines Kapitäns bedanke ich mich bei V.S. TUBMAN für den geleisteten Beistand. Er dampft jetzt zurück nach Rotterdam. Dort legt er auch unseren Anker an die Pier, der bis dahin seine Außenhaut verzierte.
Wir verhandeln mit unserer Reederei und mit Rotterdam. Von einem holländischen Schlepper aus, wird unsere Ankerkette abgebrannt und mit einer Markierungstonne auf den Grund versenkt. Die Kette wird später geborgen.
Die Versicherungen einigen sich bei der Schadensbegleichung auf fifty-fifty.
TUBMAN war im Nebel viel zu schnell und BRINCKMAN war ausweichpflichtig.
 Unser Vorschiff hat jetzt die Plattnase eines Pekinesen und darunter ein ziemliches Loch, als ob dieser das Maul aufreißt.
Unser Vorschiff hat jetzt die Plattnase eines Pekinesen und darunter ein ziemliches Loch, als ob dieser das Maul aufreißt.
Das Loch endet ca. einen Meter über der Wasserlinie. Mit Lecksegel und Leckwehrmaterial provisorisch abgedichtet, schwappt bei langsamer Fahrt die Bugwelle nicht übermäßig in den Schrotthaufen. Das Wetter bleibt ruhig, wir krücken mit eigener Kraft nach Hamburg in die Werft. Einige Schiffe fragen uns unterwegs, ob wir ihren Beistand benötigten.
Die Deutsche Werft Hamburg bastelt uns in nur fünf Tagen wieder einen schnuckligen Bug an das Schiff und weiter geht's.
![]() Nicht nach Hause, nach Kuba.
Nicht nach Hause, nach Kuba.
Zuerst nach Havanna, dann nach Nuevitas. In der großen Bucht von Nuevitas bringt uns der Lotse diesmal an die Pier von Pastelillo. Gegen 21.00 Uhr ist das Schiff fest.
Der Chief Mate, Gerhard Zehner, 'Keule' und ich beschließen trotz vorgerückter Stunde Companero Rudi zu besuchen. Rudi Baumung, den technischen Direktor der Zementfabrik, der zwar dicht an der Pier von Taraffa residiert, aber hier von Pastelillo so ca. fünf Kilometer weit weg wohnt. Unser Schiff liegt zwischen verkarsteten Kalksteinbergen mit spärlichem Strauchbewuchs. Eine schotterige Piste führt in gewundener Linie zu Rudis fabrica a cemento. Das erscheint uns zu umwegig. Die Dunkelheit setzt ein. Auf einem Bergrücken nehmen wir die Peilung und steuern unser Ziel im Direktflug an.
Nach einem Kilometer Geschwindmarsch wird dieser jäh unterbrochen.
Durch das deutliche metallische Klicken eines Gewehrschlosses. Mit "manos ariba" wird uns die tiefere Bedeutung dieses Geräusches erklärt. Nun stehen wir befehlsgemäß mit erhobenen Händen zwischen Dornensträuchern auf dem Geröllhang. Jetzt zeigt sich einer, mit dem Karabiner im Anschlag. "Wohin des Wegs so quer durch die Zona Militar?", werden wir befragt. Wir radebrechen unsere Unbedenklichkeitserklärung zusammen und nehmen dabei ganz zögerlich stückchenweise unsere erhobenen Hände wieder herunter. Daß wir Seeleute von dem Fruchtschiff dort unten sind und keine amerikanischen Todfeinde, stimmt den Amigo schon milder, er senkt nun seinerseits die Flinte. Als wir ihm dann noch erklären, daß wir amigos von companero Rudi sind und deswegen zu ihm hier durch die Taiga hetzen, klopft er uns fast auf die Schulter. Er bringt uns jetzt zu dem staubigen Schotterweg und ermahnt uns, von diesem nicht mehr abzuweichen.
Rund um die neue Zementfabrik ist Hochsicherheitszone.
"Ihr hattet Glück, einen alten abgeklärten Soldaten vor die Flinte zu laufen und nicht einem jugendlichen Heißsporn", meint Companero Rudi. Darauf erst einmal einen ordentlichen Kuba-Rum vom Besten, mit Schabeeis, 'Son'-Cola und grünen Limetten! Dafür laufe ich noch einmal durch militärisches Sperrgebiet!
Wir klappern am nächsten Tag die Lagune nach Baracudas ab. Beim Schnorcheln mit der Taucherbrille sind jede Menge auszumachen. Aber auf die Tricks, mit denen wir die afrikanischen Kollegen angeltechnisch überlisteten, fallen die kubanischen Fische nicht herein.
Wir erangeln keinen einzigen. Die Barkasse tuckert am Mangrovenufer entlang und überholt dabei einen fetten Rochen. Er zieht in dem klaren Wasser am Grund der Lagune entlang. Ich stülpe mir die Taucherbrille über, Flossen, Schnorchel, stürze mich mit der Harpune bewaffnet rücklings über die Bordwand und knalle mit dem Mors auf den Grund. Das Wasser ist überraschend flach. Ich schmeiße Flossen, Brille und Schnorchel wieder ins Boot zurück und stiefele wie ein Storch hinter dem Rochen her. Unterwegs denke ich physikalisch nach, vom dünneren in's dichtere Medium zum Einfallslot hin, oder weg, oder wie war das im Physikunterricht. Auf alle Fälle darf man nicht direkt auf das Objekt zielen. Das berücksichtige ich auch und haue den Harpunenpfeil zwei Meter tief in den Mangrovengrund.
Beim Tauchen zwischen den Molensteinen und Pfählen der Pier bemerken wir Schwärme von zum Teil recht stattlichen Barschen. Wir verlegen uns auf's Angeln.
Dazu muß aber wiederum erst die ortsspezifische Methode ermittelt werden.
Angeln ist nicht so mein Ding.
Ich beziehe mit Brille und Schnorchel unter Wasser Beobachtungsposten und beschreibe den Anglern auf der Pier die Verhaltensweise der kubanischen Fische.
Auf Käse gieren sich die Fische sofort. Nur muß das Stück am Haken knochenhart sein. Sonst fressen den weichen Köder die kleineren Fische oben schon ab, bevor die großen brauchbaren darunter zum Zuge kommen. Auch muß das Senkblei drei Kilo wiegen, damit der Köder an den kleinen verfressenen, oben schwimmenden Fischchen fix vorbei rauscht.
Schließlich angeln wir zu zweit gänzlich mit Taucherbrille und Schnorchel unter Wasser. Solch einer Art Angeln kann ich auch etwas abgewinnen.
Wenn ein kleiner untermaßiger Fisch anbeißen will, ziehen wir ihm den Köder vor der Nase weg und wünschen ihm ein langes Leben. Die Dicken, die ihr Leben schon genossen haben, lassen wir anbeißen. Schon bald sind unsere zwei unter Wasser deponierten Einkaufsnetze vollgeangelt. Ein Dwarslöpper-Krebs hat sich freiwillig hineingezwängt und einen Fisch angefressen. Ein Kollege von ihm versucht das beim Angeln an meinem Bein. Er büßt dabei an meiner muskulösen Sportlerwade einen Eckzahn ein. Wir haben solcherart ratz-batz für die gesamte Besatzung ein Abendessen zusammengeangelt.
Am Korallenriff vor der Laguneneinfahrt gehen wir auf Unterwasser-Expedition. Nach den großen Muscheln und den roten, kalkigen Seesternen besteht auch nach vielen Kubareisen an Bord noch Nachfrage. Später verbieten die kubanischen Behörden die Ausplünderung der Riffe, zum Glück. Vor allem verglichen mit den Raubzügen der "Heinzis" sind wir da Weisenknaben. Die kommen nach ihrer Riffausplünderung mit vollen Kartoffelsäcken zurück, so wie ein Spreewaldkahn von der Gurkenernte.
Peter Hallier bleibt oben in der Barkasse. Wir anderen drei grundeln mit Flossen, Brille und Schnorchel die herrliche Unterwasserwelt ab. Ab und zu reichen wir Peter eine Muschel aus dem Wasser in den Kahn und tauchen wieder ab. Da kommt dem Sportsfreund neben mir seine soeben aus dem Wasser gereichte Muschel beim Abtauchen wieder hinterher.
Beim nächsten Auftauchen zum Luftholen jodelt Peter oben im Boot und verweigert die Annahme weiterer Warenlieferungen. In dem ihm gereichten Schneckengehäuse hatte sich gut getarnt eine kleine Muräne eingenistet. Als Peter mit dem Daumen beim Abnehmen des großen Schneckenhauses hineinlangt, beißt ihn das Biest in den Daumen. Jetzt kommt bei ihm keine Freude mehr auf. Der Daumen schwillt nun an und bewirkt die Rückkehr zum Schiff.
Auf einer der nächsten Nuevitas-Reisen machen uns unsere Landsleute von der
Zementfabrik eine besondere Freude. Sie haben einen 17-Mann-Bus aus der DDR mitgebracht. Ihr kubanischer Fahrer bringt uns damit nach Santa Lucia. Das war vor der Revolution eins der traumhaften Seebäder mit herrlichem ATA-feinem weißen Sand. Jetzt gammelt mangels Touristen die Anlage vor sich hin. Wir sind die einzigen Leute weit und breit.
Ein Maschinenhelfer ist der erste im Wasser und ehe ihm jemand folgen kann, kommt er schwimmend zurück gekeult. Er schwimmt außer Atem fast noch den Sandstrand hinauf. "So...h... so ein großer ...Fisch... war immer hinter mir... her" keucht er außer Atem und zeigt mit seinen nicht ausreichenden Armen einen Fisch, der von ihm bis irgendwohin reicht. Ich nehme meine Schnorchelausrüstung und die Harpune mit und schaue nach. Das Wasser ist kristallklar. Ah ha, zwei Baracudas, aber nicht von der sagenhaft geschilderten Größe. Unter Wasser zeigen sie etwas über zwei Meter, aber da erscheint ja alles ein Drittel größer. Ich wende den Kopf und bemerke noch ein paar auf der anderen Seite und erst recht hinter mir schauen sie mir zu und lassen ganz dekorativ ihre Eckzähne über der Unterlippe blitzen. Keiner von der Bande zeigt mir die Breitseite, jeder böte mir für einen Harpunenschuß nur die schlanke Stromlinienform. Ich tue ihnen nichts und sie mir auch nicht. Aber erst in letzter Sekunde, wenn ich mit meinem Harpunenpfeil den Kameraden schon fast auf sein Fischmaul klopfen könnte, gibt er den Weg frei. Aber dann wieder völlig überhastet, er geht ab, wie eine V1.
Ich bringe einen Igelfisch an den Strand, den ich mit dem Dreizack gefangen habe. Unter Wasser habe ich ihn in mein Einkaufsnetz gesteckt, an die Luft gebracht, pumpt er sich gewaltig auf. Die Stacheln spießen durch die Maschen. Er muß vorerst dort drin bleiben. Jetzt laufen alle zusammen. Einer streicht dem Fisch über seinen Schmollmund und meint "Und hier hat er sein ...."Maul" wollte er sagen, statt dessen kam ein lautes "Au". Der Fisch hat statt Zähne zwei Schneiden einer Kneifzange und der Forscher nun einen quergeteilten blutenden Fingernagel. Die Jungs haben die Fische gelegentlich beim Angeln auf Reede erbeutet. Mit Formalin präpariert, entstanden daraus dann allerlei Lampenmodelle. Ich habe nur zwei Karibik-Reisen gebraucht, um festzustellen, daß all diese Lebewesen in ihrer natürlichen Umgebung belassen, viel schöner aussehen.
Bootsmann Schweinchen hat eine Muräne an der Harpune und jodelt um Unterstützung. Wir ziehen gemeinsam das zähe Tier aus der Höhle. Die wollen wir an Bord verspeisen. Ohne Kopf soll das eine Delikatesse sein, habe ich kürzlich gelesen.
Ein paar Barsche, Schnecken und Seesterne mußten auch noch dran glauben, dann blasen wir zum Rückzug. Wir holpern mit dem Bus auf staubiger Aschenbahn durch menschenleeres Weideland. Dann bleibt der Bus stehen. Unsere Ingenieure geben in Teamwork mit dem kubanischen Fahrer ihr Möglichstes. Eine Gelenkwelle ist gebrochen. Finito de la musica!
Am Horizont taucht eine Staubwolke auf. Sie kommt auf uns zu. Als sie bei uns ist, überholt die Wolke den bremsenden Verursacher. Das ist zum Glück die Policia. Die bitten wir um einen Telefonanruf nach Nuevitas zu Companero Rudi. Er möchte bitte ein Abschleppfahrzeug organisieren. Leider entpuppen sich die beiden rettenden Engel als die einzigen richtigen Holzköpfe, die ich in Kuba kennen gelernt habe. Sie meinen, dort vorn fährt ein Bus und hüllen uns beim Gasgeben in die Staubwolke.
Die Telefonleitung läuft parallel zu unserem 'high-way'. Es ist eine Oberleitung. Die Masten bilden in die Erde gerammte Bambusstangen. Auf die oberen Enden der Bambusstangen sind Flaschen gesteckt, deren Boden vorher abgeschlagen wurde.
Um die Flaschenhälse, die hier als Isolatoren fungieren, ist der blanke Draht gewickelt. Das ist die Erklärung dafür, daß stets, auch nach einem Wirbelstürmchen, weite Gebiete von der Außenwelt abgeschnitten sind. Die von dem Wind vorübergehende Obdachlosigkeit hat ähnliche Ursachen und dauert so lange an, bis die weggeflogenen Wellblechplatten aufgefunden sind und wieder mit Bindfaden an den Dachsparren aus Bambus angebändselt werden. Dafür können die armen Bewohner solcher Behausungen nichts. Aber ich finde es nur unfair, jedem Wirbelsturm die Schuld in die Schuhe zu schieben und ihn für hunderttausendfache Obdachlosigkeit und den Zusammenbruch von Strom- und Telefonnetz allein verantwortlich zu machen. Das gilt erst recht für die reicheren amerikanischen Bewohner der Südstaaten. Wer nur in zusammen getackerten Sperrholzplatten wohnt, darf sich nicht erschrecken, wenn diese ab Windstärke 9 davonfliegen.
Dem Rat der beiden unfreundlichen kubanischen Polizisten folgend, begeben wir uns in die Richtung, wo angeblich ein Bus verkehren soll. Der kubanische Fahrer bleibt am Wrack des Robur-Busses zurück. Wir sprechen dem Amigo Mut zum Durchhalten zu und schenken ihm alle unsere Vorräte. Leberwurstbrötchen und Mineralwasserflaschen.
Nach einigen Kilometern fröhlichen Wanderns gelangen wir an eine Kreuzung. Dort lagern wir lange Zeit. Am Horizont taucht verheißungsvoll die obligatorische Staubwolke auf, sie entpuppt sich näherkommend tatsächlich zu einem Bus.
Unser wildes Gestikulieren stoppt das Gefährt. Ach du lieber Gott, der Bus ist gerammelt voll. Wann ein Bus voll ist, kann sich ein deutscher Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel überhaupt nicht vorstellen, wenn er noch nie die Ehre in einem russischen, chinesischen oder kubanischen Bus hatte. In diesem Fall jetzt, stehen zwei Mann vor der geöffneten Bustür und der plattgedrückten Menschenwand, dann holen die verbleibenden 15 Mann Schwung, stemmen sich wie beim Anschieben eines LKW in den Schotter der Straße und drücken so viele Leute hinein, wie das Komprimat in dem Bus noch aufnimmt. Im ganzen zwei! Dann federt der Innendruck aus dem Bus zurück, der schon umzukippen drohte. Wir Außenstehenden sind der Tür beim Schließen behilflich und begeben uns wieder auf den langen staubigen Rückweg zu dem havarierten Robur-Bus. Dort müssen wir biwakieren.
Ich ziehe mit noch einigen die Übernachtung am Lagerfeuer im Freien vor. Auf den Blechsitzen im Bus kann ich nicht pennen. Wir braten im Feuer Fische am Harpunenspieß. Aber ohne Salz schmecken sie scheußlich. Um an Feuerholz zu kommen, wracken wir die Pfähle eines Weidezaunes ab. Die sind ohnehin morsch und längst erneuerungswürdig. Ein Skorpion rennt jetzt mit erhobenem Stachel auf einem brennenden Balken auf und ab. Wenn das Feuer niedergebrannt ist, wird es recht maikühl in dieser romantischen karibischen Nacht. Etliche fette Dwarslöpper trampeln klappernd an uns vorbei. Außer, daß ich bisher nicht wußte, das Dwarslöpper des nachtens auch im Trockenen unterwegs sind, gibt es keine besonderen Vorkommnisse.
Am nächsten Tag um 11.00 Uhr kommt uns ein anderer Bus holen. Companero Rudi, der Tausendsassa, hat einen aufgetrieben.
Unsere beiden in den Bus Gepressten schlugen sich nach Nuevitas durch und langten dort allerdings erst nach Mitternacht an.
Da habe ich doch lieber im frischen karibischen Passat übernachtet, als im Pferch solcher Transportmittel.
Für den kubanischen Fahrer hat sein Amigo nur Wasser und Proviant mitgebracht.
Einen Abschleppdienst konnte Rudi noch nicht auf die Beine stellen. Unsere Muräne und noch andere Mitbringsel muffeln jetzt aber schon verdächtig, nach den 24 Stunden ohne Kühlung.
Das war einmal eine etwas anders geartete Abenteuertour als eine Pauschalreise bei TUI. Wir haben sie verdient.
Wir verabschieden uns von den gefälligen Freunden, die sich in Nuevitas weiterhin verbissen bemühen, aus den umliegenden Kalksteinen Zement zu brennen. Im Gegenzug haben wir ihnen das Überleben auch etwas erleichtert. Sie brauchen ja auch Tod und Teufel. Seife, Kerzen, Mostrich und Verpflegung sowieso. Bis zu unserem nächsten Überfall haben sie gerade wieder genügend Zeit, ihre von uns weggeputzten Rum-Vorräte aufzufrischen.
![]() Die Schleudertruppe "Fruchtimex"
Die Schleudertruppe "Fruchtimex"
MS JOHN BRINCKMAN verläßt mit voll Schiff Zitrusfrüchten Kuba in Richtung Rostock. Der Kapitän quetscht das Schiff durch den Providence Channel hinein in das Bermuda-Dreieck. Ich tupfe mir nach geglückter Passage dieses Seegebietes wieder den Angstschweiß von der Stirn, da empfange ich das ökonomisch unverständlichste Telegramm meiner Laufbahn. Kapitän Düerkop schaut mir tief in die Augen und wedelt wie ein Scheibenwischer mit der Hand vor meinem Gesicht, um meine geistige Verfassung zu prüfen. Der Tropenkoller fordert gelegentlich seine Opfer. Er liest:
kursaenderung nach las palmas stop dort ladungsuebergabe an das brd-schiff ms tanger stop nach entloeschung sofortiges ablaufen nach conakry wegen grossem ladungsangebot - seereederei befrachtung
Telefonisch versucht der Kapitän dieses Husarenstück der Dipl. Ings. Öks. abzubiegen. Ohne Erfolg, Befehl ist Befehl. Der Kapitän malt die Kursänderung zu den Kanarischen Inseln in den großen Atlantikübersegler.
An der Pier in Las Palmas liegt das BRD-Stückgutschiff MS TANGER. Es wartet mit offenen Luken auf uns. Wir gehen im Päckchen längsseits und schlagen mit eigenem Geschirr unsere 3200 Tonnen gekühlte Zitrusfrüchte in die warmen Laderäume des Stückgutfrachters MS TANGER um. Zwischen dieses Gewirr von den schiffseigenen Ladegeschirren langen von hoch oben noch landseitige Kräne hinein und zerren zusätzlich noch aus den Luken, was die Schauerleute nur auf Paletten packen können. Diese Hieven werden derweil an die Pier gesetzt.
Hastig laufen wir ab nach Conakry.
Der BRD-Frachter haut sich die an der Pier abgesetzten Paletten mit den schwitzenden Fruchtkartons noch in die Luken und versegelt nach Rostock. Das nochmalige Umschlagen der Fruchtladung in die ungekühlten Laderäume verursacht natürlich eine Qualitätsminderung und imense Chartergebühren für die TANGER und zweimal Hafengebühren in Las Palmas. Alles in wertvollen Valuta!
Conakry hat uns wieder. "Bon jour, Monsieur Macouli, ca va?" seine Tasche wird wieder gefüllt, aber im Bananenschuppen herrscht die gewohnte gähnende Leere.
Kapitän Düerkop steht kurz vor einem Infarkt. "Ja wenn ihr jetzt erst kommt, vor zwei Wochen war hier alles voll!" beteuert der Vertreter von Fruchtimex.
Frucht-Im-und Export ist die Berliner volkseigene Schleudertruppe, die sich so dilletantisch mit der Südfrüchte-Versorgung der werktätigen Massen in der DDR beschäftigt.
Und deren in Conakry stationierter Einkäufer, bestaunt nun einmal in seiner Laufbahn dort einen vollen Bananenschuppen. Jetzt schreit er ganz fürchterlich nach einem Schiff, das die paar Büschel Bananen schnell aus dem Schuppen räumt. Der Fruchtimex-Vertreter macht von Conakry aus bei den SED-Wirtschaftsexperten in Berlin so viel Wind, daß diese wohl glauben müssen, jetzt gibt es in der DDR Bananen satt. Daß Schiffe nicht fliegen können, ist ihnen bei ihrem Wirtschaftsstudium in Moskau nicht erklärt worden.
Wir laden in Conakry so viele Bananen, daß die Besatzung unseres Schiffes ausreichend versorgt ist.
Gelb werden sie natürlich auch, das ist das Schöne daran, Bananen aus Guinea zu holen.
Die schönen gelben Früchte immer nur außenbords zu klatschen, tut mir leid.
Jetzt mache ich Bananenwein!
Weinhefe und ein Gärröhrchen habe ich mir Reisen vorher schon besorgt. Vom Koch bekomme ich für mein Vorhaben ein hölzernes Sauerkrautfaß. Der Zimmermann baut einen saugend passenden hölzernen Deckel und der E-Mix liefert Dichtungskitt zum luftdichten Verschluß.
Auf hundert Liter gelungenen Wein sind doch alle an Bord ganz spitz. Schweinchens Truppen schleppen die edelsten Früchte in meinen Funkraum, damit könnte ich einen Kesselwagen voll Wein ansetzen. Im Umformerraum maische ich ein und koche in der Kombüse mein Zuckerwasser. In den Putzlappenballen der Maschine findet sich auch geeignetes Material für einen Preßsack. Ein Seeschiff hat eigentlich alles und eine Schiffsbesatzung, mit den breitgefächerten Talenten, bewältigt mit Bordmitteln auch jedes Problem.
Mein Wein beginnt im Gärröhrchen zu gluckern.
Nur wird es im Norden ziemlich frisch im Faß meines Heurigen. Der benötigt zum Gelingen doch Wärme. Das Faß wird beheizt! Dann kommt Seegang auf. So ein Wein braucht schließlich zum Gelingen viele Wochen und eigentlich dabei seine Ruhe.
Das Faß muß ordentlich verzurrt werden.
Der Federweiße schwappt aus dem Gärröhrchen und hebt den Deckel an.
Ich muß neu verkitten.
Als alles zur Ruhe gekommen ist, wird in einem geheiligten Ritual das Eröffnungsverfahren eingeleitet.
Ich habe eine ganz fantastische ca. dreißigprozentige Bananen-Essigessenz produziert. Mit vier Mann wuchten wir das Faß samt Gärröhre über den Schiffszaun. Eine Opfergabe für Rasmus, obwohl der mit seinem Seegang den Wein eigentlich maßgeblich versaut hat.
![]() Ein Monsterkaktus am Warnemünder Strand
Ein Monsterkaktus am Warnemünder Strand
Die nächste Reise studieren wir jetzt die richtige, knallharte Fruchtschiffahrt. Das Schiff geht nach Kolumbien, Ladehafen Santa Marta.
Santa Marta ist ein malerischer Flecken.
Gleich hinter dem Fruchtschuppen erhebt sich das Gelände zu den erhabenen Gipfeln der Sierrra Nevada de Santa Marta.
An der Frucht-Pier mit Gleisanschluß und Elevatoren pulsiert das Leben. Das flutscht nur so und der Bananen-Nachschub floriert. Nur bei unserem Ablader gerät er kurzfristig ins Stocken. Nur vier Stunden stagniert der Nachschub. Die Festmacher schmeißen unsere Leinen los. "Sie warten draußen auf Reede, Kapitän, bis ihre Firma wieder liquide ist."
So läuft das hier. Auch hier haben wir wieder ein wenig mehr Zeit als die Kollegen auf den United-Fruit-Jägern.
Wir bilden eine Seilschaft und besteigen die Anden. Die unwahrscheinlich wuchernden Kakteen an den Hängen stechen uns ins Auge. Sie werden hier als unwillkommenes Unkraut angesehen und haben etwa den Stellenwert, wie bei uns ein Klettenbusch.
Zu fünft ziehen wir los, mit Tragetüchern, Stricken und Macheten. "Bringt mir mal einen mit", ruft der E.- Ing. vom Winchenhaus. Er kann nicht von Bord und muß während des hektischen Ladebetriebes seine Elektrik bemuttern.
An den Andenhängen fällt sich jeder ein, zwei handliche Exemplare und verpackt sie für den Transport nach den Regeln des Unfallschutzes. Für den E.-Ing. fällen wir ein stattliches Exemplar und haben daran schwer zu buckeln. Das Gewächs mißt über drei Meter. Durch das Außenschott in den Gang befördern wir noch das Langholz. Dabei müssen wir aber schon die Tricks der Teppich-Rollen-Transporteure anwenden.
In die Kammer vom E-Mix paßt das Geschoß natürlich nicht hinein. Nur ganz schräg, ein Stück ragt noch in den Gang hinaus. Da tritt aber niemand drauf. Der E-Mix ist bei der Anlieferung nicht zu Hause. Als er kommt, motzt er herum: "So einen Koventsmann wollte ich nicht." Schweinchen holt mit seinen Leuten das Prachtstück wieder ab und lascht es an Deck hochkant am Winchenhaus fest. Dort steht es zwei Reisen und grünt dennoch prächtig im Saft vor sich hin. Danach geht das Schiff in Warnemünde im Frühsommer in die Werft. Die Decksgang entlascht den Riesenkaktus und zieht damit an den Strand. Dort graben sie ihn ein und sitzen mit ihren Reederei-Tropenhüten drum herum und spielen Mexiko.
Ein älterer Herr kommt des Wegs und meint: "Jungs, verkauft mir diesen Kaktus. Ich gebe euch 50 Mark!" "Na klar, ist gemacht Meister", besiegelt Schweinchen das Geschäft und macht sich flugs mit seinen Leuten auf, die 50 Mark im "Atlantik" nutzbringend anzulegen.
![]() Schmalzstullen für Kuba
Schmalzstullen für Kuba
Laut Kalender ist Pfingsten und laut Reederei-Order ladet MS JOHN BRINCKMAN in Leningrad Schmalzfässer. Sozialistische Hilfe zur Verpflegung der kubanischen Bevölkerung. Vier Kühlluken werden mit 3000 Tonnen Schweineschmalz in Fässern beladen, davon können sich die "Kubis" etliche Schmalzstullen schmieren.
Leningrad im Frühsommer ist ein Erlebnis. Die Seemannsbetreuung gibt sich wieder alle Mühe, uns die Schönheiten dieser geschichtsträchtigen Stadt näher zu bringen. Täglich rollt ein Bus vor die Gangway
Der Interclub betreut in jedem Hafen der Sowjetunion jeden Seemann nahezu in seiner Muttersprache. Unsere Dolmetscherinnen haben Germanistik studiert, sprechen hervorragend deutsch und beschämen uns, mit ihren Kenntnissen der deutschen Geschichte. Dafür verdienen sie 70 Rubel im Monat.
Die Mädels führen uns durch Peterhof, die Eremitage und die Isaac-Kathedrale. Neunzig Meter unter der Erde fahren wir Metro und begutachten die ungewöhnliche Marmor-Architektur der Station "Aftowo". Hier liegen auf dem Bahnsteig rote Teppiche, aber keine Kippen, kein Papier-Schnipselchen beeinträchtigt die Sterilität, die von Kronleuchtern aus Kristallglas ins rechte Licht gesetzt wird.
Im Kirow-Theater beeindruckt mich die jugendliche Liebhaberin des "Rigoletto". Sie verfügt über einen gewaltigen Resonanzboden und schmettert ihre Arien in der klangvollen russischen Sprache zu uns herab, daß selbst hinter ihr noch die Kulissen wackeln.
Nur die große Klappbrücke über die Newa macht sich unbeliebt. Spät abends ragt diese imposante Stahlkonstruktion in das fahle Licht der Leningrader Nacht. Wir aber müssen zum Hafen auf die andere Seite der Newa. Am Taxistand stehen in ordentlicher Schlange, nicht etwa die Taxis, sondern die potentiellen Fahrgäste. Etwa fünfzig Leute und etwa im Stundentakt kommt ein Taxi.
Diese halten auch generell nur an den gekennzeichneten Haltestellen, das ist ihnen so vorgeschrieben. Wir bringen quer über die Straße aufgestellt eine zum Halten. Der Taxistand ist hundert Meter entfernt, eine Traube Leistungssportler rast Fäuste schwingend auf uns zu. Der Taxifahrer hat uns als Ausländer erkannt und mahnt beim Einsteigen hektisch zur Eile: "Dawai, dawai", mit noch offenen Türen quietscht der 'Wolga' davon.
Der Mann ist deutschfreundlich, was ich nicht verstehen kann. Er hat in Weimar als Wehrpflichtiger gedient und fand alles ganz gut. Er bringt uns zum Hafen. Wir geben ihm jeder einen Rubel. Die Fahrt hätte 60 Kopeken gekostet.
Nach fünf Tagen Beladung zotteln wir mit den Schmalzfässern los. Bestimmungshafen ist Santiago de Cuba. Das Nachbargrundstück von Santiago haben sich die Amerikaner unter den Nagel gerissen und dort ihren Stützpunkt Guantanamo etabliert. An deren Gartenzaun schippern wir nun als Blockadebrecher mit unserer Schmalzladung vorbei.
Die dort gelangweilten "marins" machen aus uns eine Übung, umschwirren unser Schiff mit ihren Kampfblechen, fragen per Morselampe laufend "what ship?" und filmen uns, beinebaumelnd aus der offenen Schiebetür ihrer Hubschrauber.
Der kalte Krieg hat sein eigenes Flair.
Vorn an unserem Bug steht in riesigen Lettern JOHN BRINCKMAN, am Heck quer steht für jedermann sichtbar der Heimathafen "Rostock". An der Gaffel weht die DDR-Flagge. Aber jedes Kampfblech der Ammis fragt nun per Morselampe "what ship?"
Die Amis haben längst unseren Funkverkehr mitgehört und sind auf die spärlichen Informationen meiner Morselampe bestimmt nicht angewiesen.
Aber, um dem gerade frisch ausgebildeten Rekruten das Selbstvertrauen zu geben: "Na bitte, Jackson, du kannst doch das Morsealphabet!", funzelt jedes Kampfblech der Armada vor Guantanamo nun jeden "Blockadebrecher" an.
Nach dem dritten "what ship", pfeife ich "Jackson" was und bratze ihm " F U C K O F F" rüber, obwohl ich mit der Morselampe ganz gerne hantiere. Aber nicht mit Kampfblechen, alleine zum Zwecke des Aushorchens und Übens, sondern mit friedlichen Handelstreibenden, um sich etwas mitzuteilen. Auf Geheiß unseres Politniks müssen wir das provokative Überfliegen des Hoheitsgebietes der Deutschen Demokratischen Republik durch die US-Aufklärer dann ständig auf das schärfste verurteilen. Das tun wir auch und winken in den Verurteilungspausen den Beinebaumlern im Helikopter zu, die winken zurück und verurteilen danach auf Geheiß ihrer Ideologen die Blockadebrecher.
Vor der Haustür von Santiago prüfen die 'Kubis' genauestens unsere Identität und ziehen ihr dickes Drahtnetz aus der felsigen engen Hafeneinfahrt, womit sie die Bucht von Santiago gegen eindringende U-Boote der benachbarten US-Marine von Guantanamo schützen.
So werden alle unter Dampf gehalten und haben ihre anti-klassenfeindliche Beschäftigung.
Kaum daß wir unser Schiff angebändselt haben, stürzen sich in Santiago auch schon die LKW's auf die Schmalzfässer. Im ganzen vier, weil wir vier Luken haben. Diese werden geöffnet, somit ist in der Sommersglut die Kühlung dahin. Pro Luke wird ein LKW beladen und dann tritt idyllische Ruhe ein.
Sechs Tage lang.
In Kuba ist Karneval. Vier LKW-Ladungen reichen zum Schmalzstullen schmieren. Wir liegen im geruhsamen Tagesablauf in der Sonne und erfreuen uns der sozialistischen Seefahrt.
Der Wachmatrose auf dem Gangway-Podest schießt nachts mit dem Luftgewehr auf die Ratten an der Pier.
Bis er eine trifft.
Die quiekt, dann kommt keine mehr. Er muß ersatzweise auf Kakerlaken blatthalten. Bei diesem Niederwild gelingt das problemlos. Ein Alpha-Männchen erreicht hier an der warmen Zuckerpier ohne Fühler eine Länge von fünf Zentimetern.
An der Pier gegenüber liegen die Russen. Die sind von Haus aus Kumpel. Die Ärztin kommt zu uns herüber und lädt für den morgigen Tag zur "Ekskursazia" ein. Sie hätten von ihrem Konsulat einen Bus und darin noch Kapazität frei.
Ich fungiere an Bord als Gewerkschaftsboss und stehe jedem Kulturangebot aufgeschlossen gegenüber.
So produziere ich mich als Natschalnik, sage "Charosch " und "Spasiwo", wir kommen mit. 15 Mann.
Als erster Anlaufpunkt ist das Castillo von Santiago vorgesehen. Das droht als schützende Festung auf dem hohen Felsen bei der Hafeneinfahrt, hoch über dem U-Boot-Netz. Die "Heinzis" haben Glück, daß sie uns jetzt dabei haben, alleine wären sie da nicht hinaufgekommen. Der Berg überfordert das schwachbrüstige dampfende Autobus-Vehikel. Gemeinsam schieben wir aber den grünen Russenbus bei 40 Grad Hitze steil bergan bis in den Festungshof. "Technica grande fantastic" meint der kubanische Botschaftsfahrer.
Wir genießen den Rundblick und inspizieren die dort zurückgelassene Artillerie des Christopher Columbus.
Danach steuern wir nur noch Ziele im Flachland an. D.h. wir bleiben gleich bei dem ersten dauerhaft hängen, an einem Badestand innerhalb der Bucht.
Die Deutschen packen als Einzelkämpfer jeder verstohlen ihr 'breakfast' aus. Die Russen unterbinden diese Eigenbrötelei. Sie breiten auf dem vertrockneten Rasen ein Bettlaken aus, öffnen diverse Pappkartons, mit Brotrunksen, Eiern, Wurst und Käse. Zwei Kartons bleiben noch verschlossen. Sie bitten zu Tisch bzw. zu Laken. Keiner darf sich drücken.
Russische Gastfreundschaft, ich habe sie sehr oft erlebt, ohne Schicki-Micki, aber von Herzen.
Bei dem Picknick ist mir heiß geworden, ich möchte jetzt in's Wasser. "Stoi!", kommt das keinen Widerspruch zulassende Kommando der russischen Schiffsärztin: 15 Minuten warten! Am Laken wird ein noch verschlossener Karton geöffnet, meine Vorahnung bestätigt sich: 40%-iger herrlicher Kuba-Rum vom Besten. Leider im kochendheißen Bus magenfreundlich vorgewärmt. Dazu große Halb-Liter-Gläser, immer eins pro drei Mann. Es bleibt Zeit, sich zu verdrücken, obwohl ich einem gepflegten 'Cuba-Libre' sehr zugetan bin, nur diesem steifen Grog möchte ich bei der Hitze entrinnen. Ich verdrücke mich in die äußerste Ecke des Terrains und spiele dort Fußball mit dem einzigen Antialkoholiker der Sowjetunion. Dann werden wir ertappt und zugeführt. "Zweimal hundert Gramm pro Delinquenten, etwas Strafe muß sein!", lautete das standrechtliche Urteil. Temperatur und Alkoholgehalt des Erfrischungsgetränks liegen bei 40 Grad, ärztliche Aufsicht ist gegeben. Danach darf ich auch baden gehen.
Bei unseren alkoholischen Ausdünstungen drehen die Haie und Baracudas schon 100 Meter vor dem Strand angewidert ab.
![]() Zu Gast bei "Habana-Club"
Zu Gast bei "Habana-Club"
Bootsmann Schweinchen verkündet zum Abendessen in der Messe das nächste Kulturereignis. Schweinchen kann normalerweise kein Wort ausländisch, aber er hat alles klar gemacht mit dem kubanischen Vormann an der Pier. Morgen kommt ein Laster und wir besuchen die "Barcadi-Brennerei" in Santiago de Cuba. (Heute, nach einem verlorenen patentrechtlichen Prozeß, "Habana-Club".)
Zu unserem Erstaunen funktioniert das am nächsten Vormittag sogar. Es kommt ein großflächiger Pritschenwagen. Um dem kubanischen Sicherheitsstandard zu genügen, sind in die seitlichen Halterungen statt der verlorengegangenen Rungen ein paar krumme Knüppel gesteckt und als Reling darum ein Tampen geschlungen. Wir paarundzwanzig Leutchen finden auf der Ladefläche gut Platz. Am Hafentor wird zollbehördlich natürlich absteigen und einzeln filzen befohlen.
An Land gehen in Kuba unterliegt einem Ritual.
In dem Land läßt sich alles, aber auch alles für Cuba-Pesos verscheuern, am besten Pall-Mall -Zigaretten. Demzufolge hat jeder Landgänger eine umfangreiche Karteikarte am Mann zu führen, in dieser vermerken die Companeros am Hafentor sämtlichen Tascheninhalt von Hein Mück: Kamm, Feuerzeug, Zigaretten, Taschenmesser, Kondome, eben einfach alles. Beim Landgangsende wollen die Companeros das dann auch wieder vorgeführt bekommen, in dem sie den spanischen Namen sagen und Hein Mück das dazu passende Utensil vorzeigen soll. (Wie das bei Kondomen läuft, weiß ich nicht.)
Ein sehr effektiver praxisverbundener Sprachunterricht.
Nach einer Stunde ist die mitgeführte Habe aller paarundzwanzig Brennerei-Interessierten zollmäßig katalogisiert.
Also, wieder aufgesessen!
Wir werden in spanischer Sprache in die Geheimnisse der Zuckerrohrmelasse verarbeitenden Rumbrennerei eingeweiht. Ich unterbreche die technischen Ausführungen des Produktionsdirektors gelegentlich mit einem "si, si" oder "muy interessante", zu mehr hat es im spanischen damals noch nicht gereicht, woraus unsere Führungskraft aber dennoch auf Sprachverständnis und umfassende Sachkenntnis schließen konnte.
Nach dem gegenseitig beflügelnden Rundgang in der weltberühmten Brennerei drängen wir uns im Büro des Direktors. Auf seinem Schreibtisch steht eine große bronzene Fledermaus, das Firmenlogo dieser Rummarke.
Die Fledermaus ziert heute noch auf jeder Barcadi-Flasche das Etikett.
An der Rückwand des Büros ist eine schmale Tapetentür eingelassen. Durch diese betreten wir einen fensterlosen, herrlich gekühlten Raum. Muschebubu-Beleuchtung, Nachtbar-Ambiente. Endlich gibt's einen. D.h. nicht nur einen, mehrere, ohne Ende. Der werkseigene Barkeeper kreiert aus 12 Jahre alter Faßware hervorragende Köstlichkeiten. Zur Verfeinerung schabt er mit einem Hobel Eissplitter von einem halben Kubikmeter Blockeis. In letzter Sekunde malt der Storekeeper noch unseren Dampfer in das Gästebuch und der Alte schreibt lobende Worte darüber. Ein Gläschen weiter wäre das mißglückt. Denn mittlerweile ist bärisch Stimmung im Laden und die See geht hoch. Auf Grund dieser Anzeichen werden wir wieder ins Freie gebeten, mitten in den noch grellen Sonnenschein und die damit produzierte Hitze. Diese schlägt uns wie ein Hammer auf das besäuselte Gemüt. Die labile Knüppel-Reling des Pritschenwagens erweist sich jetzt als sehr unstabil und die Fledermaus auf dem Schreibtisch des Direktors als flüchtig. Hinter den eng zusammengekniffenen Beinen von drei Tierschützern an der Rückwand der Fahrerkabine wird das 30 kg schwere Tier aufgebracht.
Bei der Fahndung nach seinem Wappentier fallen dem Companero Direktor elf Rumfreunde als nicht transportfähig ins Auge und teils entgegen. D.h. sie wären durchaus transportabel, nur nicht auf dem Pritschenwagen ohne solider seitlicher Festhalte.
Es fährt ein Gebrauchtlimousine von Chevi vor. Alle elf Aussortierten werden darin verstaut. Drei neben dem Fahrer, fünf sitzend auf der Rückbank. Drei müssen sich auf deren Knie stellen und dürfen laut lallend während der Fahrt aus dem Schiebedach winken.
Solcherart eskortiert erreichen wir ohne Zwischenfälle den Hafen. Am Zoll geht ein riesiges Gaudi los wegen der Rückerfassung der mitgeführten Habseligkeiten.
Jeder schwärmt den Zöllnern in deutsch die herrlichen Erlebnisse in der Brennerei vor, weiß aber nicht, was auf spanisch Kamm oder Feuerzeug heißt und wo das Ding abgeblieben ist, sowieso nicht. Das Verständnis für solch schwerwiegende Zollvergehen ist aber auch bei dem hinzugezogenen Oberzöllner sehr begrenzt. Das Ritual zieht sich in die Länge.
Inzwischen sind alle wieder nüchtern. Die Situation klariert sich schließlich.
![]() Estamos en caña (canja) - Wir sind im Zuckerrohr
Estamos en caña (canja) - Wir sind im Zuckerrohr
In Santiago ist Karneval. Jetzt im Sommer - und wie. Und eben nicht zum weltweiten Rosenmontag, als unser Zimmermann mit seiner Treckfiedel auf der Pinos - Insel einen solchen vom Zaune brechen wollte und deshalb verhaftet wurde.
Diese jahreszeitliche Abweichung hat ihren besonderen Grund.
Wenn alle Carnevalistas der Welt ihre Pappnasen aufsetzen und die Arbeit ruhen lassen, ist auf der weltgrößten Zuckerinsel Kuba das Zuckerrohr herangereift. Karneval feiern ist nun allemal angenehmer, als Zuckerrohr schlagen.
Ich habe mir sowohl die Zuckerrohrernte, als auch den Karneval angetan. Letzteres ist bei weitem angenehmer. Aber gewöhnungsbedürftig ist beides.
Der gestrenge Fidel Castro hat sich das Theater zwei Jahre lang nach seiner opferreichen Vertreibung Batistas angeschaut.
Im letzten Jahr vor der Revolution erntete Kuba sieben Millionen Tonnen Rohrzucker. Zwei Jahre nach der Revolution beträgt die Ausbeute gerade noch drei Millionen Tonnen. Inmitten dieser miesen Ernte nun, wackelt auch noch das ganze Land tagelang mit den knackigen Popos und huldigt ausgiebig dem Karneval.
Zwei, drei Jahre hat Fidel sein Volk austoben lassen, in der Illusion, die Befreiung vom Kapitalismus, ist auch die Befreiung von der Arbeit. Die eroberten Warenlager waren ja noch gut gefüllt. Die Kombination der Annehmlichkeiten des Sozialismus, gepaart mit dem einkassierten Warenangebot des amerikanischen Marktes, wurde allerorts jubelnd begrüßt. Die sozialistischen Länder umarmten Fidel und karrten ihrerseits alles nach Kuba, was sie irgendwie aufopfernd entbehren konnten.
Jetzt ist Schluß, kommandiert 1962 Fidel Castro. Die hübschen Mädchen, die die amerikanischen Geschäftsleute nach 20 Flugminuten von Florida so zu schätzen wußten, brechen sich nun die gepflegten Fingernägel bei der Tomaten- und Paprikaernte ab.
Fidel zieht alle Register. Jeder, der einigermaßen entbehrlich ist und eine Machete halten kann, ob Verkäufer, Banker, Beamter wird abkommandiert. "Estamos en cana" steht so als Aufkleber vor so mancher Büro- und Ladentür.
Kein Schwanz aber will freiwillig in die "cana".
Wir sitzen in Nuevitas bei Cuba-Libre mit Eis und Limetten auf der Terrasse eines bescheidenen Lokals, da bricht um uns die Hölle los. Alles rennet, rettet, flüchtet.
Wie Attilas Hunnen einst in Europa, sind hier uniformierte Häscher über die Kleinstadt hergefallen und die sind nicht zimperlich.
Der Ort ist abgeriegelt, jede männliche Person wird dokumentenmäßig überprüft. Wir friedliche Rum-Trinker auch.
Ohne Betriebsausweis ist jeder Kubi jetzt übel dran.
Wer keine Arbeitsstelle nachweisen kann, geht per nachhelfenden Tritt in das Gesäß erst auf den LKW und dann ab in die "cana".
Ich habe mir mit ein paar gleichfalls Wißbegierigen einen Tag kubanische Zuckerrohrernte studienhalber auch gegönnt.
Nur interessenhalber und als sozialistische Hilfe verbrämt.
Die kubanischen Companeros stehen unserer 6-Mann-Bitte, uns einen Einblick in ihre "cana" zu ermöglichen, sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich bin doch Gewerkschaftshäuptling an Bord und muß kulturelle Höhepunkte schaffen, zum Ausgleich für die erlebnislosen Seetage. Ein Artikel im Brigadetagebuch dokumentiert danach die gute Tat, für die gemeinsame sozialistische Sache.
Heute mag man darüber lächeln, aufschlußreich und interessant war es trotzdem.
Schon von See aus fällt uns im Frühjahr das rauchende Kuba auf. Es brennen die Zuckerrohrfelder. Die Wälder wurden schon vor dreihundert Jahren abgebrannt.
Wahrscheinlich kennt nicht jeder meiner Leser eine Zuckerrohrpflanze. Sie ähnelt einer Maisstaude. Zur Zuckergewinnung ist aber nur der kahle Strunks von Interesse. Um das uninteressante Beiwerk von dem harten Zuckerrohr elegant loszuwerden, werden bei günstigem Wind die riesigen Felder angebrannt. Dann faucht prasselnd die Feuersbrunst durch die Plantage. Das Feuer frißt das verdorrte Blattwerk und es ragen nur noch die kahlen grünen Stangen in den Himmel.
Das Feld ist brandmäßig aufbereitet.
Also, auf geht's.
Die Macheten sind geschärft. Von oben hämmert der Stern und von unten staubt die Asche des vorher abgefackelten Blattwerkes. Das Rohr ist zäh wie Bambus. Na gut, die besten Macheten hat man uns nicht verpaßt. Wir dreschen drauf wie die Kaputten, die Companeros links und rechts von uns sind trotzdem schon weit voraus.
Von der Stirne heiß, rinnen muß der Schweiß.
Eisgekühltes Wasser ist reichlich im Angebot, keiner muß medizinisch an den Tropf.
Ein ergrauter Amigo ist ständig damit beauftragt, mit dieser Wasserkanne seine Runde zu drehen. Diese Erfindung ist genial, alle saufen aus dem gleichen Topf, dennoch wird die Higgenie gewahrt. Wenn man damit umgehen kann!
Wir können nicht.
Die Fünf-Liter Blechkanne hat die Form eines großen Blumengießers mit dem schwanenhalsigen Gießer. Die Experten halten sie hoch über ihr Haupt, sperren den Schnabel auf, neigen die Kanne und leiten den auf sie zuschießenden Strahl kurioserweise direkt in den aufgesperrten Mund.
Kein Tropfen geht daneben.
Ich tue es dem Amigo nach, dusche erst unfreiwillig mit dem eisgekühlten Wasser und als letztendlich der Strahl in meinen aufgesperrten Rachen plätschert, reizt er mein Zäpfchen dermaßen, daß ich alles wieder zur Bewässerung der Zuckerrohrstauden heraussprudele.
Das auf meinem Gesicht herabrinnende Duschwasser legt Streifen meiner natürlichen Hautfarbe frei, der Rest ist von der aufgewirbelten Asche bedeckt, die auf der schwitzigen Haut festbackt.
Wir machen geringfügig früher Feierabend als die Companeros, die tagtäglich diesen Scheißjob verrichten. Wahrscheinlich beträgt unsere Normerfüllung so um die zehn Prozent. Vom Erlös könnten wir uns jetzt eine Cola pur leisten, für den Schuß Rum würde unser Tageslohn wohl nicht reichen.
Jetzt weiß ich, warum in Nuevitas jeder männliche Einwohner um sein Leben gerannt ist, als die Häscher für die Zuckerrohrernte die Kleinstadt überfielen.
Kurz eingeflochten
Natürlich ließe sich auch Zuckerrohr, wie alles auf dieser Welt, maschinell überlisten. 1964 allerdings ist das noch nicht der Fall. Weltweit ist keine Technik im Angebot, um dem Plantagenarbeiter diese Arbeit, ....ja nun "abzunehmen" bzw. wegzunehmen. D. h. auf dieses Umfeld bezogen, ihn arbeitslos zu machen! Überall dort, wo Zuckerrohr gedeiht, ist bisher die Arbeitskraft aus Arbeitgebersicht so kostengünstig, daß sich die Lohnkosten-sparende Anschaffung solcher Technik nicht "rechnet". Somit hat sich wegen des fehlenden Marktes niemand mit der Entwicklung und Konstruktion solcher Erntemaschinen beschäftigt.
Nach der kubanischen Revolution wächst nun plötzlich Zuckerrohr im sozialistischen Lager.
Jetzt fangen die Russen an, für die kubanischen Genossen Zuckerrohr-Vollernte-Kombines zu konzipieren. Meine letzte Information auf dieser Strecke ist, daß diese Mechnik auf ebenen Feldern so leidlich funktioniert, sobald es aber hügelig wird, ist es vorteilhaft, am Feldrand eine Kompanie Machetenträger in Bereitschaft "stand by" zu halten.
Womit ernähren die 50 Camposinos, die jetzt noch ihre Bereitschaftsstunden bezahlt bekommen, ihre Familien, wenn diese scheiß "macina infernale" fehlerfrei loslegt und ihre Macheten verrosten? Seitenlang könnte man jetzt über das Für- und Wider dieses technologischen Fortschritts philosophieren.
![]() Maritime Erlebnisgastronomie
Maritime Erlebnisgastronomie
The carnival is over, wir haben nichts dagegen, die Kubis haben ihre Schmalzfässer abgeholt, wir versegeln nach Havanna und beladen das Schiff mit den bekannten Kuba-Apfelsinen. Havanna ist natürlich auch eine Reise wert, das kostengünstige Angebot ausnutzend, habe ich mir das Erlebnis der kubanischen Hauptstadt mehrfach gegönnt. Aber jetzt geht's erst wieder einmal mit voll Schiff heim zur Mutti.
Die bizarren Felsen der "I. d'Ouessant" an der französischen Küste wären schon in optischer Sichtweite, wenn sich das europäische Wetter zur Begrüßung etwas Besseres hätte einfallen lassen. Unser Dampfer rollt im noch erträglichen Maß von ca. 22 Grad nach jeder Seite. Mit erträglich meine ich, daß man noch auf einem Stuhl sitzend, normal von einem Tisch in der Messe sein Abendessen gepflegt einnehmen kann. Die Stewardeß hat die Tischdecken naß begossen und an der Back die "Schlingerleisten" aufgeklappt. Der Tisch ist normal gedeckt und auf Grund dieser vorsorglichen Maßnahmen bleibt auch alles Aufgedeckte an seinem Platz.
Unerklärlicherweise bricht fünf Minuten vor 17.30 Uhr auf dem Schiff das Chaos aus. Der Dampfer haut sich plötzlich auf 40 Grad Schlagseite, einmal nach Steuerbord, dann mit dem gleichen Ausschlag nach Backbord, dann sind die gedeckten Tische in beiden Messen abgeräumt.
43 Mal komplett rauscht nun in einem Schlag von den Backs.
Die Maschine stoppt. Das Schiff dallert in der jetzt quer einfallenden See, wie ein Sektkorken.
MS JOHN BRICKMAN hat einen Ruderversager.
Auf der Brücke steht dem Wachoffizier als übertriebener Luxus ein dreibeiniger Hocker zur Verfügung. Wenn er diesen an dem Klapptisch vor dem Brückenfenster etabliert, kann er seinen Kaffee dort im Sitzen genießen und hat dennoch den menschenleeren Atlantik voll im Auge. Auf dieser Wache allerdings kann er sich diesen Luxus nicht gönnen, der Hocker ist an der Stirnseite der Brücke weggestaut und gelascht, damit er bei den Schiffsbewegungen nicht dauernd durch die Brücke purzelt.
Auf einmal purzelt das Sitzmöbel aber dennoch. Haltbare Knoten machen, ist halt auch in Seemannskreisen nicht jedermanns Sache. Der Hocker, mit seinen eisernen drei Beinen, poltert nun in der Brücke einmal hin und einmal zurück, dann fällt das Schiff jäh von seiner Kurslinie ab.
JOHN BRICKMAN hat ein schönes großes hölzernes Ruderrad an einem massigen Ruderbock. An diesem fallen zwei zylindrige langgestreckte Töpfe auf. In Fachkreisen kann man die auch als hydraulische Druckzylinder bezeichnen. Aus diesen Töpfen führen zwei dünne Kupferröhrchen den Ruderbock hinab und verschwinden in einem kleinen eleganten Bogen im Estrichfußboden der Schiffsbrücke.
Die Röhrchen münden achtern am Ruderquadranten. Das ist die kräftige Maschine, die den schwächlichen Kommandos des Rudergängers gehorchend, das riesige Ruderblatt des Schiffes gegen Wind und Wellenschlag umherwedeln läßt.
Nachdem der Hocker aber an dem Ruderbock auf der Brücke vorbeipolterte, ist kein technisch verwertbarer Druck mehr vorhanden, wohl aber eine Pfütze auf der Brücke. Der Hocker durchtrennt in unvorstellbarer Maßarbeit beim Passieren des Ruderbocks den kleinen Krümmer der Kupferleitung. Das Hydrauliköl läuft aus, das Schiff ist auf der Stelle manövrierunfähig.
Das wäre, abgesehen von der unangenehmen Querlage in den Wellenbergen der Biscaya, nicht so dramatisch, aber die felsige französische Küste ist im Radar ganz prima auszumachen und nicht so weit entfernt.
Das Abendessen läuft uns nicht weg, nur in den beiden Messen auf dem Fußboden von einer Längswand zur anderen. Alle entbehrlichen Hände klammern sich nun achtern im Rudermaschinenraum verbissen am Notruder fest. Auch ich tue dort mein Möglichstes. Dieses Notruder-Monstrum haben wir schon jahrelang belächelt aber nie einmal, wenigsten probehalber, benutzt.
Das Ding ist groß wie ein Mühlenrad. Das heißt, wie zwei Mühlenräder hintereinander auf einer Achse. So können davor, dahinter und zweimal mittendrin 10, 12 Männer irgendwo hin drehen. Aber, immer wenn das großflächige Ruderblatt des Schiffes von einer kräftigen Welle eins verplettet bekommt, hebt es auf der dazugehörigen Seite des Ruderrades ein paar Männer in die Höhe. Weil das große Ruderrad mit Ketten direkt mit dem Ruderblatt des Schiffes verbunden ist, reagiert es dementsprechend auf jeden Seeschlag ganz kraftvoll. Die Sprechverbindung zur Brücke funktioniert aus dem tiefen eisernen Inneren nicht, nun muß auch noch eine Rufverbindung aufgebaut werden, damit wir unten im Schacht wissen, wohin wir so kräfteraubend überhaupt kurbeln sollen.
Wir halten dort unten das Schiff fern von den drohenden Klippen.
Auf der Brücke geben die Techniker ihr Letztes. Der Dampfer schmeißt sich teilweise immer noch auf 40 Grad nach jeder Seite, weil das Schiff streckenweise uns Notrudergänger beherrscht und nicht umgedreht. Auf der Brücke haben sich drei Mann am Ruderbock verzurrt und halten nun ihrerseits Fiete, den Storekeeper in Position, damit der in aller Ruhe die Leckage am Kupferröhrchen hart löten kann. Um seine Gasflaschen muß man sich natürlich auch sorgen, sonst erschlagen die im Vorbeischauen die ganze Reparaturbrigade.
Fiete hat was auf der Pfanne, das System ist dicht. Es wird neu aufgefüllt und der Dampfer nun wieder exakt gegen die See und von den Klippen weggedreht.
Wir begeben uns zu Tisch.
Das Wirtschaftspersonal hat das Handtuch geschmissen. Eine zweite Komplettgarnitur Geschirr wäre ja in den Lasten noch vorrätig, aber verpackt in Holzwolle.
Wir hocken uns auf den Fußboden der Messen und schauen nach, was uns Rasmus so bescheret hat. Jeder findet eigentlich sein's. Was gerade am jeweiligen Standort nicht vorhanden ist, kommt ganz bestimmt vorüber. Das Schiff geht ja immer noch wie ein Lämmerschwanz in der See. Gurken, Tomaten, Salz- und Pfefferstreuer, Gewürzsoßen, alles ohne kantige Konturen schaut bei jedem gelegentlich einmal vorbei. Nur die Butter backt dort fest, wo sie gelandet ist. Zu ihr muß man hinrobben.
Auch die sechs Liter über Stag gegangener Kräutertee samt der zerschmetterten Kannen, beeinträchtigen flächenweise dieses besondere 'sit-in'. Maritime Erlebnisgastronomie! Mann gönnt sich ja sonst nichts!
Zweites Buch - Eine ganz andere Sorte Seefahrt -
![]() Total "verschanghait"
Total "verschanghait"
MS JOHN BRINCKMAN liegt in der Warnow-Werft Warnemünde. Es ist Sommer. Mit den angesammelten ‚freien Tagen' könnte ich locker ein halbes Jahr Urlaub machen.
Meine Vorgesetzten sehen das auch so. Ich bekomme Urlaub, Hurra!
Im ganzen zwei Tage!
Am 11.6.1968 mustere ich ab, am 13.6. ist mein begonnener Urlaub wieder beendet. "Fahr mal schnell mit MS THALE nach Rotterdam den Tanker WOLFEN holen. Danach kannst du immer noch Urlaub machen", beschließt mein Funkinspektor.
Das "danach" dauerte 10 Monate und 23 Tage!
Die Reederei hat von Norwegen den 42-Tausend- Tonnen-Tanker MT TARIM gekauft. In der Rotterdamer Werft wird das Schiff MT WOLFEN getauft und nach Reederei-Bedürfnissen umkonzipiert. Die dafür erforderlichen wertvollen Valuta sind knapp, offensichtliche Mängel werden beseitigt, die verdeckten bleiben uns erhalten. Die Werftzeit zieht sich hin, nach Beendigung der Reparaturzeit schickt die Reederei die Segelorder: von Rotterdam ablaufen "for order".
"Ja jetzt bist du dort drauf" meint lakonisch mein Funkinspektor, als ich ihn am Telefon darauf hinweise, daß ich das Schiff nur nach Rostock holen sollte. "Verschanghait" nannte man früher eine solche Anmusterung gegen den Willen des Betroffenen. Sechseinhalb Jahre habe ich mich auf MS JOHN BRINCKMAN der Fruchtschiffahrt gewidmet. Jetzt wurde ich von meinem schönen weißen Schwan auf so ein großes Ölfaß verschaukelt. "Ich duftete bisher nur nach ‚tropical fruits', ihr muffelt hier alle nur nach ‚crude oil'" befrotzelte ich missmutig meine zukünftigen Kollegen. Allesamt gestandene Tankerleute.
Tanker kann ich nicht leiden. "Na gut, jetzt fahre ich immerhin auf dem größten Schiff der Reederei" tröste ich mich selbst und bin längst urlaubsreif. Meine Frau und vier Kinder natürlich gleichsam.
Den Tanker packt jeder Hafenkapitän in die letzte Ecke seiner Kaianlagen. Ölhäfen liegen ohnehin schon in trister unbewohnter Taiga. Damit, wenn so ein Pulverfaß in die Luft fliegt, es das schön für sich alleine erledigt, ohne Personen oder anderer Leute Sachwerte zu beschädigen.
Ich mag keine Tanker und.... fahre auf den nächsten Seiten dieses Buches zehn Jahre lang auf diesen Gefahrguttransportern und das mit zunehmendem Lustgewinn. Schließlich liebe ich meinen Beruf und fahre (wenn auch manchmal mordsmäßig fluchend) gerne zur See.
![]() Eine anschauliche Belehrung
Eine anschauliche Belehrung
Unser neu übernommenes Schiff wurde in Rotterdam entgast und liegt nun in der Werft für die nötigsten Reparaturen und zur Klassenerneuerung. Auch jedes Schiff muß regelmäßig zum TÜV.
Des nachtens rummst es ganz heftig.
Morgens beim Frühstück kennt noch niemand den Grund, aber erwacht sind in der Nacht alle.
Während des Frühstückens erreicht uns die Kunde.
Der griechische Tanker, der sich nach uns der Tankreinigung unterzog, ist im Verlauf dieser Arbeiten explodiert.
Die Tankreinigungsfirma betreibt ihr Gewerbe außerhalb der Werft. Wir können vom Peildeck unseres Schiffes allerdings dort hinüber schauen.
Wir pilgern zu dem Anschauungsobjekt, das jedem von uns anschaulich verdeutlicht, wie lebensbedrohend Fehlverhalten bei dieser Art von Gefahrguttransporten bestraft wird.
Die Firma verfügt am Flußufer über eine Pier zum Festmachen ihrer zu reinigenden Objekte und einer Anlage zum Aufbereiten der Waschlauge. Des weiteren ist selbstverständlich die Abnahme der Wasch- und Ladungsrückstände gewährleistet.
Der Tanker bietet von der Pier aus einen Einblick in seine perforierten Eingeweide.
An seiner Steuerbordseite klafft ein bizarr zerfranstes Explosionsloch, durch das zwei Autobusse parallel gut einfahren könnten.
Die verstärkenden Spanten in der Form von sehr kräftigen Doppel-T-Profilen ragen verschnörkelt und mehrfach verdreht aus den zerfransten 25-Millimeter-Blechen der aufgebördelten Außenhaut.
Der Druck der Explosion entwich hier seitlich über die Bordwand. Durch den Wassereinbruch liegt der Tanker wieder tief abgeladen im Wasser.
Vor die Wahl gestellt, Reinigung eines Tankerladeraums oder eines Fäkalientanks, zöge ich den Fäkalientank vor, selbst unter der Erhaltung der Betriebsbereitschaft desselben. Ich gönne mir später auch das Vergnügen, achtzig Zentimeter abgelagerte gasende Sedimente aus einem 40-Tausend-Tonnnen-Tanker herauszuschaffen, um ihn gasfrei für die Werft zu machen. Natürlich um wertvolle Valuta einzusparen.
Diesen Job will demzufolge in Rotterdam kaum einer als Dauerbeschäftigung machen. Somit bildet die Stammbesatzung dieser Tank-Cleaning-Firma nur ein Mann!
Der allerdings ist firm und versteht dieses Gewerbe.
Zieht nun seine Firma einen Auftrag an Land, sucht sich dieser Vormann eine Gang zusammen, die gewillt ist, für eine recht ordentliche Entlohnung, diesen Scheißjob, zeitlich begrenzt, zu machen. Er tut sich auf dem Rotterdamer Bahnhof und in jobbenden Studentenkreisen um. So eine rekrutierte Schleudertruppe rückt dann schlecht ausgerüstet und ziemlich blauäugig den explosiven Ladungsrückständen in den Tankschiffen zu Leibe.
Wahrscheinlich hat im gasenden Laderaum des griechischen Tankers einem solchen Hilfsfreiwilligen nach der letzten Zigarette seines Lebens gelüstet.
Drei Tote werden in dem gefluteten Schrottchaos vor Ort gefunden. Der havarierte Tanker wird in die Werft geschleppt und aufgedockt, das Wasser läuft aus dem Leck und drei weitere Leichen fallen trocken.
Auch die alten Tankerhasen sind beeindruckt. Solche Urgewalten hatten sich in der DDR-Tankerfahrt noch nicht entfaltet.
Vom Tanker LEUNA II flog 1958 allerdings der schwere Lukendeckel des Trockenladeraumes durch die Luft. Hier bezahlten nach einer Explosion drei Raucher ihr Fehlverhalten mit dem Leben.
![]() "Smoke-time" in Gibraltar
"Smoke-time" in Gibraltar
Ich hasse Tanker.
Jetzt ziehe ich in diese Waffengattung mit dem Flagschiff der Reederei los.
Gehorchenderweise, Befehl ist Befehl!
Kapitän Gustävel ist ein Souverän. Ohnehin hat die Reederei das Schiff nicht mit Flinzpiepen besetzt. Mich einmal ausgenommen, ich sollte ja das Schiff nur nach Rostock überführen, meinen Urlaub antreten und dann mit meiner heißgeliebten BRINCKMAN weiterhin Früchte heranschaffen.
Ich beschnuppere das Schiff, meine Funk-Technik ist recht ordentlich.
Auf dem Schiff läßt es sich leben, die Kumpels sind rundherum in Ordnung, obwohl sie alle nach crude-oil muffeln und nicht, wie ich, nach tropical-fruits duften.
MT WOLFEN verläßt Rotterdam for order.
D.h. auslaufen gen Süden, genaueres folgt später. Der Kapitän schlägt sich im Mittelmeer in die Büsche.
Ich löchere Rügen Radio täglich nach einer evt. vorliegenden Reiseorder. Nothing!
Irgend etwas machen muß man ja schließlich auf dem neu erworbenen Schiff. Also macht der Kapitän das Naheliegendste, was alle Kapitäne gegen den Gammel tun: Bootsmanöver! Danach evt. noch die vier anderen Manöverspiele. Aber das erste Spielchen füllt die nächsten acht Tage voll aus!
Beim Aufhieven des Rettungsbootes bricht ein Renner. Das Boot treibt ab, Hagen Uloth und ich hechten hinterher.
Das laufende Gut muß von England nach Gibraltar eingeflogen werden.
Nach sieben Tagen verlassen wir die große Klamotte Gibraltar. Jetzt kenne ich mich auf diesem Felsen prima aus und jeden der 48 Affen auf dem Felsen mit Vornamen.
![]() Es wird schwitzig
Es wird schwitzig
Ras at Tanura heißt unsere Segelorder.
Ich, als Fruchtfröhlich kenne mich in den Wüstenscheichtümern sowieso nicht aus, aber die Tanker-Nautiker schauen nun auch erst einmal nach. Später dann natürlich nie wieder. Ras at Tanura in Saudi Arabien ist neben Mena al Ahmadi in Kuwait schließlich der Kohinoor der Tankerhäfen. Sozusagen die Saudi Arabische Geldpresse für den Erlös der täglich aus der Erde sprudelnden Erdölmilliarden.
MT WOLFEN fährt durch die Straße von Gibraltar zurück in den Atlantik.
Die Delphin-Herde agiert hier immer noch in alter Frische.
Der Suez-Kanal ist im vorigen Jahr dicht gemacht worden. Um in den Persischen Golf zu gelangen, fährt man daher am günstigsten um das Kap der Guten Hoffnung.
Auf der Höhe von Conakry biegt der Tanker auf die F 142 ein. Ab diesem Seegebiet hat der Kapitän den Kurs mit 142 Grad quer durch den Golf von Guinea nach Kapstadt in die Seekarte eingetragen. Zehn Tage lang liegt nun der gleiche Kurs am Kompaß an.
Der Nord-Ost-Passat ist eingeschlafen. Auf dem Schiff wird es warm. Die Ingenieure basteln schon seit Tagen an der Klimaanlage, aber es bleibt warm in den Unterkünften. Auch der Seewasserverdampfer weigert sich bisher, aus salzigem Seewasser Frischwasser zu produzieren. Die Norweger behaupteten in Rotterdam, es wäre alles bestens in Ordnung.
Nun erwischt mich nach über acht Jahren Seefahrt der Genosse Neptun bei seiner peniblen Paßkontrolle bei der Überquerung des Äquators an der westafrikanischen Küste.
Auf MS DRESDEN habe ich auf zwei Grad Nord den Äquator im Zeiss-Glas schon ganz deutlich gesehen. Auf MS JOHN BRINCKMAN habe ich ihn auf vier Grad nördlicher Breite in Abidjan schon gerochen.
All das bringt keine mildernden Umstände. Also bringe ich das längst überfällige Zeremoniell jetzt auf Tanker WOLFEN würdevoll hinter mich.
Zuckerlecken ist das nicht und auch nicht billig, falls der Überlebenswille den Geiz besiegt.
Ab jetzt fahre ich ja noch fast zehn Jahre lang Tanker und auf jeder Reise zum Persischen Golf zweimal über den atlantisch-ozeanischen und zweimal über den indisch-ozeanischen Äquator. Bei jeder Überquerung dieser roten Linie danke ich sämtlichen zuständigen Göttern, daß ich dieses hoheitlich beherrschte Territorium urkundlich verbrieft, nicht ungetauft betreten muß.
 Vor dem Hafen von Kapstadt übernehmen wir im Schatten des Tafelbergs Post und Frischproviant.
Vor dem Hafen von Kapstadt übernehmen wir im Schatten des Tafelbergs Post und Frischproviant.
Ich suche unter der imposanten architektonischen Kulisse die "Grote Schuur Klinik". Dort hat doch Doktor Bernard vor kurzem die erste Herzverpflanzung der Welt erfolgreich abgewickelt. Vielleicht kann man durch die Fenster noch einen Blick erhaschen.
Das angelieferte Obst und Gemüse vom Kap nötigt uns jedes Mal Bewunderung ab, wer vom VEB Schiffsversorgung Rostock nur mit dreckigen Möhren, winzigen Zwiebeln und reichlich Kohlköpfen versorgt wird, wundert sich schon über die riesenhaften Weintrauben und Nektarinen der südafrikanischen Farmer.
In der herrlichen Bucht von Kapstadt steht ein unheimlicher Schwell. Der große Tanker liegt darin zwar ziemlich stabil wie ein Bügeleisen, aber das Versorgungsboot tänzelt längsseits atemberaubend an der Bordwand auf und ab.
Bei den ca. vierzig Kapumrundungen, die mir in den nächsten zehn Jahren noch blühen, ist jedes Mal der vorherige Wetterbericht von besonderem Interesse. Die Besatzungen der Kapstädter Versorgungsboote sind zwar die absoluten Hassadeure, aber auf mehreren Reisen bleibt dennoch der frische Proviant und die Post weg.
Das schlägt dann immer heftig auf die Gemüter.
Nach der Kapumrundung des winterlichen Cape Agulhas geht Rasmus nun so richtig zur Sache.
In Rotterdam war zwar Sommer, aber hier in Cape Town ist nun Winter!
Unwahrscheinliche Wellenberge laufen aus der Antarktis kommend, hier gegen die felsige Küste. Auch die Rundfunksender verbreiten Sturmwarnungen. Das will für die windgewöhnte
Gegend schon etwas heißen.
 An den Felswänden der südafrikanischen Steilküste zerschellen die dagegen laufenden Brecher. Der Wasserstaub steht hundert Meter hoch an den Felswänden.
An den Felswänden der südafrikanischen Steilküste zerschellen die dagegen laufenden Brecher. Der Wasserstaub steht hundert Meter hoch an den Felswänden.
Im Indischen Ozean ab Madagaskar wird es wieder zunehmend wärmer.
Im Arabischen Golf ist es dann schon ganz mollig.
Seitdem das Hauptdeck wieder begehbar ist, suchen die Maschinenleute auch hier die Rohrleitungen unter dem Laufsteg nach Leckagen ab. Die Klimaanlage ist noch nicht betriebsbereit. Das Freon, das die Kälte transportieren soll, verschwindet auf unergründlichen Wegen.
Mit "Fit"-Wasser bepinseln die Techniker nun die Rohre, Flansche und Armaturen, um auf Grund eventueller Bläschenbildung die flüchtenden Kältepermuckels zu ertappen.
Mittlerweile herrschen unter der arabischen Sommersonne unerträgliche Bedingungen auf dem Tanker. Im Persischen Golf beträgt die Seewassertemperatur 33 Grad. Im Badebecken an Deck läßt es sich auch bei frisch eingepumptem Wasser darin kaum existieren. Derart aufgeheiztes Salzwasser beißt sehr aggressiv in die Haut, während ein erfrischender Effekt nicht feststellbar ist.
Das Frischwasser wir knapp und daher rationiert. Aller vier Stunden zum Wachwechsel läuft es 15 Minuten aus dem Wasserhahn oder der Dusche.
MT WOLFEN ist ein Zwei-Insel-Schiff, d.h. im hinteren Aufbau wohnen die Mannschaft und die technischen Offiziere, darunter arbeiten die Maschine, die Kesselanlage, die Stromerzeugung und die vielen Pumpen. Auch die für das Frischwasser.
Im Brückenaufbau, in der Mitte des Schiffes, wohnen unterhalb der Brücke der Kapitän, der Politnik, die nautischen Offiziere und die Stewards. Ich wohne und arbeite direkt hinter der Brücke.
Wir alle in dem vorderen Aufbau bekommen nun alle vier Stunden von achtern das Frischwasser nach vorn gepumpt. D.h. wir bekommen die kochend heiße Brühe in die Wasserhähne gedrückt, die vier Stunden lang stehend in der Rohrleitung am Hauptdeck aufgeheizt wurde. Das Wasser ist so nicht zu gebrauchen, jedenfalls nicht für die Körperhygiene, man könnte damit ein geschlachtetes Schwein abbrühen. Somit muß es im Wassereimer "kaltgestellt" oder im Waschbecken auf 40 Grad "abgekühlt" werden, um sich dann damit zu "erfrischen" und das Salz aus dem Pelz zu spülen.
Kälter wird es tagsüber in keinem Winkel des Schiffes, nur gegen Morgen hat sich bei allen geöffneten Schotten und Bulleye´s die Raumtemperatur evt. auf 34 Grad verringert, bei einer Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent!
Im Funkraum steht eine unheimliche Bramming, da zwei Empfänger und gelegentlich der Sender zusätzlich noch mit heizen. Der Schweiß tropft in die Schreibmaschine. Die Telegrammformulare und die Tagebuchseiten kleben am Arm fest. Die ansonsten üblichen Ventilatoren sind nicht vorhanden, schließlich hat das Schiff ja Klimaanlage.
Unter solchen Bedingungen kann man rammdösig werden, weil man nachts schweißgebadet keine Ruhe findet.
Die Tropenreise vor acht Jahren auf MS DRESDEN war schon schön warm, aber der Persische Golf ist noch besser beheizt.
Ich sehe schon Vater- und Mammamorganen von Eisbergen, Gletschern und Schneelandschaften, da ruft mich Klaus Völker, der E-Ing. an, ich solle unter irgendeinem Vorwand zu ihm nach achtern kommen.
Ich öffne seine Kammertür und mir gefrieren die Schweißperlen auf der Stirn. 26 Grad Raumtemperatur und aus dem Klimaanlagenaustritt faucht es mir noch kälter entgegen. Das Flimmern vor meinen Augen schwindet.
Das Klimasystem des Schiffes ist in drei Sektionen geteilt.
Eine bedient den vorderen Aufbau, die zweite kühlt die Mannschaftsdecks und die dritte die beiden oberen Decks, wo die technischen Beamten der mittleren und gehobenen Laufbahn wohnen.
Nach unermüdlichen Bemühungen haben die Obertechniker mit den letzten noch verfügbaren Freonmolekülen ein instand gesetztes Kühlsystem in Gang bekommen.
Welchem System dann natürlich ihre besondere Aufmerksamkeit galt, brauche ich ja nicht näher erklären.
Ich schnappe mein Bettzeug und penne natürlich nach freundlicher Einladung beim E-Mix auf der Backskiste. Am nächsten Morgen fühle ich mich nach der durchschlafenen Nacht, der ersten nach einer Woche, wie frisch auf die arabische glühende Welt gekommen. Mein großer Onkel, der zwei Nachtstunden außerhalb der Bettdecke verbracht hat, zeigt leichte Erfrierungserscheinungen. Der Kälteeinbruch kam zu plötzlich.
Der Seewasserverdampfer kommt mangels Ersatzteile nicht in Gang. Auf der Rückreise bunkern wir in Mombasa Frischwasser, im Golf wäre das unbezahlbar gewesen.
In dem glühenden Persischen Golf steuern wir den Saudi Arabischen Hafen Ras at Tanura an. Die amerikanische Firma ARAMCO hat hier ihr Auskommen. Die arabischen Scheichs, in ihren blütenweißen Nachthemden hören nur dem Klimpern in ihren Sparschweinchen zu.
Wer diese Demonstration des Dollarmachen noch nicht hautnahe gesehen hat, macht sich keine Vorstellungen, wie hier die Milliarden aus dem Wüstensand in die riesigen Tankerladeräume sprudeln. Nach meinen Vorstellungen muß die Erde schon hohl sein, wie eine Christbaumkugel, wenn man sieht, was aus ihr ohne Unterlaß herausgesaugt wird.
Bei dem Geldverdienen wird so eine unwahrscheinliche Hektik an den Tag gelegt, als ob alle daran Verdienenden morgen zum Sozialamt müßten, wenn der eine oder andere Tanker sein Ballastwasser mit seinen ohnehin schon glühenden Pumpen noch eine halbe Stunde länger aus den Tanks pumpen muß. Ein zünftiger Landgang mit 'high life' und Kuh fliegen lassen, ist hier illusorisch. Es lohnt sich noch nicht einmal die Gangway hinabzugehen. Eine Gittertür trennt die Pier vom Hinterland. Das Hinterland ist Wüste mit Tanks, Pumpstationen und klimatisierten Wohncontainern. Betreten verboten!
An Deck herrschen 60 Grad Celsius.
Dann schon lieber....
![]() Eisfahrt im Schwarzen Meer
Eisfahrt im Schwarzen Meer
Die nächste Reise geht, glaube ich ins Schwarze Meer zu den Heinzis. Oder auch nach Sardinien, Syrien, Libyen oder Algerien. In zehn Jahren läppern sich auch im Mittelmeerraum etliche Ladehäfen zusammen.
Es herrschen winterliche Wetterbedingungen. Auch das Mittelmeer zeigt auf dieser Reise, was es im Angebot hat.
Es offeriert uns einen Wassereinbruch im Kabelgat. Die Einstiegsluke ist leckgeschlagen. Ein paar hundert Liter graue Farbe, vermischen sich mit dem eingedrungenen Seewasser und versauen die von Schiffsversorgung Rostock frisch eingekauften dicken Festmacherleinen.
Die Matrosen schaffen sich nach Wetterbesserung mit Verdünnung, Diesel, heißem Dampf und allen möglichen Methoden, die teuren Leinen nach der Reinigung dem Schiff zu erhalten, ohne daß die Festmacher daran kleben bleiben.
Am Eingang des Bosporus beeindruckt an Backbord-Seite die 'Hagia Sophia'. Das Wahrzeichen von Istanbul und wohl das Monumentalste, was zur Huldigung und zu Ehren Allahs errichtet wurde.
In der Weiterfahrt beeindruckt aber uns Tankerfahrer dann auch die Strafe Allahs, die den Kameraden auf den beiden ausgebrannten Tankerwracks widerfahren ist, als sie im engen Fahrwasser des Bosporus mit ihren Schiffen zusammengeballert sind. Nach Schilderung des Lotsen haben sechs Tage lang alle verfügbaren Feuerwehren gegen das brennende Öl auf dem Wasser und an den Ufern gekämpft.
Ich traue meinen Ohren nicht, der Wetterbericht von Odessa Radio verkündet eine schwere Eislage in der Bucht von Odessa.
Eis im Schwarzen Meer!
Auch der Kapitän zieht die Stirn kraus und der kennt die Tankerfahrt in dieser Gegend schon zehn Jahre lang. Jetzt überholen wir die ersten vereinzelten Treibeisfelder, dann wird es dicker und dann ist es zu. Vor dem Hafen von Odessa liegen übereinander gestapelte zusammengebackte Eisschollen und darin mehrere Schiffe, die vorher wohl versuchten, in Odessa einzulaufen oder den Hafen wieder zu verlassen.
Wir melden dem Tower per UKW unser Erscheinen, so wie das jedes Flugzeug oder Schiff in jedem normalen Hafen der Welt eben tut. Der zweite Offizier und ich wechseln uns am Brückengerät ab, in englischer Sprache, so wie sich das eben auch in jedem normalen Hafen der Welt gehört. Auf Kanal 16 bleibt eisiges Schweigen.
Jetzt ich, auf russisch, das schon zehn Jahren in mir verschüttet ist: " adjessa, dispatcher port, u menja wapros!" und schwupp schon ist er da. Auf russisch natürlich!
Wir können kommen, der Hafen ist leer. Was sonst, bei dem Eis.
Kapitän Gustävel nimmt Anlauf mit seinem Dickschiff und bricht hinein in die Eisbarriere. Vor uns im Eis liegt ein kleiner Grieche namens "Diamanto". Mit seiner schwachmotorigen Ausrüstung erwartet er das Tauwetter des Frühsommers. Wir tuten ihn an, der schnallt auch sofort und macht sein Waffeleisen juckig. Rauch steigt aus seiner Esse. Unsere gewaltige Masse prasselt ganz prächtig durch das zusammengeschobene Eis. Der Rudergänger schwenkt noch elegant das Heck des Tankers vor dem Steven von "Diamanto", der kleine Dampfer quirlt auch mit allem was er hat, aber nach einer halben Kabellänge kommt er in unserem Fahrwasser im Eis doch wieder fest und schlägt sein Winterquartier wieder auf.
Das war einfacher als es aussah. Kapitän Gustävels Risikobereitschaft wurde belohnt. Er bringt das Schiff wohlbehalten an die Pier.
Nach dem Festmachen kommt auch der Lotse an Bord und läßt sich seine "Beratung" quittieren.
In der Nacht befällt das Schiff Blitzeis. Es verwandelt die Aufbauten in ein Märchenschloß. Der sofort gefrierende anhaltende Nieselregen macht aus meinen zehn Millimeter starken Antennendrähten armstarke Trossen. Die Leitern zu den Masten hinauf sind mit Zuckerguß überzogen und nicht begehbar. Die Antennenbeiholer laufen nicht in den Blöcken. Es brechen unter der Last nach und nach alle Kupferdrähte und machen den Aufenthalt an Deck ziemlich gefährlich. Ich habe danach einen Tag zu tun, meine Antennen wieder zu flicken.
Hotel ODESSA ist der absolute Nobelschuppen am Ort. Klaus Völker, Klaus Görs und ich beehren das Haus mit unserem Besuch.
Wir ergattern zu dritt einen Tisch, weil wir dem Einlaßdienst einen höherwertigen Rubelschein durch den Türspalt geschoben haben. Das ist rundherum im Sowjetland so Brauch! Ich glaube das steht auch so in der Verfassung.
Der Muskat-Schampanskoje im Hotel kostet zwei Rubel sechzig Kopeken.
Auf der Reeperbahn kostet er das Zwanzigfache, aber dafür spart man die fünf Rubel Schmiergeld beim Einlaßdienst.
Das Zeug schmeckt recht ordentlich und löscht prima den Durst. Nur etwas kälter könnte der edle Tropfen sein.
Nach der ersten Pulle fragen wir den Kellner, wie viel Flaschen von der köstlichen Limonade er noch in der Last hat. So furchtbar viele sind es erwartungsgemäß nicht, wie kaufen vorsichtshalber den Bestand auf. Schließlich kann man ja mit sozialistischen Engpässen umgehen.
Der Ober öffnet jede Schampanskoe-Flasche, indem er die überschäumende Eruption in der Übergardine am Fenster etwas dämpft. Völlig unüblich, verfügt das Lokal über derartige Fensterdekoration. Besonders in der Ausrüstung mit geschmackvollen Lampen und Gardinen gehen deutsche und russische Geschmäcker recht auffallend auseinander. Aber schließlich sind in einer Gastwirtschaft Gardinen und Lampenschirme nicht unbedingt zum Essen und Trinken zwingend erforderlich.
Wir bitten den Ober, unsere gerade erworbenen Sektbestände kaltzustellen.
Der dann zügig angelieferte Nachschub bestätigt den Vollzug.
Ich übernehme jetzt ganz kühn das Öffnen einer Schampanskoe-Flasche, schließlich habe ich das schon Hunderte Male gemacht. Danach trägt Klaus Völker, der E-Mix quer über seine hellbraune Affenhaut-Lederjacke aus Gibraltar eine dunkel gesprayte Schärpe, als frisch gekürter Mister Odessa, oder so. Klaus Görs, der II. Ing. ist auch nicht ganz trocken geblieben.
Der Sprudel kommt mit solch einem Affenzahn aus der Flasche, daß zum profigerechtem Servieren die Benutzung der Übergardine anscheinend doch zwingend notwendig ist.
Ich haue dem Ober anerkennend auf die Schulter, da er immer dreiviertelvolle Flaschen hinbekommt, meine ist nur noch halbvoll.
Mittlerweile sind wir uns alle schon viel näher gekommen. Der Ober heißt Affanassi. Wir dürfen Nastji sagen und wir drei heißen auch irgendwie. Nastji hätte einen Wunsch, wenn wir wieder nach Odessa kommen. Wegen auftretender Mißverständnisse malt er den Wunsch auf eine Serviette. "Ah", sage ich, "du willst einen Kaktus!" Aber mit dem Tip liege ich nun total daneben, obwohl das Gemälde auf der Serviette das durchaus vermuten läßt.
Kurzum, Nastjenki wäre ganz erpicht auf Kondome. Aber solche mit Gnubbeln, die ich erkennungsdienstlich als Kaktusstacheln auf dem Serviettengemälde mißdeutet habe. Bei "H. Kästners diskretem Versand" sind die aber DDR-mäßig nicht im Angebot und Beate Uhse hat bei ihrem Siegeszug in die DDR diese segensreichen Kulturgüter erst zwanzig Jahre später in ihrem BUKO (Beischlaf-Utensilien-Koffer).
Wir fahren leicht beschwipst mit einer Wolga-Taxe zum Hafen. Taxen sind hier zu haben, seltsamerweise alle mit männlichem Fahrer und weiblichem Beifahrer. Nur die Rückbank steht drei Fahrgästen zur Verfügung. Das Mädchen schlägt ein, zwei Mann von uns einen Abstecher bei ihr zu Hause vor. Ich frage scherzhaft, wie's denn mit uns dreien wäre. "Tolko dwe moschno, tri net, cerze rabotajet....”
Zwei steckt sie also locker weg, aber in einem Ritt die Betreuung von drei Mann schlägt ihr doch zu heftig auf's Herz. Ich will sie noch fragen, ob sie etwa einen Bypaß hat, aber ich weiß nicht, was Bypaß auf russisch heißt.
Ich komme jetzt des öfteren in einen der schwarzmeerigen Tankerhäfen. Irgendeine Schmunzeleinlage bieten die Heinzis immer.
Im Hafen rührt sich nicht viel. Das Ballastwasser wird gemächlich aus dem Schiff gepumpt, hier holt sich niemand in übertriebener jüdischer Hast ein Magenleiden.
Es ist der 23. Februar. Die Sowjetbürger begehen den Tag der Roten Armee.
Eigentlich aber nur der männliche Teil der Einwohnerschaft.
Das schmälert an diesem Ehrentag landesweit etwas das Brutto-Sozialprodukt.
Es bedarf keiner sonderlichen Erklärung, daß jeder männliche Sowjetbürger, der in diesem Land im zivilen Sektor auch nur andeutungsweise etwas zu sagen hat, vorher ehrenvoll die Rote Armee verlassen hat. Ein halber Schuhkarton voller Orden, Abzeichen und Auszeichnungen beweist das! Somit ist im Sowjetland der "Tag der Roten Armee" so eine Art Herrentag, um das einigermaßen treffend zu beschreiben.
Das Sagen haben im großen Sowjetland meist die Männer. "Er" ist Spezialist, "Sie" ist Hilfskraft. "Er" sitzt unten an der Bedienung der Hebebühne und zieht abwechseln an der Papirossi-Zigarette "Tschaika" und ab und zu auch einmal an den Hebeln seiner Hebebühne, damit "Sie" oben mit einer fünf Meter langen Stange mit Farbrolle die Fassade vom Kulturhaus neu himmelblau anpinseln kann. Ich bewundere ständig die Power und das Zupacken der drallen Dirns, die um ihre schwere Arbeit und ihre recht häufig angesäuselten Männer nicht zu beneiden sind.
Also, es ist Tag der Roten Armee!
Kapitän Gustävel schickt mich in die Spur: "Schauen sie doch mal nach, ob bei 'Schiffsversorgungs' irgend etwas Brauchbares zu ergattern ist!"
In dem Magazin dienen heute nur die Damen, schließlich ist Tag der Roten Armee. Die verdienten männlichen Kämpfer und ganz besonders der Chef der Firma, werden irgendwo ganz feierlich für ihre früheren, die heutigen und die ohnehin noch zu erwartenden Verdienste geehrt: Na starowje, pod stolom mö vidiem!
In der Lagerhalle der volkseigenen Schiffsausrüster-Firma überfliege ich das gut übersichtliche Angebot und entschließe mich spontan für den Erwerb eines hölzernen Sauerkrautfasses. Russische Karpusta ist der Grundbestandteil von Borscht und Soljanka und überhaupt und sowieso hat Sauerkraut seit Urzeiten das seefahrende Volk vor Skorbut, Haarausfall, Impotenz und anderen Gebrechen bewahrt.
Das nehme ich!
"Die Lieferung erfolgt umgehend", garantiert mir die diensthabende stellvertretende Stellvertreterin. Sie ist nüchtern!
Ich gehe zu Fuß an Bord zurück, die Sauerkrautfaß-Lieferantin ist motorisiert. Das Sauerkraut und ich treffen nahezu gleichzeitig am Schiff ein.
Larissa hat das Faß per Gabelstapler, zwischen den Gabelholmen liegend, angeliefert.
Die Matrosen stellen die Ladebäume, das Faß wird an Bord gehievt. Anbei Lieferschein, wie sich das gehört, unterschreiben bitte! Der Wachoffizier ruft mich: "Hast du in "Russisch" damals besser aufgepaßt, Sauerkraut heißt doch auf russisch nicht ogurez?" "Eigentlich nicht" kratze ich mein Vokabularium zusammen, "aber saure Gurken wären ja auch zum Verzehr geeignet." "Djewotschka" wende ich mich an die überforderte Ersatz-Kommandierende des Schiffsversorgungs-Unternehmens: "Was ist denn nun drin in diesem Faß, Kraut oder Gurken?" Sie läuft etwas rosa an und meint: "Ja nje snaju, mö smotrim!"
Also schauen wir nach!
Ein kleiner Kuhfuß ist schnell zur Hand und zur Hand ist auch eine aus dem Faß gegriffene, grüne, sauer eingelegte Tomate.
Sauerkraut habe ich gekauft, saure Gurken stehen auf dem Lieferschein und saure Tomaten werden letztendlich angeliefert. Huch, ist das hier immer aufregend.
Das Sauerkraut-Gurken-Tomatenfaß tropft auf dem Rücktransport etwas zwischen den Holmen des Gabelstaplers, weil der wieder draufgedrückte Holzdeckel nun nicht mehr so dicht schließt.
Die Decks-Gang malt während einer Hafenliegezeit die seeseitige Bordwand des Tankers an. Dazu bedient sich die Malerbrigade eines selbst gefertigten Floßes. Das sind sechs leere Rollreifenfässer, die mit Planken belegt wurden. An einem außenbords hängendem Tampen verholt sich die Truppe auf dem Floß längs der Bordwand, an der sie ihre Farbrollen auf- und ab bewegen. Die Jacobsleiter, auf der sie vom Hauptdeck zum Floß hinabgestiegen sind, hängt mittlerweile mittschiffs. Das Floß ist inzwischen bis zum Achterschiff verholt und um zur Kaffee-Time an Bord zu gelangen, ist der Weg über die Leiter an der Spundwand der Pier bequemer.
Die farbbekleckerten Anstreicher gelangen auf diesem Weg aber nicht auf ihr Schiff, jedenfalls nicht über die Gangway.
"Stoi! Passport!" Die hier postierte Sowjetmacht ist unerbittlich.
Wer malt denn außenbords sein Schiff und verbeult dabei sein wichtigstes Dokument in der Arschtasche seiner farbbekleckerten Jeans?
Die Jungens klettern wieder zu ihrem Malfloß hinab und hangeln sich an der Leine seeseitig die Bordwand entlang, um seeseitig mittschiffs über die Jacobsleiter wieder an Deck zu klettern.
Dem steht behördlicherseits dann auch ohne Ausweisdokument nichts im Wege.
Die Bucht von Novorossisk ist nicht gerade eine Traumlagune. Strukturbestimmend ist hier das Zementwerk. Verkarsteter Kalkstein ist als Rohstoff zum Zementbrennen ringsherum, so weit das Auge reicht, reichlich vorhanden. Der Staub, der sich ständig durch die Filter der Zementöfen ins Freie schmuggelt, ist flächendeckend.
Auch die Pier vom Hafen Novorossisk ist mit Schottersteinen dieser Kalksteinvorkommen belegt.
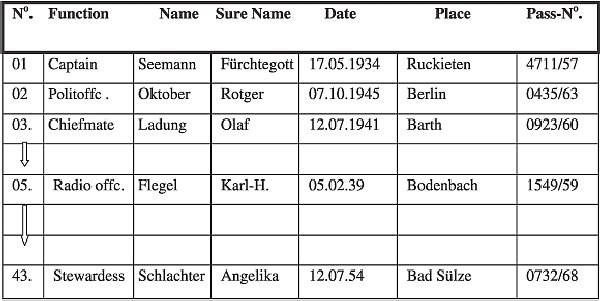 Beim Einklarieren des Schiffes hat der Kapitän einen riesigen Stapel an Papieren den gestrengen Behörden vorzulegen. Vorlegen ist leicht, ausfertigen ist arbeitsaufwändig und ausgerechnet das, ist auch mein Job. Zwölf Besatzungslisten, Store-Listen, persönliche Effektenlisten, na usw. usw.
Beim Einklarieren des Schiffes hat der Kapitän einen riesigen Stapel an Papieren den gestrengen Behörden vorzulegen. Vorlegen ist leicht, ausfertigen ist arbeitsaufwändig und ausgerechnet das, ist auch mein Job. Zwölf Besatzungslisten, Store-Listen, persönliche Effektenlisten, na usw. usw.
So ungefähr sieht eine Besatzungsliste aus.
Jedes Besatzungsmitglied bekommt bei der Einklarierung des Schiffes auf die noch evt. freien hinteren Seiten seines Seefahrtsbuches links einen Stempel reingehämmert. Beim Auslaufen das Gegenstück rechts daneben.
In diesem Stempel trägt der einklarierende sowjetische 'officer' nun die Nummer des Besatzungsmitgliedes laut Besatzungsliste ein. Bei mir ist das meist die Nummer -05-: Radio officer.
An der Gangway steht ein Wachposten. Armeeuniform, Schapka und Mäntelchen. Mäntelchen mit Knöchelschutz, es reicht bis auf die geschotterte Pier hinab.
Ihm wurde eine meiner Besatzunglisten übergeben.
Wir finden diese Bewachung deplaziert, wozu hat man denn Freunde. 'Honni' knutscht pausenlos Breshnew - oder wer gerade Dienst hat - und wir werden hier ständig mißtrauisch bewacht.
Beim Vonbordgehen und meinem Betreten der Sowjetunion schaut der Sergeant Timofej Nikitowisch Gehdumarof nun akribisch erst in mein Seefahrtsbuch. Nicht vorn beim Paßbild, wie alle anderen Paßkontrollen der Welt, nein, hinten beim Stempel.
Aha, Nummer -05- steht handschriftlich in diesem.
Jetzt schaut er in meiner angefertigten Besatzungsliste nach.
Aha, Nr. -05-, da ist sie ja.
Nun macht er hinter meiner -05- einen Strich. Nummer -05- ist an Land.
 Erklärenderweise muß ich hier einfügen, der Gangwayposten Timofej Nikitowisch schreibt von Haus aus kyrillisch, meine Besatzungsliste ist in lateinischen Lettern ausgefertigt. Glücklicherweise sind in diesen beiden konträren Schriftarten wenigstens die Zahlen identisch.
Erklärenderweise muß ich hier einfügen, der Gangwayposten Timofej Nikitowisch schreibt von Haus aus kyrillisch, meine Besatzungsliste ist in lateinischen Lettern ausgefertigt. Glücklicherweise sind in diesen beiden konträren Schriftarten wenigstens die Zahlen identisch.
Beim Vonbordgehen hat es Timofej Nikitowisch nun relativ einfach die Nummer im Stempel meines Seefahrtsbuches mit der Nummer in der Besatzungsliste zu vergleichen.
Wenn Nummer -05- wieder reumütig zu seinem Schiff zurückkehrt, macht der Sergeant in der Liste wieder einen Strich.
Zwei Striche hinter Nummer -05-: Mann an Land gewesen, aber wieder an Bord!
Auf diese Weise klappt das rund um das sowjetische Riesenreich immer reibungslos.
Es ist noch keinem Seemann gelungen, sich in dieses Arbeiterparadies einzuschmuggeln.
In Novorossisk hätte es allerdings fast geklappt, obwohl gerade hier, auf der geschotterten Pier, die ganz Innovativen auf Wacht stehen! Zusätzlich zu dem recht ausgefeilten System, jedem das Einschmuggeln in die verstaubte Traumlagune von Novorossisk zu vereiteln, hat Timofej Nikitowisch noch eine unüberwindliche Hürde aufgebaut.
Tanker WOLFEN ist beladen. Der Lotse ist an Bord, vorn und achtern sind die Schlepper fest. Aber das Kommando: "Klar vorn und achtern" bleibt aus.
Die Ausklarierung zieht sich hin.
Ich habe alle Seefahrtsbücher eingesammelt, im Kasten eingeordnet, dem Kapitän die Vollzähligkeit der Besatzung gemeldet.
Das ist u.a. auch mein Job, Routine, die reibungslos funktioniert.
Kapitän Gustävel ruft bei mir oben an, ob ich sicher wäre, daß die Besatzung vollzählig an Bord sei. "Hundert Pro Kapitän", sage ich "es brachte mir doch jeder persönlich sein Seefahrtsbuch."
Auf dem Schreibtisch vom Kapitän liegt ein Kalkstein, darum herum sitzen Tausende Rubel Gehalt. Diese Generale behaupten, daß einer von uns sich zum Verbleib in dieser Traumlagune hinreißen ließ.
Das muß ich jetzt näher erklären!
Immer, wenn ein Besatzungsmitglied die Gangway herabtrabt, bückt sich Timofej Nikitowisch Gehdumarof und entnimmt dem reichlich vorhandenen Kalksteinschotter der Pier ein Steinchen und deponiert dieses in dem umfangreichen Fassungsvermögen der aufgenähten Taschen seines Militärmäntelchens.
Zusätzliche Sicherheit zu seinen umfangreichen schriftlichen Dokumentationen.
Kommt Hein Mück vom Landgang zurück, vergleicht der Rotarmist penibel die Nummer vom Stempel im Seefahrtsbuch mit der der Besatzungsliste, macht hinter dieser den Rückkommerstrich und wirft ein Steinchen zurück auf die Pier.
Fort Nox könnte nicht sicherer arbeiten! Zwanzig Steinchen im Mäntelchen, zwanzig Mann an Land! Kein Steinchen mehr in der Tasche, alle an Bord.
Scheiße! Noch Stein im Mäntelchen und Schiff will auslaufen! Alarm!
Dieses Stückchen Kalkstein liegt nun bei Kapitän Gustävel auf dem Schreibtisch, wie ein Stück Königs-Jade oder der Koohinoor. Ein unumstößlicher Beweis, Towarischt Capitan, einer von ihrem 'Kommanda' kann sich von Novorossik nicht losreißen.
Das wäre nun ausgerechnet in diesem Town, keinem von uns in den Kopf gekommen.
Aber, so deutlich will der Alte den hochdekorierten Heinzis das nun auch nicht sagen.
Also, 'dawei poschli', alle Mann einrücken in die Mannschaftsmesse. Gesichtskontrolle! Kapitän und Chief werden vom Antlitz her vorher kontrolliert und behalten die Übersicht außerhalb des Gulag.
Jetzt stecken noch 41 Seefahrtsbücher in meinem Kasten und 41 dazugehörige Gesichter dichtgedrängt in der Mannschaftsmesse.
Wo denn sonst, wer segelt denn in Novorossik achter aus!?
Die Sowjetmacht beginnt mit der Gesichtkontrolle.
Jetzt aber nicht nach Stempel-Nummer und Besatzungslisten-Nummer, sondern richtig. Nun wird die erste Seite des Seefahrtsbuches aufgeschlagen, wo in lateinischer Schrift der Name des Passinhabers steht und auch sein Paßbild klebt.
Der Name wird dann vom russischen Vorleser nicht immer so gut getroffen, wie vorher das dazugehörige Paßbild vom Fotografen.
"Charl-Geinz Flägel!" Aha der meint anscheinend mich.
Aufstehen, Schokoladen-Seite zeigen, 'prawilno', rauß! Haken in der Spalte der Besatzungsliste. Letztes Seefahrtsbuch aus dem Kasten, letzter Mann aus der Messe. Alle Haken hinter allen Namen in der Liste!
"Sag ich doch, Kapitän. Wir sind vollzählig." Der Alte weiß halt, was er an seinen Mitarbeitern hat, zusätzlich zu dem Kalkstein auf seinem Schreibtisch.
Dieses Stückchen Mineral hätte ich gerne erworben.
Die knallharten Ölvermarkter im Persischen Golf schauen auf das Profit versprechende Material. Dort muß der Tanker Laden und Pumpen können.
Bei den Kommunisten muß er frei von Mehlwürmern sein, die Besatzung sollte möglichst vollzählig am Veteranentreff verdienter Aktivisten teilnehmen und eine gewissenhafte Bewachung des Schiffes und die Gesichtskontrolle der Besatzungsmitglieder ist fast die eigentliche Aufgabe eines Schiffes, einen sowjetischen Hafen anzulaufen. Als Beifang kann dabei auch gelegentlich Ladung angelandet oder abtransportiert werden.
Ich komme mit MT WOLFEN, später mit MT ZEITZ und MT SCHWEDT noch sehr oft zu den Heinzis an die Schwarzmeerküste. Sogar recht gerne. Soviel wie ich in dieser Gegend geschmunzelt, aber auch bewundert habe, streicht mir mein Verleger wegen "fasse dich kurz" aus dem Manuskript.
![]() Zu Gast bei "Steine & Erden"
Zu Gast bei "Steine & Erden"
Im Wonnemonat Mai 1969 beende ich den Dienst auf MT WOLFEN nach elfmonatiger Fahrzeit. Bis zum November habe ich jetzt Urlaub. Ich denke mal, wohlverdient.
Danach besuche ich mit MS RIESA die Staubkönigin am Apatitschütter von Murmansk.
Bei 36° Celsius im Minus muß ich im fahlen Dämmerlicht des Polarwinters das defekte Antennengetriebe des Radargerätes reparieren.
Ich ziehe alles an, was ich besitze und darüber noch den "Wachgänger", den Schaffellmantel und ebensolche Handschuhe. Die eisigen Sprossen der Leiter zum Mast hinauf, fühle ich durch die dickfelligen Fausthandschuhe. Wenn die behandschuhte Hand die untere Sprosse wieder los läßt, um zur nächst höheren zu wechseln, knirscht es wie beim Lösen eines Klettverschlusses. So ähnlich soll es ja klingen, wenn die Eskimofrau bei 40 Grad Minus die Binde wechselt.
Nach Steine & Erden auf der RIESA fahre ich schnell einmal mit MS TRATTENDORF nach Kuba, Zucker holen. Rohzucker, der bergeweise in Matanzas in das Schiff geschüttet wird. In Rostock wird er bergeweise mit dem Greifer im Freien auf Halde geschüttet. Das spricht sich unter den Bienen rund um Rostock herum.
Die fliegen nun zum bequemen Nahrungserwerb zu den Zuckerhaufen, statt sich mühsam mit dem Einsammeln von Pollen abzumühen. Die Imker sehen das aber nicht so gerne, weil der Kubazucker-Honig wohl nichts taugt.
Nach dem kleinen Karibikabstecher besuche ich mit MS SENFTENBERG, dem legendären Mostrichhügel, wieder zweimal Murmansk.
Dann kommt in Rostock mein Kumpel Jochen auf mich zu. Er soll demnächst mit
MS THALE nach Brasilien abrücken. In Rio wohnt eine Schwester meiner Frau.
"Fahr du die Reise" sagt Jochen "und versuche am besten noch, deine Frau mitzunehmen!"
Unser Inspektor in der Reederei segnet den Deal ab, Jochen fährt meine Fuhre und ich seine nach Brasilien. Einen Reisepaß hat meine Frau. Ich bringe die erforderlichen Unterlagen eigenhändig zu den Behörden und es geschieht das Wunder, meine Frau kann nach zwanzig Jahren Trennung in Brasilien ihre Verwandtschaft umarmen.
Allerdings kann auch sie sich nicht über den atlantischen Äquator schmuggeln. Da ist man auf Frachtschiffen eigen und der Taufschein muß hart erarbeitet werden.
Ich kann stellenweise gar nicht hinsehen, wie man mein Weib zurichtet.
![]() Nun mal eine ordentliche Äquatortaufe
Nun mal eine ordentliche Äquatortaufe
Nach diesen Gastrollen bei Massengut werde ich wieder bodenständig, für das nächste Jahr auf Tanker ZEITZ. Das ist mit 42000 Tonnen wieder ein Dickschiff mit viel Platz und geruhsamer Fahrt rund um Afrika, nach den Ölquellen des Persischen Golfes, aber auch nach Sardinien, Libyen, Ägypten, Libanon u.a.m.
Äquatortaufen auf Tanker ZEITZ sind etwas besonderes. Das Kernstück zur kulturellen Bereicherung dieses Ereignisses bildet ein Zweihundert-Liter-Faß voller Küchenabfälle. Ab Höhe Gibraltar werden diese sorgfältig in einem Rollreifenfaß gesammelt und in einer verschlossenen Last warmgestellt. Zwischen dem Erbseneintopf vom Freitag und den angebissenen Bockwürsten kontrastiert darin die Tomatensoße vom Abendessen zwischen den Kohlrouladen vom Sonntag. Ein hinzugefügter Batzen Bäckerhefe bringt Leben in die gesammelten Werke. Rechtzeitig am Äquator treibt die sämige Masse ordentlich Blasen und zieht Fäden. Jeden Abend, nach dem Abendessen, ist bis zur heiligen Taufe Faßbesichtigung, unter Einbeziehung der Täuflinge. Danach wird wieder sorgfältig verschlossen.
Alle naselang ist Sitzung des Taufkommitees. Ein, zwei Kästen Bier fördern dabei den Einfallsreichtum. Die Getränke werden bei der Oberstewardeß auf Verdacht geholt und später den Täuflingen angelastet.
Am Tag der Taufe wird der Kultplatz am Hauptdeck festlich dekoriert und über die Toppen geflaggt. Auch die Werkstätten und die Praxis des Doktors, des Frisörs, des Sternguckers und Seiner Merkwürden, des Pastors sind sehr anspruchsvoll dekoriert.
Um die Effizienz der Installation zu testen, wird ein Probeläufer aus dem Pferch geholt. Nach dem Probedurchgang wird er mit Schimpf und Schande, aber sehr schön dekoriert, zu den erwartungsvollen Täuflingen zurückgeworfen und vermittelt diesen einen kleinen Vorgeschmack auf das Bevorstehende.
Der Probeläufer und der Letzte der Täuflinge erfahren die besondere Hingabe Neptuns und seiner Truppenteile.
Beim Doktor wird der Täufling von allen ihn quälenden Leiden befreit. Wundersame, buntschillernde Elixiere stehen dafür bereit und sehr nützliche Gerätschaften, um diese auch dem Gebrechlichen einzuverleiben.
 Ich kenne keinen, der nach dieser Behandlung eine Zusatztherapie verlangte. Auch sind alle Patienten nach Befragung des Lobes voll.
Ich kenne keinen, der nach dieser Behandlung eine Zusatztherapie verlangte. Auch sind alle Patienten nach Befragung des Lobes voll.
Die Impotenz, die Vorhautverengung, das Hämorrhoidalleiden und der Tripper, alles wie weggeblasen. Auch die Entwurmung klappt. Vorausgesetzt der Täufling nimmt auch artig die umfangreich verabreichten Medikamente. Er bekommt dabei vielfältige Hilfestellung.
Das hair-styling-Angebot beim Frisör ist sehr umfangreich.
Die Preisliste kennt nur Produktenwirtschaft, die Preise sind in Kisten Bier ausgezeichnet.
Im Endeffekt endet aber alles mit einer Vollglatze. Die Ausgangsform einer jeglichen Frisur ist das Kreuz des Südens, dazu fährt die Haarschneidemaschine einmal längs und einmal quer über die zu taufende Rübe. Danach wird je nach eingebrachten Spendenbeitrag eine kleine Schädelfläche total enthaart, so daß später nicht etwa ein ganz kurzer Igel noch eine Schadensbegrenzung bewirkt.
Vorher muß der Frisör allerdings die Nudeln, die Fischgräten oder das bunte Sauerkraut aus
dem Haarschopf des Täuflings kratzen, sonst bleibt seine Haarschneidemaschine stecken!
Sehr effektvoll und beständig wirkt in diesem Bereich eine Haartönung mit rotem Castellani.
Ganz übel ist der Einsatz von Graphitpulver. Hans Knackmus, der Doktor, wirft seiner mitreisenden Ehefrau eine Handvoll dieses schwarzen Staubes in den Badeanzug. Er muß danach eine Stunde lang sein Weib unter der Dusche schrubben, um sie wieder gebrauchsfähig erscheinen zu lassen.
Den Gebrauch von Separatordreck hat auf diesem Schiff der Kapitän untersagt, davon wird das Schiff zu dreckig.
Zum Belüften der Ladetanks verfügen Tanker über lange dicke Schläuche. Diese sind aller Meter mit Ringen versteift, ein Mann kann sich da hindurch zwängen.
Täuflinge werden hindurchgezwängt.
Zur Beschleunigung des Streckenvortriebes wird dem Delinquenten beim mühsamen Vorwärtsrobben ein C-Schlauch-Wasserstrahl auf den Mors geballert. Selbstverständlich finden sich immer Helfer, die den langen Schlauch kurzzeitig am Ein- und Ausstieg anheben, dann sammelt sich darin das Wasser und draußen wartet die Meute auf Viktualienangebote des Täuflings, der sich im Schlauch langsam klarmacht zum Ersaufen.
Am Ende des Wassersackes packen kräftige Hände den leicht Verwirrten... und hinein geht es in den herrlichen 'wirl pool' mit den gärenden gesammelten Speiseresten. Diese wurden in eine Leckwanne umgefüllt, die benötigt man auf einem Tanker zum Unterstellen, wenn der Schlauch nach dem Beladen abgeflanscht wird.
Ralf Timm ist I. Ingenieur auf MT ZEITZ. Auch ihm wurde das übelriechende Taufbecken täglich vorgeführt, da ihm mangels Taufschein diese längst überfällige Weihe zuteil wird.
Ralf wird aus dem Schlauch gezerrt. Er ist ein langer kräftiger Kerl und hat im Schlauch die Nerven behalten. Er langt unter die Leckwanne und nutzt zusätzlich zu seiner noch erheblich vorhandenen Restenergie die Hebewirkung der Herolde, die ihn in die Höhe reißen.
Die Wanne schlägt um.
Makkaroni, Bratkartoffeln, Erbseneintopf und Kohlrouladen in gebundener blasentreibender Soße ergießen sich übelriechend über die Kultstätte. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Das Zeug ist glatt wie Schmierseife. Bis das Deck mit Feuerlösch gespult ist, klammert sich jeder am Schiffszaun oder dem Handläufer fest, um nicht weiter in die Drift zu gehen.
Im Wassergraben driften die Makkaroni und Rouladen vorbei und verstopfen die Speigatts.
Ich mieme heute den Pastor.
Auf meinem prächtigen Beichtstuhl gewinnen alle Täuflinge wieder ihren Lebensmut zurück. Die beweglichen Schrubber und Drahtbürsten auf der Sitzfläche verhindern in der kuscheligen Atmosphäre das Einschlummern während meiner Predigt und der Beichte. Ich lese aus einer, in getriebenem Kupfer gefaßten Heiligen Schrift. Als Lesezeichen hängt aus dieser ein mit Schmierseife aufgeschäumtes Kondom. Nach entsprechenden Wohltätigkeiten darf der Sündenfreie ein deftiges Pornobild küssen, den Ehefrauen und Stewardessen wird natürlich ein passendes Gegenstück offeriert.
Diese Oase der Ruhe und Besinnlichkeit inmitten dieses Tohuwabohus weckt allseits die abgeschlafften Lebensgeister meiner Kundschaft.
Der nun von allen Krankheiten und Lastern gesäuberte und geläuterte Nordhalbkugel Bewohner und natürlich auch die Nordhalbkugel-Bewohnerin (damit die Schwarzer nicht meckert), darf nun die Südhalbkugel befahren und sich seinerseits und natürlich auch ihrerseits nun während der ganzen Reise einen Kopf machen, wie er und natürlich auch sie, auf den kommenden Reisen den Neuen die Hacken warm macht.
Ich habe als Teilnehmer der Taufkomitees ständig um Beiträge und echte kulturelle Bereicherung am geselligen Abend nach dem Taufzeremoniell gebeten, wenn die Spenden der getauften bunten Glatzen die materielle Grundlage bilden und die sehr prachtvoll gestalteten Taufscheine ausgehändigt werden.
In der Erfindung der unmöglichsten Massakriermethoden während des Taufzeremoniells, wird auf jedem Schiff ein unwahrscheinlicher Ideenreichtum entwickelt. Aber zur niveauvollen Gestaltung des Ablaufes der darauffolgenden Feierlichkeiten, ist dann immer gerade die Birne des Hauptmassakrierers total leergeblasen.
Es kommen dann immer die gleichen Argumente: Mich haben sie auch geschunden wie Sau, ich mußte ....usw.
Wehe, wenn bei diesen Anlässen die ordnende Hand fehlt!
Auf einem Asienfahrer wird einem mitreisenden Kamera-Team eine wohl nicht zimperlich inszenierte Äquatortaufe vorgeführt. Nachdem die Bilddokumente an Land ausgewertet wurden, folgt die Reaktion auf dem Fuße. Per Telegramm an alle Schiffe der Reederei, verbietet der Generaldirektor die Äquatortaufe.
Nach meinem Dafürhalten ist das nicht die richtige Lösung. Keiner soll sich über den Äquator schmuggeln und auch nicht mit einem Farbtupfer auf der Stirn davon kommen, wie auf einem Musik-Liner.
Aber einigermaßen würdevoll sollte es dennoch zugehen, als gut inszenierte Show mit viel Farbe und viel Lärm um nichts. Eine einigermaßen niveauvolle Abwechslung im täglichen Einerlei einer langen Reise über den Äquator.
![]() Die lebensbedrohende Zahnpasta
Die lebensbedrohende Zahnpasta
Mit einem frischen Unterwasseranstrich und wieder aufgemotzter Technik ist Tanker ZEITZ zum Ölholen nach Scheicheranien unterwegs.
Gerhard Schalk ist E.-Ing. auf dem Schiff, Klaus Görs II. Ing. Das sind angenehme Kollegen, wir sitzen in der O-Messe gemeinsam beim Frühstück. Da tönt Gerhard ziemlich laut: "Ich möchte mal den kennen lernen, der seine Chlorodont-Zahnpasta unbedingt im Kühlschrank lagern muß!" und weist mit dem Kopf unmerklich in Richtung des III. Ing's. Wölfchen Weich. Mit dem teilen sich die beiden auf dem Gang der Ingenieure einen Kühlschrank. Darin stechen ihnen sechs darin deponierte Zahnpastatuben der Marke Chlorodont ins Auge, deren Kühlung sie nicht für nötig erachten, während die Dinger nur Platz wegnehmen.
"Du weiß genau, daß das meine sind!" meldet sich Wölfchen vom Nebentisch. Aber das verbale Für und Wider zur Kühlung der Zahncreme bringt keinen Konsens.
"Morgen scheiße ich ihn an!", faßt Gerhard Schalk nun einen ehernen Beschluß.
Fünf dieser dauergekühlten Tuben haben einen weißen Schraubverschluß, eine trägt einen roten. Gerhard öffnet mit einer Rasierklinge das untere umgebördelte Ende einer Zahnpastatube. Zum besseren Wiedererkennen nimmt er die mit der roten Verschlußkappe. Die Zahnpasta wird säuberlich ausgeräumt und durch die Hautschutzsalbe ersetzt, die im Maschinenraum in großen Pötten die Maschinenleute vor der Ölkrätze schützen soll. Das Werk ist gut gelungen, die Tube ist prall und weist keinerlei Besonderheiten auf. Nur die rote Verschlußkappe offenbart Eingeweihten, das ihr innewohnende Geheimnis.
Die Rote führt im Kühlschrank die gekühlte Kolonne an.
Klaus und Gerhard inspizieren während Wölfchens Maschinenwache den fortschreitenden Verbrauch seiner Zahnpastatube in der Naßzelle seiner Kemenate.
"Lange kann es nicht mehr dauern, dann braucht er eine Neue" lautet der neuste Situationsbericht, den uns Gerhard Schalk beim Frühstück vorträgt.
Bange Tage des Wartens vergehen.
Eigentlich haben wir drei die Angelegenheit schon etwas aus den Augen verloren, da meint Wölfchen beim Frühstück, mit frisch geputzten Zähnen: "Ich weiß nicht, die von Chlorodont mischen ein Zeug zusammen, das hält'ste gar nicht mehr aus beim Zähneputzen!"
Wir drei Eingeweihten am Nebentisch drehen die Köpfe zur Seite, laufen rot an, reißen die Taschentücher heraus, aber jeder hat sich im Griff, keiner prustet los, obwohl jedem fast der Mors platzt.
Wölfchen tritt um 08.00 Uhr seine Wache an. Klaus ruft mich vorn an und meint: "Du, der hat die rote Tube in der Mache und cremt sich mit dem Schnodder tatsächlich die Zähne ein!"
Jetzt geht eine Lawine zu Tal, die ich maßgeblich losgetreten habe und für die ich mich bei Wölfchen heute nach 30 Jahren nochmals entschuldigen möchte.
Den kritischen Leser versichere ich, auch hier, wie an keiner Stelle dieses Buches Seemannsgarn zu publizieren.
Ich spanne ein Empfangstelegramm-Formular in meine Schreibmaschine und verfasse dieses fingierte Telegramm:
an alle schiffe der deutschen seereederei stopmitteilung des veb elbflorenz dresden hersteller der chlorodont zahnpasta stop auf grund einer bedauerlichen verwechslung der einfuellstutzen des fuellgutes mit den schmiernippeln der abfuellautomaten gelangte in eine betraechtliche anzahl unserer zahnpastatuben schmierfett statt zahncreme stop wir bitten dieses technische missgeschick zu entschuldigen und nehmen im umtausch die fettgefuellten tuben selbstverstaendlich zurueck stopveb elbflorenz dresden fettich technischer direktor
Kapitän Fanger wird von den hier laufenden Späßchen unterrichtet. Jonny Zöllner ist Leitender Ingenieur. Die Kommandohöhen des Schiffes haben gegen die spaßige Auflockerungen des Betriebklimas keine Einwände. Das Klima an Bord ist ohnehin in Ordnung.
Ich publiziere das eingegangene Telegramm!
"Siehste, siehste", tönt Wölfchen los, "ausgerechnet so eine Tube habe ich auch erwischt. Das Zeug da drin kam mir doch sowieso schon so komisch vor!"
Mittlerweile haut es im krampfhaft unterdrückten Lachen nun schon alle in der O-Messe unter die Back, aber jeder erstickt eher am unterdrückten Losprusten, als irgend etwas zu verraten.
Alle sprechen Wölfchen ihr Beileid aus.
Der hat mittlerweile seinen weiteren gekühlten Vorrat kontrolliert und richtige Zahnpaste in den verbleibenden fünf Tuben vorgefunden.
Damit wäre eigentlich die Sache gelaufen.
Der Tanker läuft auf der F 142, das Leben plätschert träge vor sich hin.
Ich setze einen drauf und empfange ein weiteres Telegramm:
an alle schiffe der deutschen seereederei stopmitteilung des veb elbflorenz dresden hersteller der chlorodont zahnpasta stop bezugnehmend auf unsere erste mitteilung sehen wir uns veranlasst alle benutzer des bedauerlicherweise in die zahnpastatuben gelangten schmierfettes auf folgende gefahren hinzuweisen stop das fett wurde aus armeebestaenden erworben stop eine erhebliche radioaktive kontaminierung war uns nicht bekannt stop die kapitaene ermitteln auf den schiffen den bestand an kontaminierten zahnpastatuben stop diese unbedingt unter verschluss nehmen stop intensive medizinische beobachtung eventueller kontaktpersonen mit schmierfett dringend erforderlich stop bei auftretenden gesundheitschaeden gemaess anleitung - verhalten nach nuklearschlag - verfahren stop seereederei rostock generaldirektor veb elbflorenz direktor technik
Der III. Ing Wolfgang Weich ist Techniker und wirklich kein schlechter. Er ist Kumpel und wir mögen ihn alle.
Aber er checkt noch nichts.
Im Gegenteil, ihm befällt die Panik.
Auf dem Schiff weiß nun auch die verschlafendste Type, was läuft, nur eben Wölfchen nicht.
Ich bin schon völlig ratlos, die Bombe muß doch nun endlich einmal platzen und Wölfchen mir mit dem nackten Mors ins Gesicht springen.
Klaus Görs, der II. Ing. schickt seinen Wach-Assi Rainer Martens los. Der kommt mit seinem Schuhkarton auch vorn zu mir auf die Brücke, ob ich Chlorodont-Tuben hätte.
Befehl vom Alten, auch richtige Zahnpastatuben der Marke Chlorodont müßten abgegeben werden. Sein Karton ist schon recht ordentlich gefüllt.
Die ganze Bande auf dem Schiff spielt mit, überzeugender noch als das Ohnesorg-Theater!
Ich empfange eine wahre Katastrophen-Meldung:
an alle schiffe der deutschen seereederei stopmitteilung des medizinischen dienstes des verkehrswesens stopdie orale kontamination mit radioaktiven isotopen des faelschlichen inhaltes der chlorodont-tuben bisher unterschaetzt stop zur zusaetzlichen entlastung des rostocker suedstadtkrankenhauses und der aufnahmekapazitaet der uni-klinik rostock stellt deutsche seereederei vierte und fuenfte etage des reedereigebaeudes am herrmann dunker platz als notbettenstation zur verfuegung stop
die kapitaene der schiffe achten bei ihren besatzungsmitgliedern auf folgende symptome stop nachtblindheit - unkrontrolliertes harnlassen - haarausfall stop
kontaminierten personen empfiehlt der medizinische dienst folgende prophylaxe stop
tragen einer dunklen brille zur vorbeugung der nachtblindheit stop zur vorbeugung des drohenden haarausfalls mit bordmitteln nur in essig gequirltes ei verfuegbar stop
damit kopfhaut massieren zusaetzlich rotlicht bestrahlung empfohlen stop
aus atomarkoffer praeparat nr 27 doppelter dosierung verabreichen stop stuhlproben zur spaeteren auswertung entnehmen stop
prof dr wc dont
Siggi Edel, der II. Offizier, öffnet sein Hospital.
Selbstverständlich verfügt seine gut sortierte Ausstattung auch über den "Atomarkoffer". Er hat dazu die hölzerne Rettungsboots-Apotheke umfunktioniert und umdekoriert. Das Präparat 27 ist darin natürlich auch verfügbar.
Assi Martens, ist angeblich auch Chlorodont-Geschädigter.
Der III. Ing. Wölfchen und Assi Martens, die rechte Hand vom II. Ing., begeben sich nun als frisch gegründete Selbsthilfegruppe in ärztliche Behandlung. Sie begleitet das aufrichtig geheuchelte Mitgefühl der gesamten Schiffsbesatzung.
Die einzige zerbeulte Rotlichtlampe kreist sich Wölfchen ein. Er hat ohnehin schon schütteres Haar und nun droht auch noch weiterer Haarausfall.
Rainer Martens ist Kumpel, er überläßt dem III. Ing. das Gerät zur alleinigen Nutzung.
Beide empfangen das übliche Röhrchen für ihre Stuhlabgabe. Sie wissen doch, die kleine Glasröhre in der Holzschachtel und dem kleinen Löffelchen dazu.
Die Anteilnahme der gesamten Besatzung ist rührend.
Der Storekeeper bastelt eine dunkle Brille, zur drohenden Abwehr der Nachtblindheit. So ein dicht ansitzendes Modell mit Ledereinfassung und stark getönten runden Gläsern. Martens meint, er hätte eine unwahrscheinlich dunkle Sonnenbrille, er benötigt diese Zuarbeit nicht.
Der amtierende Schiffsveterinär, Siggi Edel, verabreicht auch das vom Medizinischen Dienst empfohlene Präparat Nr. 27. Welches Präparat nun von ihm die Nr. 27 erhält, lag bei der Abfassung meines fingierten Telegrammtextes außerhalb meiner Einflußsphäre.
Siggi entfernt schon fast im Zeremoniell indianischer Schamanen die Plomben an der medizinischen Überlebenshilfe nach einem erfolgten Atomschlag, an seiner umdekorierten Rettungsbootsapotheke.
Das Präparat Nr. 27 sieht respekteinflößend aus.
Kleine silberne Kugeln. So wie Luftgewehrkugeln für das GST-Sportmodell 47A. Zwei Stück hat zur Prophylaxe der medizinische Dienst 'telegrafisch' empfohlen.
Wölfchen möchte sich am liebsten das ganze Röhrchen einverleiben, um zu überleben.
Assi Martens ist nicht so gierig.
Siggi läßt mit sich reden, na gut, drei! Mehr sind wirklich nicht zu verantworten.
Wölfchen frißt nun drei "Siran"-Pastillen!
Fragen sie Ihren DDR-Hausarzt danach, falls alle Mittel gegen Hartleibigkeit bisher nicht anschlugen! Aber nehmen sie wirklich nur eine!
Wölfchen hat eine bewegte Wache im Maschinenraum.
Das erste Klo befindet sich drei Etagen höher, als der Fahrstand seiner Maschine.
Laut Auskunft der Stewardeß therapiert er auch die drohende Glatze mit im Essig gequirltem Ei. Dieses Hobby-Thek-Schampoo soll irgendwie unansehnlich ausflocken.
Auch mit der zerbeulten Rotlichtlampe bestrahlt er anscheinend pausenlos, seinen schon schütteren Haarwuchs.
Jonny, der Chief, ruft mich an: "Felix, wie lange soll denn das hier noch so ablaufen?"
Mir ist das schon längst peinlich. So gewaltig habe ich die Geister nun auch nicht gerufen, denen jetzt schlecht Herr zu werden ist.
"Jonny, wir lassen das hier abebben und schicken ihn in Rostock mit seinem gefüllten Kackeröhrchen als Chlorodont-Geschädigten zum Medizinischen Dienst. Dort sind studierte Leute, die können ihm bestimmt schonender beibringen, daß hier ein Mißverständnis vorliegen muß."
Um 20.00 Uhr zieht Wolfgang Weich auf Wache und trägt tatsächlich diese unmögliche dunkle Brille, deren Lederlaschen um die Gläser das halbe Gesicht verdecken, aber schön lichtdicht anliegen.
Wölfchen ist so um seine Gesundheit bedacht, daß er keinen Gedanken daran verschwendet, evt. einem Ulk aufzuliegen.
Die Angelegenheit ist schon so makaber, daß seine Techniker-Kollegen bei diesem Anblick nicht mehr wissen, ob die Tränen in ihren Augen vom Lachen oder vom Bedauern stammen.
Wölfchen ist während seiner Wache pausenlos unterwegs. Der Maschinenraum eines 42 Tausend-Tonnen-Tankers ist ein Hochhaus. Das erste Klo ist während seiner Wache weit über ihm und wenn er wieder unten ist, muß er schon wieder die vielen Niedergänge nach oben. Drei "Siran"-Pastillen sorgen für dauernden Auftrieb.
Jonny Zöllner wird es zu blöd.
Sein Wach-Ing., der mit dieser stockdunklen Brille kaum noch die Temperaturen ablesen kann, macht sich vor der gesamten Truppe total zum Löffel.
Jonny ruft seinen Wachingenieur an: "Nun setzen sie da unten endlich die blöde Brille ab!" Wölfchen weigert sich, es geht schließlich um seine Gesundheit!
Anweisungen, die gegen die Gesundheit und den Arbeitsschutz verstoßen, braucht der Werktätige schließlich nicht zu befolgen!
Der Leitende Ingenieur macht der Tragikomödie nun ein jähes Ende.
Wäre diese monströse Brille nicht gewesen, hätte ich den "Stuhlgang" zum Medizinischen Dienst in Rostock als das eleganteste Finale dieses Theaterstückes angesehen.
Ralf Timm, der I. Ing. allerdings hätte eine ganz hintertückische Idee für weitere Drehbuchseiten als Fortsetzungsroman. Wir lachen abschließend noch einmal Tränen als er meint: "Der Mega-Hammer wäre ja, wenn er nach Anlaufen Rostocks, in Quarantäne an Bord, seine Frau nur durch eine Glasscheibe sehen dürfte!"
![]() Die Bordkultur
Die Bordkultur
Nun hatte ich mich auf MT ZEITZ mit Wölfchen gerade wieder versöhnt, da rissen uns meine vorübergehenden Glucosewerte auseinander.
Ich schaute zuckerkrank meinem auslaufenden Schiff hinterher. Tanker ZEITZ war ein schönes Schiff.
Nach einwöchigem Check in der Uni-Klinik bin ich aber wieder gesund, das Labor hat sich bei der Seetauglichkeitsuntersuchung anscheinend geirrt.
Als Aushilfskellner kommt man zwar viel rum, aber das befriedigt mich nicht.
Ich möchte wieder einen Tanker, möglichst einen großen.
Im Herbst 1971 übernehme ich Tanker SCHWEDT und fahre darauf knapp drei Jahre.
Mittlerweile in die Jahre gekommen, schätze ich das geruhsamere Berufsleben auf einem
Großtanker. Andererseits muß man auf langen ereignislosen Tankerreisen mit sich umgehen können.
In den Messen stehen Fernsehapparate. In Küstennähe sind damit gelegentlich auch Schattenspiele zu empfangen, für verwertbare Bilder müßte aber bei einem in Fahrt befindlichen Schiff ständig die Antenne nachgerichtet werden. Erschwerend hinzu kommt dann immer der Normenunterschied zwischen Secam und Pal und der Abstand zwischen Bild und Ton der verschiedenen Länder-Normen. Reibungslos klappt es also nie!
Rundfunkmäßig ist weltweit, zumindest mit meinen guten Seefunkempfängern, die "Deutsche Welle" zu empfangen. Da erfährt man wenigstens, wie zu Hause das Wetter ist. Eine Schlagerparade läuft über diesen Kurzwellensender aber auch nicht! "Radio Berlin International" wimmert zwar auch irgendwo im Hintergrund, aber die Propagandierung der ständigen Erfolge der DDR-Volkswirtschaft geht jedem glatt am Mors vorbei. Ich nehme täglich eine Schiffspresse auf. Zwei mühsam erkämpfte DIN-A4-Seiten, die aus den schwachbrüstigen Morsezeichen trotz Störungen und atmosphärischen Beeinträchtigungen errungen werden.
"Der Schiffs-Bummi", wie er in der Flotte verächtlich genannt wird, ist journalistisch trocken und dilletantisch gemacht. Hier erfährt der Seemann, daß die KIM-Hühner im Hühner-KZ Neubukow um die Planerfüllung ringen und im Königreich Tonga, die DDR durch den Besuch des Außenministers weiter an Einfluß gewonnen hat. Der einzige an Bord, der sich nach seinem ausgiebigen Mittagsschlaf und dem Bepudern seines Dekubitus auf die Schiffspresse giert, ist der Politnik.
Der "Schiffsbummi" informiert den desinteressierten Seemann, daß die Nachzucht einer Herdbuch-Rinderrasse nun ganz mächtig gewaltig erfolgreich abgeschlossen sei. Ich garniere eigenverantwortlich diesen Artikel, damit meine Presse überhaupt jemand liest:
bei dieser neuen rinderrasse legten die zuechter ausser der steigerung der milchleistung, ihr besonderes zuechterisches augenmerk auf den fleischertrag des kuhschwanzes. dieser erreicht bei den tieren der neuen rasse eine durchschnittliche laenge von 3,65 metern. um die hervorragende fleischqualitaet nicht durch guelleverschmutzung zu beeintraechtigen, wird das hintere schwanzende am horn des rindes in einem eleganten bogen in einem schnappverschluss eingerastet. die ochsenschwanzsuppe, die im warnemuender neptunhotel aus dieser neugezuechteten fleischsorte kreiert wurde, errang in tokio zur weltsuppenausstellung den ehrenpreis des kaisers heroito.
Solche gelegentlich eingefügte Schmankerln läßt die Besatzung in den Messen nun häufiger zu dem Schnellhefter mit der Schiffspresse greifen.
Aber nicht lange.
Ich stehe dafür in Rostock auf der Matte und fasse von der Politabteilung einen ordentlichen Hammer ab: "Verfälschung der Nachrichten von ADN", heißt das Verbrechen gegen die Deutsche Demokratische Republik. Ich komme gerade noch mit einem blauen Auge davon.
Nun liegt der "Schiffsbummi" wieder mit seinem unverfälschten propagandistischen Wert im Pressehefter, aber den nimmt nun wieder kaum einer in die Hand.
Uns bleiben an Bord also nur zur kulturellen Erbauung die mitgebrachten Tonbandkassetten. Einmal in der Woche zeigt der E-Mix, was die DEFA auf 32 mm-Film alles so auf der Palette hat.
Gelegentlich schlägt hier allerdings der nimmer ruhende Klassenfeind zu, in dem dieser, in Gestalt philippinischer Seeleute, in ereignislosen Wüstenhäfen einen Filmetausch anbietet. DEFA-"Karbid und Sauerampfer" gegen Hollywood's "Doktor Schiwago" und "Sodom und Gomorra". Bei der Gelegenheit zieht sich an der Ölpier von Kharg Island (Irak) die Besatzung drei Monsterfilme an einem Abend rein. Bis morgens um 04.00 Uhr dauert die cinematografische Großveranstaltung in der Mannschaftsmesse.
Für den wegschauenden Politoffizier ist das dann aber die gleiche Tortour, wie für den Dornenvogel Pater Ralph der Bruch seines Gelübtes.
Ansonsten muß die Freiwache ideenreich altherkömmlich gestaltet werden, so wie es die Menschen vor der Einführung von Fernsehen, Video und Computerspielen taten. "Mensch ärgere dich nicht", "Halma" und "Malefiz" erheitert die Truppe.
Ein paar Reisen lang beanspruchen beispielsweise achtzigtausend Knoten den größten Teil meiner Freizeit, bis ich diese mühsam zu einem prächtigen Teppich zusammen gefügt habe.
Shuffle-board-Wettkämpfe erzeugen auf dem Hauptdeck eine Atmosphäre, wie beim Leichthletik-Sportfest in Zürich.
Zum Sportfest erfinde ich die Sportart "Hochsee-Schiffsbiathlon". Dazu muß ein Dreierteam 20 Meter Sackhüpfen und dann gegen die Uhr Luftgewehrschießen.
Auf MS JOHN BRINCKMAN trifft die mitreisende Ehefrau Luckmann beim Schießen nicht einmal einen der drei hochkantigen Lukendeckel, wie dann erst die daran festgepinnte Scheibe. Die Frau vom E.-Ing. hält zum erstenmal ein Gewehr in den Händen. In einem Crash-Kurs wird ihr intensiv und fachmännisch die Handhabung des Gewaffs erklärt.
Jetzt ballert sie, mit Augen zu, ganz verbissen den nächsten Schuß raus und schießt… eine Acht. Ihr Schießtrainer ist begeistert, als er auf der Scheibe des linken Lukendeckel den Treffer markiert. "Wieso denn da", wundert sich Frau Luckmann, "ich habe doch auf den mittleren gezielt!"
Auch Bordfeste und karnevalistische Lumpenbälle bereichern gelegentlich das kulturelle Geschehen an Bord. Es müssen aber immer ein paar Leute bemüht sein und sich engagieren, daß nicht die Trägheit an Bord die Oberhand gewinnt.
Zum Lumpenball ist die Messe mit Netzen und buntgefärbten Lokuspapier-Girlanden dekoriert. Als Deckenverkleidung dient ein stramm gespanntes Netz. Aufgepustete Kondome, mit ein paar bunten Schnörkeln und Tupfen bilden darüber die dekorativen high lights. Ich fülle so einen "Pariser" mit einem halben Eimer Wasser und lege ihn zu den übrigen ins Netz über dem Eingangsschott.
Zu später Stunde führt der lange E.-Ing. Lewerenz die Polonaise an. "Wir lagen vor Madagaskar und hatten Asbest an Bord" und "It's a long way to tripper-marry" intoniert in Faß-Dur nach Knöchelverzeichnis 4711 die Wandergesellschaft.
Als sich die Truppe anschickt, die Messe zu verlassen, um am Achterdeck um die Poller und Winschen zu wandern, setze ich, ganz hinten lauernd, mit dem Luftgewehr über dem Ausgang den halben Eimer Wasser frei.
Das betrübt vorrübergehend die ersten zwei, drei Führungspersönlichkeiten der fröhlichen Wandersleut. Die tropfen ab, die trocken gebliebenen erheitert das sehr. Ich gehöre allerdings, nach dem ich fertig bin mit lachen, zum Aufwischkommando.
![]() Eine zu große Lippe
Eine zu große Lippe
In Rostock begrüßen wir an Bord als Neueinstellung einen Elektro-Ingenieur.
Er kommt aus Bad Sülze und versteht anscheinend sein Handwerk.
Er hat die Ahnung eines "Rettungsbootsmannes" und "Feuerschutzmannes" vor seiner Erstanmusterung an Land eingefüllt bekommen, aber ansonsten sticht er genauso unbedarft in das große weite Meer, wie ich vor dreizehn Jahren mit Dampfer THÄLMANN PIONIER. Mit einer Ausnahme, ich habe mich auf meiner ersten Reise gesenkten Hauptes auf dem Schiff bewegt und mehr zugehört, als selbst eine große Lippe zu riskieren.
Unser neuer Mann wurde schlecht beraten.
Er sucht sein Heil in der Flucht nach vorn und weiß der Teufel warum, er legt sich dauernd mit mir an. Ich pflege stets auf den Schiffen mit dem E.-Mix. ein kollegiales Verhältnis, schließlich bin ich auf deren Permukels aus den Generatoren und oftmals auf ihr elektrisches Knoff-hoff angewiesen.
Der Neue hat wohl irgend woher Wind bekommen: "Funker Felix" ist immer für ein Späßchen aufgelegt, laß dich nicht anscheißen!"
Ich habe nichts der gleichen im Sinn, aber der Neue wedelt so aufgeregt mit den Armen, daß er überhaupt nicht zu übersehen ist.
"Gustav", wende ich mich an seinen Vorgesetzten, "deine Neuerwerbung schlägt ganz schön viel Schaum, machst du mit?"
"Natürlich!" Chief Gustav Michalzik gehört während einer langen Seereise zu den Typen, die dazu beitragen, daß Seefahrt nicht langweilig und ereignislos ist. Auf Tanker ZEITZ vorher war Jonny Zöllner, sein Berufskollege, das Pendant bei der Bewältigung des Chlorodont-Schadens.
Das Schiff stampft auf der F142 auf Capetown zu. Wir fahren durch eine Robbenherde und amüsieren uns über die "alten Herren", die mit ihren Glatzköpfen und dem gepflegten Schnurrbart uns wohlwollend beim Passieren zuwinken. Einige tragen einen Kranz Seetang um den Hals, in dem sie gerade ihren Mittagsschlaf abhielten, als der Tanker sie daraus heraus riß.
Ich empfange ein Telegramm, fingiert natürlich. Der Kapitän ist unterrichtet, welche spaßigen Spielchen laufen:
kapitaen mt schwedt
auf gebrauchttonnage grosstanker ex sea rover flaggenwechsel in trondheim / norwegen stop schiff jetzt in reedereibesitz als mt premnitz stop zur besetzung anreise des leitenden ingenieur und e - ing dringend erforderlich stop veranlassen sie flugreise capetown - oslo stop rueckbestaetigung und vollzug melden stopseereederei direktor spezialschiffahrt
Gustav zeigt seinem wirbelnden E.-Ingenieur das Telegramm: "E-Mix, wir beiden müssen in Kapstadt absteigen und nach Trondheim fliegen. Dort wartet auf uns der neuangekaufte Tanker PREMNITZ. Also los, viel Zeit bleibt nicht mehr, Koffer packen!"
In der Bucht von Kapstadt legt unten an der Bordwand das Gemüse-Boot an. Oben an Deck steht der E.-Ing. Eine stattliche Erscheinung, ordentlicher Anzug, weißes Hemd, Schlips. Seine gesamte mitgeführte Habe hat er aus seinem Schrank und der Backskiste in zwei gewaltige Koffer gestampft.
Gustav, sein Chief, ist noch nicht ganz so weit, er muß noch an den I. Ing. was übergeben.
Ich kann den Ingenieur gerade noch vom hastigen Besteigen der ausgebrachten Jacobsleiter abhalten, auf der er zu den Frischproviant-Lieferanten hinabsteigen möchte.
"E.-Mix." sage ich, "uns fiel auf, du hast einen Nachholebedarf im DIN-gerechten Kofferpacken. Das war eine Übung. Kannst wieder auspacken und dich umziehen!"
Der neueingestellte Ingenieur unterlag dem Trugschluß, wenn er auf den uralt eingetretenen Pfaden, den riesigen schweren Kompaßschlüssel von der Maschine nicht zur Brücke hoch schleppt, weil er diesen Anschiß kennt und auch auf das Pollerrichten und Kompaßkompensieren nicht hereinfällt, kann ihm so gut wie gar nichts mehr passieren.
Aber auch auf hoher See hat der Anschiß variable Erscheinungsformen, besonders wenn man ihn mit aller Macht, so wie er es tat, förmlich heraufbeschwört.
![]() Kleine Knoten sind gefragt
Kleine Knoten sind gefragt
Zwei Maschinenleute bringen nachmittags ihren blutenden Kollegen auf die Brücke. Der Anblick ist erschreckend. Der Maschinen-Assi blutet stark im Gesicht, seine Kombi ist damit total besudelt.
Er ist im Maschinenraum bei Schiffsbewegung beim Transport einer ausgebauten Rohrleitung auf dem Rücken über eine solche auf den Flurplatten geflogen und hat sich die Wange aufgerissen.
Der zweite Offizier Süßmann hat auf der Brücke die Wache und im Bedarfsfall das würdevolle Amt des Schiffsdoktors. Doktor hc. wc. Süßmann besieht sich nun auf der Brückennock den Schaden. "Das müssen wir nähen!" diagnostiziert er und "Felix, komm mit, du kannst die kleinsten Knoten machen!" Kapitän Thomas übernimmt auf der Brücke die Wache. Wir legen den verletzten Maschinen-Assi im Lazarett auf die Lederpritsche.
Der Riß in seiner Wange ist beachtlich, dort pfeift der Wind durch. Sein bartstoppliges verschwitztes Gesicht ist links ganz ölverschmiert, rechts sieht man nur Blut.
Dr. Süßmann sucht im Hospital die Gerätschaft zusammen. Er ist auch mehr auf der Brücke zu Hause und betritt diesen mittelgut sortierten Laden auch nur, wenn einer, so wie ich, ein paar Simagel-Tabletten benötigt.
Ich übernehme derweile die Operationsvorbereitungen und suche in den oberen Hängeschränken nach brauchbaren Reinigungsmitteln, Alkohol, Wundbenzin oder wenigstens Franzbranntwein. Ich treibe nichts dergleichen auf, finde aber eine Flasche Äther. "Das kannste auch nehmen", meint der Doktor.
Ich wasche damit das blutverkrustete Gesicht blut- und fettfrei. Die Bartstoppeln gehen nicht ab. Mit dem äthergetränkten Zellstoffpäckchen verweile ich auch kurzzeitig bei meinen Reinigungsrunden auf der Nase des Verunfallten. "Wenn er dabei evt. abklappt, hat er es leichter" denke ich und tränke das Päckchen noch einmal.
Er klappt nicht ab, aber ich stehe kurz davor.
Entgegen anders lautenden Ratschlägen, beschließt der leitende Arzt, das Loch in der Wange zu nähen, nicht zu klammern.
Diese Entscheidung will ich als Assistenzarzt erklären, Mediziner überlesen diese Passagen bitte!
Hätten wir beide, mit unseren nicht ganz ausgereiften chirurgischen Kenntnissen mit dem Klammeraffen, die beiden auseinanderklaffenden Schwarten nicht sauber und ganz bündig zusammengefügt, wäre dem Patienten sicher ein Leben lang eine häßliche Narbe über die Gesichtshälfte gelaufen. So wie die Mechnik die Klammer reinhaut, so sitzt sie dann auch fest, viel justieren kann man da nachträglich nicht. Markante Narben resultieren in erster Linie daraus, daß sich während des Zusammenwachsens, die eine Schwarte über die andere erhebt.
"Also, wir nähen" beschließt der Chefarzt! "Felix, fädle mal vier Nadeln ein!"
Wir rufen auf der Brücke an, daß der Kapitän jetzt vom Kurs geht und das Schiff so gegen die See hält, daß es die geringste Bewegung macht.
Eigentlich sind meine Hände ja schon von dem Ätherbausch ziemlich sauber, aber ich wasche sie vorsichtshalber noch einmal, alle beide! Dann zwänge ich sie in Gummihandschuhe. Sanitätsrat Dr. Süßmann trägt schließlich auch solche, als er mir das Einweckglas mit dem eingeweckten Nähzwirn und die eingeschweißten Nadeln reicht.
Das Einfädeln der Fadenenden mit Handschuhen und Pinzette klappt nicht. Der Dampfer jumpt auch nach dem Kurswechsel noch.
Scheiß Handschuhe! Ich ziehe sie wieder aus und wasche mir die Hände nun mit Seife und Bürste. Mit der Pinzette bekomme ich den Faden aber dennoch nicht in die kleinen krummen Nadeln gefummelt. Ich haue die Pinzette weg, schneide das mittlerweile schon aufgefranste Fadenende nochmals ab und fädle nun mit der Hand ein. Das Fadenende franst wieder auf, ich lecke es spitz. Jetzt klappt es reibungslos. Das angeleckte Ende schneide ich mit der Schere wieder ab.
Sterilität ist schließlich höchstes Gebot!
Auf diese Weise halte ich dann ratz-batz vier Nadeln auf der Werkbank bereit. Auch Nadelhalter, Zange und Schere.
Der Doktor hat derweilen je eine Ampulle Novocain und Penicillin in einer Spritze aufgezogen. Mit dem Doppelpack beschickt, ist das ein ganz schöner Koventsmann.
Das Novocain in die aufgeschlitzte Wange gestochen, soll den Schmerz durch die späteren Stiche mit der Nähnadel erträglicher gestalten. Allerdings faßt der arme Hund auf der Pritsche rund um seinen Wangenriß auch so ca. acht Stiche mit der fetten Kanüle ab, bis die zwei Ampullen in seiner lädierten bärtigen Wange untergebracht sind. Das zusätzlich injektierte Antibiotika soll einer Wundinfektion vorbeugen. "Süßi" spannt eine Nadel in den Halter und legt los. Er näht von rechts nach links. Als die krumme Nadel in die stopplige Schwarte pickt, bildet sich erst eine Delle, dann dringt die Nadel ein. Sie erscheint in dem klaffenden Spalt und drückt dann gegenüber der Einstichstelle das stoppelige Fell spitz in die Höhe, so ähnlich wie sich ein Zelt aufstellt, wenn die Zeltstange darunter aufgerichtet wird. Dann piekst sich endlich die Nadelspitze durch die Bartstoppeln. "Zieh!" lautet dann das Kommando des Chefarztes. Ich erfasse mit der Zange die gerade herausguckende Nadelspitze und bin darauf bedacht, dem Patienten nicht allzu viele Bartstoppeln beim Anreißen aus dem Gesicht zu zupfen.
Ich mache den Knoten.
Die drei weiteren Stiche gelingen schweigend, wir verstehen uns jetzt als eingespieltes Team blind.
Medizinalrat Süßmann steht äußerst cool über den Dingen, auch der Patient liegt mit einer stoischen Ruhe auf der Pritsche. Der Einzige, den die Angelegenheit hier überhaupt tangiert, bin anscheinend nur ich. Ich knüpfe mit äußerster Mühe den dritten Knoten, wir legen dazu die zusammengezogenen Wundränder schön bündig und parallel, das braucht seine Zeit. Aber wir wollen ja auch keine häßliche Narbe produzieren.
Dann renne ich raus.
Der Äthergestank, mit dem ich eigentlich den Patienten anästhesieren wollte, macht mich jetzt arbeitsunfähig.
In aller Ruhe macht indessen der Chefarzt den vierten Knoten, anstatt sich vorrangig um mich draußen im Fahrtwind zu kümmern.
Aus Gnatz genese ich schnell ohne seine Hilfe.
Die Fadenenden werden dem Patienten mit Nifucin Gel an die Wange gebackt. Er bekommt einen chicen Pflasterverband und Obermedizinalrat Süßmann in Rostock bei der Nachkontrolle des Patienten ein dickes Lob. Es blieb nur eine unscheinbare Narbe.
Später löst mich Funkoffizier Zech für eine Urlaubsvertretung ab. Der lag vorher auch auf so einer Lederpritsche, ich glaube im Lazarett des Typ-IV-Schiffes MS HALLE. Sie wissen doch, die gut beheizten, so wie MS DRESDEN bei meiner Chinareise.
Funkoffizier Zech führt auf der Ostasienreise seine Frau mit. Diese bereitet ihm keine Bauchschmerzen, aber sein Blinddarm. Bei der Hitze an Bord gärt der ziemlich schnell. Das Schiff hat noch einen der letzten Ärzte an Bord, ich meine das keinesfalls auf das Leistungsvermögen bezogen, im Gegenteil!
Das Schiff stampft durch das Rote Meer. Der Kapitän schaut an den Rändern des Gewässers nach, wo Zechi an Land seinen Blinddarm abgeben könnte. Djibouti, Asmara, Aden evt. Der Doktor und der Kapitän räumen dem Mann dort nur geringfügige Überlebenschancen ein. Obwohl ich die Bedenken auf den nächsten Seiten zerstreuen könnte.
Der Doktor faßt den kühnen Entschluß: Dann mache ich das selbst! Mir ringt nach der Schilderung meines Berufskollegen die Courage dieses Schiffsarztes allerhöchste Bewunderung ab. Im Roten Meer steht eine unwahrscheinliche Bramming. Das Typ-IV-Schiff hat keine Klimaanlage und an der Decke der schlichten Lazarett-Kemenate strahlt, am Lichtbedarf eines Operateurs gemessen, eine mickrige Funzel.
Kein Schwanz an Bord hat je in einem OP mal Staub gewischt, wie dann erst noch einem Chirurgen assistiert.
Frau Zech wird in einem Crash-Kurs zur Anästhesistin ausgebildet, der II.Offizier hat es leichter, er muß auf die Schnelle nur OP-Schwester lernen.
Der Bootsmann richtet aus seiner Laderaumbeleuchtung einen Sonnenbrenner her. Das ist ein großer blechener Lampenschirm mit sechs Glühlampenfassungen bestückt.
Ein Drahtgitter schützt die 6 Leuchtmittel vor Beschädigung. 6 mal 100 Watt ergeben schon ein brauchbares Licht, aber ca. 6 mal 95 Prozent der eingesetzten Energie werden als Wärme abgestrahlt.
Warm ist es in dem Feldlazarett ohnehin schon. Die Brücke wählt einen Kurs, bei dem das Schiff die geringsten Bewegungen macht, damit der Doktor mit dem Skalpell auch trifft.
Die Hilfs-Anästhesistin verpaßt ihrem Gatten eine Dröhnung, OP-Schwester Klaus-Bärbel reicht dem Doktor das Skalpell. Der hat damit den Weg zu dem muckernden Appendix gerade freigelegt, da platzt direkt über diesem, wegen der bärischen Hitze, eine von den sechs NARVA-Glühlampen.
Bisher hat der Doktor die gewiß nicht einfache Situation im Griff. Aber jetzt wird es ernst. Die Glühlampe ist pulverisiert auseinander geflogen. Die Glassplitter in dem geöffneten Mann dürfen in diesem nicht verbleiben.
Frau Zech verpaßt am oberen Ende des Patienten ihrem Gatterich eine weitere Dröhnung, damit der Doktor Zeit hat, ganz intensiv und gewissenhaft, nach evt. doch noch verkrümelten Glassplittern zu suchen. Dabei droht ständig die Gefahr, daß bei der Hitze noch eine der verbliebenen Glühlampen explodiert.
Dieser damalige Patient löst mich jetzt auf dem Schiff ab, er ist gut drauf und offensichtlich glasfrei.
Die langen Tankerreisen bieten ausreichend Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren. Auf einem Schiff kann man auch nach der Schicht seinen Arbeitskollegen nicht total aus dem Weg gehen. Auch an Wochenenden und Feiertagen hockt das "Arbeitskollektiv" ziemlich dicht aufeinander. An Land klebt einem der unangenehmen Arbeitskollege oder Vorgesetzte wenigstens von Freitagabend bis Montagfrüh nicht wie Rotz am Ärmel. Auf See hockt man auf dichtem Raum zusammen und erzählt sich etwas. Aus den Erzählungen der Kollegen lernt man die Welt kennen, auch wenn man in dem Landstrich noch nicht gewesen ist. Da jeder langbefahrene Seemann auch etliches zu erzählen hat, lohnt sich auch das Zuhören.
Der I. Ing. Ulli Stier fügt dem Sachgebiet Blinddärme eine weitere Karteikarte hinzu:
"Ich habe bei der Entfernung meines Blinddarms zugucken dürfen! "
Das gibt es doch nicht, wie das denn?!
Sein Fruchtschiff holt am Horn von Afrika Früchte. In einem no-name Reede-Hafen in der Gegend von Mugdisho.
An dieser Küste von Somalia muckert sein Blinddarm.
Das ist natürlich die aller ungünstigste Ecke der Welt, seinen Blinddarm zu nehmen. Das macht man in der Nähe von Kapstadt, von den Azoren habe ich da auch nur Löbliches gehört und auf Hawai ist es auch einem DSR-Seemann geglückt.
Ulli Stier, der arme Hund und sein Blinddarm, werden an Land zu einem sowjetischen Med-Punkt gebracht. Dort praktiziert ein russischer Doktor.
Eine Morphium-Spritze oder so etwas ähnliches bekommt der Patient, ansonsten noch ein Beißholz zwischen die Zähne. Ulli schildert uns sein Erlebnis: "Ein paar kräftige Berber aus dem Dorf haben mich festgehalten, ich habe gejodelt was das Zeug hergab, aber ansonsten war alles roger"!
Ich habe auf See während meiner Tätigkeit zu duzenden Blinddärmen telefonisch über Rügen Radio, oft unter schwierigsten Verständigungsproblemen, den ärztlichen Rat eingeholt. Es läuft logischerweise immer auf das Gleiche hinaus, kühlen bis der Unterleib zersplittert und das muckernde Ding bei der nächsten Gelegenheit irgendwo anlanden. Es hat immer geklappt, keiner dieser überflüssigen Wurmfortsätze ist perforiert.
Den weiblichen Besatzungsmitgliedern den Unterleib so extrem zu vereisen, ist aus Sicht der Professoren der Rostocker Uni-Klinik allerdings problematisch. Nach längeren Kühlperioden steht nach ärztlichen Bedenken die Betroffene vor der Alternative, Kinderwunsch oder perforierter Blinddarm.
Sämtliche Blinddärme haben wir über die Runden gebracht, inwieweit die gekühlten Eierstöcke in ihrer Gene die Veranlagung zur Appendix-Entzündung weitergegeben haben, das entzieht sich meiner Kenntnis..
Die kleinen Kaulquappen, zur männlichen Fortpflanzung, sind nachweislich unwahrscheinlich frostresistent.
Auch Radarstrahlen aus nächster Nähe können die Biester ab, das kann ich bezeugen!
![]() 51 Klimmzüge - und kein Ende
51 Klimmzüge - und kein Ende
Ich mache auf dem langen Seetörn mit Chief Gustav Michalzik ein Schwätzchen und erzähle ihm von dem Schildbürgerstreich der Heinzis in Novorossisk, wo sie uns wegen des übrigen Kalksteins im Mäntelchen des Gangway-Postens erst verspätet auslaufen ließen.
Gustav ist Ostexperte.
Er war bei der NVA auf einem Küstenschutzschiff Turbinen-Maat. Die Kampfbleche der Seekriegsflotte sind alle sowjetischer Herkunft, zur Instandsetzung müssen sie demzufolge von Zeit zu Zeit in eine Werft des Herkunftslandes.
Gustav erzählt:
"Wir fahren zur "generalny remont" in die Werft nach Kronstadt. Es ist Frühling. Die Russen schrauben und montieren gelegentlich an dem Schiff, es wird Sommer, Herbst und Winter. Zum Schutze der Errungenschaften der Deutschen Demokratischen Republik fehlt unsere Kampfkraft ein volles Jahr auf der Ostsee. Die Insel Kronstadt dürfen wir nicht verlassen. Das dürfen nicht einmal die zivilen Inselbewohner.
Das Sagen hat hier der militärische Inselkommandant. Er ist der unumschränkte Herrscher über jegliches lebende und tote Kapital auf der Festungsinsel. Wenn ein Einwohner Kronstadts z. B. in Leningrad im Univermag ein paar warme Strümpfe kaufen möchte, benötigt er zum Verlassen der Insel die schriftliche Genehmigung des Inselkommandanten. Die bekommt er nur, wenn er sich immer artig benommen hat, nicht betrunken oder propagandistisch negativ aufgefallen ist.
Wir liegen an der Pier längsseits eines sowjetischen Kriegers. Jeden Morgen um sechs ist sowohl bei uns, als auch bei den Heinzis lautes wecken. Danach stürzen die wackeren Krieger der sowjetischen Rotbanner-Flotte aus den Unterkünften und beginnen ganz verbissen an Oberdeck mit frühsportlichen Leibesübungen. Ein jeder ist ein Leistungssportler und hat schwer was auf der Spule. Unsere Truppenteile kriechen schlaftrunken und lustlos aus ihrer Butze und hängen nach eineinhalb Klimmzügen schon abgeschlafft an den Segellatten.
Darüber können die Rotbanner-Kämpfer nur mitleidig lächeln, während die gesamte Riege gerade den 65sten Liegestütz an Deck absolviert".
"Morgen scheiße ich die Russen an!" beschließt Ari-Maat Mutschmann. Der Maat kommt aus dem Drei-Länder-Eck im Süden der Republik und rollt ganz mächtig das "R", so wie es seinen Landsleuten in der schluchtigen Gegend eigen ist.
Der Gefechtsstand des Schiffes ist von einer Reling umgeben und mit Segellatten überdacht. Das ist ein Rohrgerüst, um darauf evt. eine Persenning zwecks Überdachung zu spannen. Die Reling ist mit einer solchen bespannt, so daß man einen Mann erst ab der Gürtellinie auf dem Podest stehend sieht. Dort hinauf schleppen der Ari-Maat mit seinem Kumpel spätabends eine Gasflasche und eine dicke Bohle.
Die Holzbohle wird über die Gasflasche gelegt, man könnte denken die beiden Transportarbeiter bauen sich eine Wippe.
Am nächsten Morgen toben die Rotbanner-Matrosen wieder an Deck und legen los. Dann aber unterbricht die Truppe ihr Trainingsprogramm.
Die Germanskis nebenan erregen ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Gefechtsstand macht Ari-Maat Mutschmann an einer Segellatte schon den 36sten Klimmzug.
Unten auf dem Hauptdeck zählt die ganze Truppe laut mit: 37, 38, 39..... 44, 45, beim 46sten Klimmzug läßt Mutschi eine Hand los und macht die nächsten 5 Klimmzüge locker mit einem Arm weiter.
Das ringt den Durchtrainierten von nebenan höchste Verwunderung ab.
Der einzige, der sich bei dieser Leistungsschau etwas ertüchtigen muß, ist Mutschis Kumpel, der hinter der Persenning geduckt, heftig am längeren Ende der Wippe auf die Bohle drücken muß, damit Mutschi mit spielender Leichtigkeit ins Guinness-Buch für Klimmzugrekorde kommen kann
![]() Reise mit Hindernissen
Reise mit Hindernissen
Anfang August hat die Reederei den 84-Tausend-Tonnen-Tanker ATLANTIC MARCHIONESS von einer Griechischen Reederei erworben. Der große Brummer liegt in Lissabon zur Übernahme bereit.
Hagen Uloth ist längst Kapitän und von der Reederei für die Übernahme des neuen Flaggschiffs der DDR-Tankerflotte auserwählt.
Ich gehöre zu seiner handverlesenen Truppe.
Als leitenden Technischen hat sich Hagen Uloth Gustav Michalzik an seine Seite gestellt.
Wir alle passen gut zusammen!
Gemäß einer Dienstanweisung haben wir Seeleute weitgehendst bei unseren Dienstreisen die Angebote des DDR-Flugwesens INTERFLUG zu nutzen.
Die DDR ist weltweit, außerhalb ihrer Bruderländer, diplomatisch nicht anerkannt. An den Grenzübergängen der DDR wird penibelst kontrolliert. Ich habe kein Land in der Welt kennen gelernt, was sich in Sachen Grenz-, Paß- und Gepäckkontrollen engärschiger anstellt, als "De De Er! Unser Vaterland!" Von Jahr zu Jahr wird der Kult, der an der Landesgrenze diesbezüglich getrieben wird, immer schikanöser.
Meine Westverwandtschaft wird mir jetzt beifällig auf die Schultern klopfen, aber mir nicht glauben, daß die Kontrollen, die sie zwei, drei Mal erniedrigend über sich ergehen lassen mußten, ich ständig, regelmäßig beim Anlaufen meines Heimathafens genossen habe, als Bürger dieses Arbeiter- und Bauernstaates.
Diesen Kult zu beschreiben, der hier getrieben wird, würde ein weiteres Buch füllen.
Ich versuche mich in einer Kurzfassung:
Beim Auslaufen aus dem DDR-Hafen wird der Dampfer gründlichst nach evt. Republikflüchtigen durchsucht. An Oberdeck und in den Lasten geschieht das mit Schnüffelhunden. Die Besatzung wird dazu in die Messe getrieben. Gegen Ende der 70iger Jahre gipfelt dieser Kult darin, daß der Leitende Ingenieur gezwungen wird, auf dem an der Pier liegenden Schiff die Maschine kurzzeitig anzulassen. Sollte sich im Kurbelgehäuse ein Überschmuggler verkrochen haben, verläßt er das Arbeiter- und Bauernparadies nur als Goulasch. Nur ein toter Republikflüchtiger ist auch ein guter, die abgewandelte Praxis der Hasenjagd an der westlichen Landgrenze.
Von der Besatzung ist eine riesige, mehrspaltige Geld- und Wertsachenliste auszufüllen. Bei 40 Besatzungsmitgliedern hat diese Liste 40 horizontale Spalten. In den vertikalen Spalten muß nun Furz und Feuerstein eingetragen werden, für den sich generell nur der DDR-Zoll interessiert und sonst absolut niemand auf der Welt. Die mitgeführten Zahlungsmittel in Monopoly-Geld und in wertvollen Valuta sowieso.
Auch Tonbandkassetten! Kann man sich so etwas vorstellen?
Fotoapparate, Ferngläser, Schmuck, eben Jegliches, was in diesem Land als Wertstück angesehen wird.
Beim Heimkehren muß der Fotoapparat, das Fernglas und der Ring aus 333-iger Gold wieder verfügbar sein. Natürlich auch die wertvollen Valuta! Die Einfuhr von "Tonträgern" also Tonbandkassetten ist nicht statthaft. Da spricht erfahrungsgemäß der Klassenfeind seine Anweisungen für die Agenten drauf, die mit ihrer Schweineschnauze im blühenden Garten des Sozialismus herumwühlen. Eine Schallplatte einzuführen ist eigentlich, na ja, so generell nicht verboten. Aber da Heino vor kurzem "Schwarz-braun ist die Haselnuß" gesungen hat, was die Nazis auch schon sangen, wird die gesamte LP konfisziert! Die Gruppe "Kiss" bemalte sich mit fetischistischen Zeichen, die man als SS-Runen ansehen könnte. Ein "Kiss"-Titel auf einer LP - und auch die wird konfisziert. In der Nachbarkammer hängt ein Kalender an der Wand von Coca-Cola, mit einem barbusigen Girl. Na ja, da weiß der kontrollierende Genosse Zollunterassistent nicht so recht bescheid, er holt den Kommandoführer und der den Kalender von der Wand.
Auch eine Wasserpistole, mit einem anderen Hoheitszeichen als dem Sowjetstern, gefährdet den Sozialismus und wird beschlagnahmt.
Sämtliche Druckerzeugnisse des Klassenfeindes sind von vornherein schon Schund- und Schmutzliteratur, egal was drin steht.
Ich führe von Mombasa zwei Massai-Spieße ein. Die üblichen Touristenartikel, zweiteilig, mit Bambus-Mittelstück, damit sie zerlegt auch in den Koffer passen.
Laut DDR-Zoll habe ich jetzt Waffen eingeführt.....
Ich könnte hier ins Plaudern geraten. Kurz und gut, die DDR legt äußerst gesteigerten Wert auf Korrektheit und saubere Papiere. Stellt aber für ihre Ausreisenden solche nicht aus. Weil sie es eigenverantwortlich nicht kann und ihren Holzkopf mit Stolz trägt.
Um als DDR-Mensch die Länder des Klassenfeindes bereisen zu können, bedürfte das vorerst des "Travel boards". Dieses Papier stellt in Westberlin das "Allied Travel Office", als Behörde der westlichen Siegermächte für reisewillige souveräne DDR-Bürger aus. Das sehe ich allerdings auch als eine nicht zumutbare Anmaßung der westlichen Alliierten an.
Die souveräne Deutsche Demokratische Republik lehnt eine solche Diskriminierung natürlich ab, kontrolliert im Gegenzug an ihren Grenzen penibelst alle Paß- und sonstigen Dokumente und schickt ihre eigenen Bürger maximal mit einem Dienstauftrag des zuständigen Betriebsdirektors, LPG-Vorsitzenden oder wie mich, mit dem des Generaldirektors des VEB Deutsche Seereederei los.
Das durfte ich sehr oft genießen.
Dafür nun dieses Beispiel:
Kapitän Hagen Uloth und seine Truppe entsteigen in Mailand der Interflug-Maschine und kommen im Abfertigungsgebäude noch nicht einmal in den Transitraum.
"Dort steht ihre Maschine, in die steigen sie ein und fliegen damit zurück!" bedeutet uns die Paßkontrolle des Mailänder Airports. Kein Mann hat ein verwertbares Visum.
Wir hocken endlos herum. Der E.-Ing gibt eine Runde Pfeffis aus mit der Bemerkung: "Hier, nimm, du hast's notwendig: Die Pille für den Mann, 24 Stunden danach!" Drei Mann grinsen, der vierte macht Protest, nachdem er mächtig überlegt hat und kommt zu dem tiefsinnigen Schluß, daß das irgendwie nicht funktionieren kann.
Nach einer atemberaubenden Odyssee erreichen wir dennoch Lissabon.
![]() ATLANTIC MARCHIONESS, die verkeimte Hoheit.
ATLANTIC MARCHIONESS, die verkeimte Hoheit.
Der griechische Tanker liegt auf dem Tejo. Es scheint, daß man ihm von der "Brücke des 25. April" dem beeindruckenden Bauwerk, das den Fluß überspannt, an Deck spucken könnte.
Wir entern das Schiff von der uns übersetzenden Barkasse.
Das Schiff soll in der Lisnave-Werft auf unsere Bedürfnisse umgerüstet werden.
Wir beschauen uns das neu erworbene Flaggschiff. Das Schiff machte von weitem besehen einen sehr gepflegten Eindruck. Es steht gut in Farbe. Was im Innenbereich allerdings uns jetzt entgegenschlägt, will ich nur oberflächlich schildern, tiefgründiger glaubt mir das niemand.
Der Tanker legt zur Mittagszeit in der Lisnave-Werft an. Der griechische Koch rennt aus der Kombüse zu seiner nahegelegenen Winde auf dem Achterschiff und in jeder entbehrlichen Sekunde kehrt er an sein eigentliches Betätigungsfeld zurück und schaut in Töpfen und Pfannen nach dem Rechten und Linken.
 Wir sind zum Mittagessen eingeladen. Es gibt Hühnchen. Broiler sagen wir. Wirklich gut, nur der Blick hinter die Kulissen ist fatal.
Wir sind zum Mittagessen eingeladen. Es gibt Hühnchen. Broiler sagen wir. Wirklich gut, nur der Blick hinter die Kulissen ist fatal.
Der Fußbodenbelag der Kombüse ist nicht zu identifizieren, wahrscheinlich Fliesen. Das muß man später ergründen. Über dem Herd ist ein riesiger Rauchabzug, in der Art einer Dorfschmiede. Aus dem mit einer drei Zentimeter-Dickschicht konserviertem Blech tropft es unablässig ölig herab.
Ich besehe mir den Funkraum. Die Technik ist nicht so berauschend. Mein Vorgänger ist nicht verfügbar.
Er würde wegen einer Krankheit hier in einem Lissaboner Krankenhaus stationär behandelt, erfahre ich hinten herum.
In meiner Kammer ist der Boden mit Haaren bedeckt, wie in einem Frisörsalon. So eine Unterkunft habe ich nach 15 Jahren Seefahrt noch auf keinem Schiff angetroffen. Meine Kammer verfügt über eine Naßzelle. Auch hier ist der Bodenbelag nicht zu erkennen. Die rosa angestrichenen Blechwände sind veralgt.
Die Farbe des Duschvorhangs ist nur oben an den Ringen noch schwach auszumachen. Darunter wuchern Schimmel und Algen.
Das Schiff ist völlig ausgebombt. Es gibt auch nicht das Stäubchen eines Reinigungsmittels oder gar einen Schrubber oder Besen.
Unten im Mannschaftsdeck herrschen noch unbeschreiblichere Zustände.
Die Wände der Unterkünfte sind nicht verkleidet. Der Matrose schläft praktisch an der Außenhaut des Schiffes, ihn trennen zwanzig Millimeter Schiffbaustahl vom Seewasser. An der Decke verlaufen die Rohrleitungen, so wie im Maschinenraum. Unsere Jungs halten mit zwei Fingern am ausgestreckten Arm die Schaumgummimatratzen weit von sich, mit der Frage: "Soll ich mich da etwa draufhauen?"
Die Matratzen wurden als so eine Art Gummifrau mißbraucht.
Der milliardenschwere griechische Reeder hat für die Leute, die seinen Reichtum herankarren und ständig mehren, nicht einmal ein paar Spanplatten übrig, um aus gräßlichen Tierbehausungen einigermaßen Bewohnbares zu gestalten.
Die 23 mitgereisten Reederei-Honoratioren sind natürlich auch darauf bedacht, bei der Indienststellung des neuen Flaggschiffes der DDR-Handelsflotte wertvolle Valuta einzusparen. Nach deren anfänglichen Vorstellungen würde es genügen, im Mittelgang eine Wandzeitung aufzuhängen, an Bord die Parteigruppe zu formieren, eine arbeitsfähige Partei, Gewerkschafts- und FDJ-Leitung zu bilden und los geht's, für unsere gemeinsame sozialistische Sache! Das Reservistenkollektiv, die Küchenkommission, die DSF-Gruppe, das Parteilehrjahr und die Schule der sozialistischen Arbeit organisiert der Politoffizier umgehend nach dem Verlassen der Werft! Vorerst müssen natürlich noch die Dokumente des 10. Parteitages an Bord geliefert werden, na ja und Brennstoff, Ausrüstung und Proviant natürlich auch.
Hagen Uloth, unser Kapitän hat Rückgrat und setzt es auch ein. Geschlossener Rückzug wieder in die Hotels! Das Schiff ist so nicht zu besetzen! Das sehen jetzt auch die auf Einsparung programmierten Reederei-Ökonomen notgedrungen ein.
In der Werft werden als erstes nun die Unterkünfte der Mannschaft bewohnbar gemacht.
So wie an Bord die Kammern nach und nach beziehbar werden, zieht der Seemann aus dem Hotel aus. Mr. Castro, unser Makler erzählt mir beiläufig, als ich auf meinen verkeimten Frisörsalon zu sprechen komme: Der griechische radio officer wäre bei Einlaufen des Schiffes mit Typhusverdacht in ein Krankenhaus gebracht worden. Schon an Bord, hätte man ihm daher die obligatorische Glatze verpaßt. Deshalb fanden sich so viele Borsten in meiner Kemenate.
Ich frage meinen Kapitän, wie lange denn die Inkubationszeit für den Ausbruch von Typhus wäre. Er beauftragt den II. Offizier mit der Ergründung dieses medizinischen Problems. Nach "Eckis" wissenschaftlichen Erhebungen müßte der Typhus nach zwei oder drei Wochen bei mir ausbrechen.
Ich schlage wenigstens das Auswechseln der griechischen Matratze vor und die kammerjägermäßige Entkeimung meiner Unterkunft. Das lehnen die Reederei-Gewaltigen aus Kostengründen ab. Ich koche innerlich, das tötete wahrscheinlich die Typhus-Erreger ab.
Im Funkraum liegt und steht alles so, wie das Schiff eingelaufen ist. Das Ladegerät für die Funknotbatterien steht auf 10 Ampere-Ladestrom. Ich schalte es ab. Nach zwei Stunden sind von den 24 Volt noch 2 Volt in den Batterien. D. h. wären dem Tanker nach einer Kollision, Havarie, Grundberührung o.ä. im Maschinenraum die Jockel (Generatoren) abgesoffen, hätte der Batterienotstrom für nicht einen einzigen Pieps gereicht, mit dem das Schiff funktechnisch um Hilfe bitten konnte.
Ich ergründe die Schwachbrüstigkeit der Ni-Ca-Batterien. Sie wurden anscheinend mit Leitungswasser aufgefüllt. Nach Elektrolytenwechsel halten sie wieder ihre Kapazität.
In der Alarmglocke des Autoalarmgerätes klemmt eine zusammengedrehte Pall-Mall-Schachtel. Als ich sie entferne und das Gerät einschalte, läutet es dauernd ohne ein Alarmzeichen zu empfangen. Das Gerät ist defekt.
Bei diesem griechischen Schiff hätten in Seenot geratene Kollegen außerhalb der Funkwache vergeblich per SOS um Hilfe ersucht.
Die Rettungs- und Sicherheitsmittel werden auf dem Tanker auf unseren Standard umgestellt. Das betrifft u. a. die Rettungsflöße, Feuerlöscher, Sauerstoffgeräte usw.
Auf der Back des Tankers lagert ein ganz kleines Rettungsfloß, verpackt in den üblichen Halbschalen. Das Ende der Reißleine ist an der Reling befestigt. Im Bedarfsfall wird das Gebilde, in Form einer Regentonne, außenbords geworfen. Vom Schiff aus muß dann durch den Zug auf der Reißleine eine im Floß befindliche Druckluftflasche aktiviert werden, die das Floß aufbläst. Die beiden "Faßreifen" werden gesprengt, die Halbschalen fallen auseinander und das Gummifloß mit Dach entfaltet sich wie ein "Iglu-Zelt".
Neben den beiden großen griechischen Flößen kommt auch das kleine Sechs-Mann-Floß in den Schrottcontainer. Ich nehme das kleine handliche Rettungsfloß mit nach Hause.
In Schwaan an der Warnow mache ich im Sandgarten damit eine Kinderveranstaltung. Mein Bengel ist schon ganz erpicht auf die Signalmunition, die wir dann Silvester verballern könnten. Angelhaken und Taschenmesser müßten ja auch in der Ausrüstung sein.
Die Kinder ziehen an der Reißleine, als sie am letzten Ende kräftig anreißen, ertönt im Inneren des Floßes ein ganz leiser Pups.
Das war es dann.
Ich hole die Werkzeugtasche und durchtrenne gewaltsam die festgegammelten Banderolen, die eigentlich durch den Innendruck brechen sollten. Als ich die beiden Halbschalen auseinanderbreche, kommen den erwartungsvollen Zuschauern drei Eimer Wasser entgegen.
Die Gummihaut des Floßes ist als solche nicht zu erkennen, das Material ist total verfärbt und porös. Das Päckchen mit den Ausrüstungsgegenständen ist nur ein Klumpen, Angelhaken und Messer ein Rostbatzen. Die Druckluftflasche ist gerade noch als solche zu identifizieren. Das einzige noch funktionstüchtige Teil ist die Gummi-Schildkröte zum manuellen Nachpumpen der Luftkammern. Porös ist deren Gummi aber auch schon.
Es ist unfaßbar!
Mit solchen Rettungsmitteln fahren bedauernswerte Seeleute zur See, deren Reeder den Frachterlös nicht durch die unnötigen Ausgaben für Rettungsmittel schmälern möchten.
Schiffe müssen, genau wie Autos, regelmäßig zum TÜV. Aber mit einem Heimathafen Monrovia am Heck, findet sich dort wohl ständig eine Klassifikationsgesellschaft, die den TÜV-Schein unten an der Pier ausstellt, ohne das Schiff jemals betreten zu haben.
Die Maschinenanlage, die Pumpen, überhaupt die Technik, die das Geld auf einem Tanker verdienen muß, funktioniert. Für das übrige schmückende Beiwerk wurde beim Bau des Schiffes kein einziger Cent investiert.
Das Schiff hat nur einen achterlichen Aufbau. Das ist ein enger Turm. Es herrscht Platzmangel.
Meine Funktechnik taugt nichts. Ich ärgere mich damit maßlos herum.
Das machen wir alle auf dem Schiff. Die Truppe allerdings, die das Betriebsklima ausmacht, ist eine verschworene Gemeinschaft. Wir überstehen das Jahr unter diesen miesen Bedingungen. Danach geht das Schiff wieder nach Lissabon in die Werft.
![]() Kaschuben, Masuren und andere herrliche Menschen
Kaschuben, Masuren und andere herrliche Menschen
Der Tanker hat jetzt ein Jahr lang Geld verdient und anders wie der geizknochige griechische Erstbesitzer, investiert die Reederei einen Teil davon, um menschenwürdige Bedingungen an Bord zu schaffen.
Herr Kossak ist Bauleiter der Lisnave-Werft. Er gehört einem sehr bemerkenswerten Volksstamm an, er ist Kaschube und stolz darauf!
Gustav, unser Chief gehörte früher in der Gegend zu dessen kriegerisch-verfeindeten Nachbarstamm, er ist: Masure!
Kossak und Michalzik verteidigen täglich auf's Neue gegeneinander ihre ethnischen Vorzüge.
Der Kaschube belegt den Masuren: "Ihr könnt doch nur Schlittschuhlaufen und Bären fangen. Was machst du denn auf so einem Schiff?"
Die Zusammenarbeit mit der Werft funktioniert hervorragend, vorausgesetzt der Masure hält gegenüber dem Kaschuben die Hackordnung ein. An Deck wird ein sieben Meter langes Badebecken installiert. An dem engen schmalen Brückenturm baut die Werft beidseitig zwei lange Räume an. Einer wird Sportraum, der andere Gemeinschaftsraum mit Bar-Charakter.
Jetzt kann man auf den langen Reisen Tischtennis spielen und in gepflegter Atmosphäre in einem Klubsessel sitzen und Stereomusik hören.
Ich bekomme moderne, zeitgemäße Funktechnik. Dafür muß in Eigenleistung auf dem Mastknopf die Konsole aufgeschweißt werden, um darauf eine Glasfiberstabantennen montieren zu können.
Die Schweißarbeiten werden dem Storekeeper zugemutet.
Der Tanker liegt im Dock, also hoch heraus. Der Mast ist auch recht hoch.
Unter uns liegt Lissabon, dem gegenüber steht auf dem Hügel der Jesus. So ein Modell wie in Rio und auch in Havanna. Die Stadt am Tejo bietet einen imposanten Anblick mit der längsten Hängebrücke Europas und dem steinernen Schiff, daß in den Fluß hineinragt und als monumentales Denkmal an Heinrich den Seefahrer erinnert. Auch der Turm von Belem hat neben dem Kloster in der Unterstadt alle Erdbeben überlebt. Lissabon ist eine
wunderschöne Stadt !
Um solche Arbeiten auf dem obersten Ende des Schiffes zu verrichten, muß der Mast eingerüstet werden oder von einer gelb-schwarz markierten Krankiepe heraus gearbeitet werden. Wegen der Kosten in wertvollen Valuta, verzichten wir auf beides und besinnen uns auf die von unseren Vorfahren ererbten Kletterkünste.
Es ist warmer Sommer. Ich trage Arbeitskombi, Helm, Sicherheitsgurt, Nylonsocken und ...Sandalen.
Ca. einen Meter unter dem Mastknopf ist die Leiter zu Ende. Die letzte Sprosse belegt der 'Stori' mit seiner E-Schweißtechnik. Ca. einen halben Meter unter dem Mastknopf ist die vordere Top-Laterne angebracht. Diese ist überdacht. Das Blechdach ist so groß wie der Deckel eines Schuhkartons. Es passen genau meine zwei Sandalen der Schuhgröße 40 darauf. Das Dach trägt mich.
Meinen Sicherheitsgurt klinke ich unter mir in die letzte Leiternsprosse ein.
Der Standort hoch droben ist gewöhnungsbedürftig. Der herrliche Ausblick erleichtert das Eingewöhnen.
Der Mastknopf hat ungefähr die Größe und Form eines kleinen runden Brotes.
Er ist aus verzinktem Blech gefertigt, damit er von der vielen Möwenkacke nicht verrostet. Der Stori hängt sich nun vertrauensvoll in seinen Sicherheitsgurt. Das ist kein griechisches Fabrikat. Er muß zum Schweißen beide Hände frei haben.
Nun klappt er auch noch die dunkle Schweißerhaube über die Augen. Ich halte ihn fürs Erste an den Schultern. Sich rücklings volle Kanne in den Sicherheitsgurt zu hängen und dabei auch noch die Augen verdunkeln, das ist in so einer luftigen Höhe nicht jedermanns Ding.
Ich richte das Werkstück auf dem Knopf aus. Der Storekeeper sucht mit der Elektrode Kontakt, das Zink leuchtet grün auf und weiße Flöckchen flattern davon.
Er brutzelt los. Da er rundherum schweißen muß, sind ihm meine Arme im Weg. Irgendwo möchte ich aber auch wenigstens so tun, als ob ich mich festhalte. Der Mastknopf wird aber zunehmend warm. Ich überrage das Schiff um einen Meter, der Mast geht mir nur bis zum Knie. Da fällt ein grünlich brutzelnder Schweißtropfen vom Rand des Mastknopfes herab und durch die Nylonsocken in die Kuhle zwischen dem kleinen und dem Nachbarzeh. Unter normalen Werkstattbedingungen dreht man nun ein bis zwei Runden um die Werkbank, kippt sich Bohrmilch über den glösternden Huf oder pinkelt drauf. Ich stehe in stoischer Ruhe über den Dingen auf meinem winzigen Tritt und schaue zu, wie die Griebe aus Zink, Schlacke, Nylonsocke und Schweißfuß so allmählich ihre Tätigkeit einstellt und zur Ruhe kommt. Die Brandwunde hatte ich sehr lange.
Die Narbe erinnert mich heute noch an den schönen Rundblick über Lissabon.
Portugal bietet bemerkenswerte lukullische Genüsse in urigen Kneipen.
In eine solche lockt uns ein riesiges Aquarium.
Darin trampeln die seltsamsten Unterwasserbewohner aufeinander herum. Ein riesiges Spinnentier erregt unsere Aufmerksamkeit. "Den verspeisen wir!" beschließt Hagen.
Die langen Spinnenglieder passen nicht in den riesigen Topf mit kochendem Wasser. Bei der Zubereitung kann der Gast zusehen. Die Kombüse ist der Mittelpunkt der rustikalen Gaststätte. An der großflächigen kupfernen Abzugshaube hängen Knoblauchzöpfe und Schinken.
Der Ober schleppt, an seine Lederschürze gedrückt, einen steinernen Amboß auf unseren Tisch. Wir bekommen jeder einen Hammer und dann das beeindruckende gekochte Monster. Diesem entnimmt nun jeder ein Karosserieteil, plaziert es auf dem Amboß, um mit dem Hammer verbissen darauf herumzudreschen. Auf diese Weise kommt man an das angeblich genußfähige Innenleben des Ungeheuers. Bei diesen Kunstschmiedearbeiten fliegen etliche Karosserieteile von dem Krustentier in der Gegend herum und bis zur Decke. Aber die Gäste um uns herum sind sehr freundlich und uns wohlgesonnen.
![]() Zu Gast bei Allah und Cheops
Zu Gast bei Allah und Cheops
Nach der Werfterneuerung fahren wir auf einem ordentlichen Schiff, dem schönsten und größten der Deutschen Seereederei.
Nun öffnet auch der Suezkanal wieder. Aber voll abgeladen paßt MT HEINERSDORF dort nicht hindurch. Deshalb stand das Schiff wohl kurz vor der Eröffnung des Suez auch für 24 Millionen Dollar zum Verkauf.
Heimreisend muckert im Roten Meer im großen Sulzer-Diesel ein Kolben. Der beeinträchtigt das Vorwärtskommen des Schiffes.
Gustav meint, der müsse bis nach Hause gezogen werden. Im tropisch heißen Maschinenraum einen Kolben von der Größe einer Zweihundert-Liter-Regentonne aus dem Motorblock zu ziehen, ist für die dafür abkommandierte Truppe kein Sonntagsvergnügen. Gustav beschließt, diese Arbeiten auf Reede von Suez zu verrichten. Er führt auf dieser Reise seine Gemahlin am Mann, die liebe Irmgard. Meine Frau ist für diese Reise auch an Bord.
Nicht all zu weit von Suez stehen die Pyramiden bei Gizeh am Wüstenrand. Gustav zieht eigenhändig mit ein paar Leuten den Kolben. Neben meinem Weib nehme ich die liebe Irmgard unter meine Fittiche.
Wir fahren zu den Pyramiden und nach Kairo.
 Ich bewundere diese Stätten nun zum zweiten Mal und kann nun auf das achten, was mir beim ersten Mal entgangen ist. Für unsere Ehefrauen ist das ein einmaliges Erlebnis.
Ich bewundere diese Stätten nun zum zweiten Mal und kann nun auf das achten, was mir beim ersten Mal entgangen ist. Für unsere Ehefrauen ist das ein einmaliges Erlebnis.
Wir besuchen den alten Herrn Cheops in seiner Grabkammer. Aber er ist dort nicht mehr
zugegen. Sein Quartier liegt genau in der geometrischen Mitte seiner nach ihm benannten, monströsen 139 Meter hohen Pyramide. Zu der Grabkammer führt ein niedriger Gang hinauf.
Um die Steigung leichter zu bewältigen, sind auf die Bodenbretter Querleisten genagelt. Die Hühnerleiter bietet nun auch den eleganteren Damenschuhen den notwendigen Grip, um die Steigung zu bewältigen.
Die formierte Besuchergruppe drängt in das Loch der Pyramide. Nach wenigen geraden Metern geht es auf dem Brettersteg aufwärts. Leider haben die Pyramidenbauer dem Gang nur eine lichte Höhe von ca. 1,20 Meter gelassen.
Das ist viel zu niedrig, um wenigstens einigermaßen würdevoll gebückt hinauf zu schreiten. Aber doch zu hoch, um sich die Blöße zu geben, gleich auf allen Vieren hinaufzukriechen.
Ali Ben Beischlaf, der Hausmeister der Cheops-Pyramide, rafft sein Nachthemd an, bückt sich zur Seite und hüpft ziemlich leichtfüßig den Steg hinauf. Und das sicher X-Mal am Tag. Die touristische Masse versucht ihm zu folgen, nur meine Frau nicht. Sie dreht sich um und stürzt mir kreidebleich entgegen. Sie will gegen den nachdrängenden Strom hier raus. Raus, nur raus! Das geht nicht, der Gang ist zu schmal, eine Reisegesellschaft englischer Misses drängt nach. Mein Weib hat die Klaustrophobie befallen. Das ist die Sorte von Platzangst, mit deren und anderen hinterlassenen Erregern, der alte Cheops seine am Mann führenden Wertstücke vor Grabräubern sichern wollte. Trotzdem hat man ihn heftig bemaust!
Ich schiebe meine Gemahlin wieder den Berg hinauf und spreche ihr Trost zu:
"Der Steinhaufen steht hier schon 4600 Jahre und ausgerechnet jetzt, wo du ihn betrittst, soll er zusammenrauschen?!" Na ja, denkbar wär's schon, murmele ich, aber nur in meinen Bart hinein.
Das Quartier vom Chef ist recht geräumig. Ehrfurcht und Erstaunen befällt die Betrachter. Ali Ben Beischlaf vertellt in Englisch ein paar Leuschen zur Geschichte.
Kurz vor dem Erreichen der großen Grabkammer geht nach Backbord ein Seitengang ab. Hier geht es zum wesentlich kleineren Bodoire der Frau Pharaonin. Sie ist in ihrem Gemach aber auch nicht mehr anwesend.
Die Alabaster-Mosche in Kairo darf man, wie alle gut geführten Moscheen, mit Straßenschuhen nicht betreten.
Vor dem Eingang der Moschee sitzen in langen Reihen links und rechts ägyptische Dienstleister und wechseln die vorher angelegten Filzpuschen der Besucher gegen deren Straßenschuhe wieder aus.
Das sind meines Wissens die einzigen Spezialisten der Welt, die flott und reibungslos mit nur einer Hand eine DIN-gerechte Schleife in die internationalen Schnürsenkel der Touristen binden können. Die freibleibende Hand streckt sich dabei dem Ausländer mit der Forderung entgegen: "Bakschisch!" Ich trage meine Sonntagsnachmittags-Ausgehschuhe aus dem Intershop und habe starke Bedenken, nach dem Besuch der heiligen Stätte, wenigstens ein Paar Aldi-Business-Schuhe am Ausgang wieder vorzufinden.
Die Alis klauen einem sonst, wo es sich nur bietet, die Milch aus dem Kaffee. Aber vor der Moschee die Schuhe der Ungläubigen zu mausen, muß Allah strikt untersagt haben. Niemand muß barfüßig weitergehen! Hätte ich nicht vermutet!
Der Straßenverkehr in Kairo ist erwähnenswert. Alle fahren an die Kreuzung heran, hupen dabei prophylaktisch was das Zeug hält und entscheiden dann, je nach Qualität der Hupe oder nach einem Geheimcode, wer zuerst fahren darf.
An den dünnen Zierleisten und Fenstergummis der Busse und Straßenbahnen klemmen die schwarzfahrenden Straßenkinder. Wenn sie nur mit dem großen Zeh noch auf der freiliegenden Rücklichtbirne Halt finden, reicht das für einige Kilometer Mitfahrt.
Quer über den großen Kreisverkehr zieht eine Kamelkarawane, dazwischen erzwingen ein paar Eselkarren mit landwirtschaftlichen Produkten die Vorfahrt. Die atemberaubendste Schau bieten in diesem organisierten Verkehrschaos aber die Bäckerburschen auf ihren Fahrrädern. Sie haben ein oder zwei Hände am Lenker, und gelegentlich eine am Kuchenbrett auf ihrem Kopf. Auf diesem türmen sich vier Mal einen Meter hoch die Säulen aus Fladenbrot. Eine bestaunenswerte atemberaubende Verkehrs-Akrobatik!
In der hereingebrochenen Finsternis bringt uns das Taxi auf der Wüstenstraße nach Suez zurück. Natürlich haben wir den Preis, in zähen Verhandlungen unter Einbeziehung der Konkurrenz, schon vor der Hinfahrt ausgehandelt.
Der Chauffeur betätigt während der langen nächtlichen Heimfahrt unablässig die Lichthupe. Dabei erzählt er mir recht interessant seine Kriegserlebnisse.
Er war ägyptischer Leutnant im Sechstagekrieg. Auf Wusch seiner Öberschten sollte er eine Pontonbrücke über den Suez-Kanal errichten. Danach möglichst zügig mit seiner LKW-Kolonne Tel Aviv erobern. Da bei jedem Luftangriff der israelischen Mirage-Jäger aber seine Truppenteile komplett davonrannten, hat das nicht so hingehauen.
![]() Der Stiftzahn
Der Stiftzahn
Auf See, kommt Hagen in meinen Funkraum. Er legt mir seinen Stiftzahn auf den Schreibtisch. "Hier, du hast das beste Werkzeug, pflanz mir den mal wieder ein!"
"O hä, dein Vertrauen ehrt mich aber sehr", sage ich und öffne meine gut sortierte Werkzeugschublade.
Ich haue eine große Radarröhre kaputt und schnitze aus dem daraus gewonnenen sterilen Edelmetalldraht einen neuen Stift. Ordentlich aufgerauht und eingekerbt müßte der eingeklebt doch halten, beschließen wir. Gustav wird als Sachverständiger für unlösbare Verbindungen hinzugezogen.
Außer Duosan rapid hat das Schiff aus dem Maschinen-Store noch den Zwei-Komponenten-Kleber Belzona – flüssiges Eisen – zur Verfügung. "Der hält wie Sau", garantiert Gustav für seinen eigenhändig gehüteten Klebstoff. "Nur so richtig aber erst nach 24 Stunden, falls ihr ihn nicht mit dem Schweißbrenner erwärmt" fügt er dann einschränkend hinzu. "Da muß du halt für die Aushärtezeit mit offenem Mund leben" legen wir unserem Kapitän nahe.
Ich klebe mit dem schwarzen flüssigen Eisen den Zahn samt Stift in Hagens Mund.
Er ist ein vorbildlicher Patient.
Sechs Stunden hält er zur Verfestigung des Klebers den Mund offen und den Zahn trocken. Dabei hat er auf seiner Backskiste liegend Mario Simmels: "Es muß nicht immer Kaviar sein" zur Hälfte ausgelesen.
Bis Rotterdam knackt er Paranüsse und Malzbonbons und stellt dort diese revolutionäre Dentalleistung einem höherrangigen Doktor dent. vor.
Wäre diese unschöne rabenschwarze Klebenaht nicht gewesen, hätte der Doktor diese sorgfältige Arbeit glatt so belassen. Der Zahnarzt kann seinen Heiterkeitsausbruch nicht verbergen und sicher erntet er auf dem nächsten holländischen Zahnärztekongreß mit diesem Beitrag noch einige mehr.
![]() 75 kg überfordern jeden Kran
75 kg überfordern jeden Kran
Eigentlich habe ich jetzt Urlaub und gelte freie Tage ab. Mein Tanker HEINERSDORF ist in der großen weiten Welt unterwegs. "Fahr mal mit der GÖRLITZ zwischendurch schnell nach Murmansk" bestimmt mein Funkinspektor.
Im Februar nach "Murmi". Da muß man sich ja schon wieder ganz warm anziehen.
"Du sitzt hier!" sagt man mir im Salon zur nachmittäglichen Coffee-time. Ich haue mich in den Sessel und kippe damit heftig nach hinten. Das Sesselgestell ist aus Armierungseisen zusammengeschweißt, so wie es zur Versteifung in Betonkonstruktionen verwendet wird. MS "GÖRLITZ" ist Russenschiff.
An dem Sesselgestell ist ein achterstes Bein um fünf Zentimeter zu kurz geraten und dient somit zur Belustigung beim Anscheißen der Neuen.
Abends, nach der Wache, will ich mir in der Pantry am Kühlschrank noch eine Stulle holen. Ich öffne die Tür und arretiere sie in dem Fanghaken an der Wand.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Türrahmens wische ich über die Wand auf der Suche nach dem Lichtschalter. Russenschiff! Der Schalter ist hinter der arretierten Tür.
Ich übernehme das Schiff im Heimathafen mit einer defekten Antenne. Das ist eine s. g. Wagenradantenne. An einem etwa 8 Meter hohen Glasfiebermast ziehen sich mehrere Kupferdrähte von einem kleineren unteren "Wagenrad" zu einem größeren oberen. An dem oberen Rad ist ein Antennendraht "ausgerauscht". Der Achter-Bolzen ist gebrochen oder die Mutter hat sich gelöst.
Ich bemühe mich vor dem Auslaufen des Schiffes um die Reparatur.
"O ha" sagt der Reparaturinspektor "das ist ja ein gewaltiges Problem." "Wieso", sage ich, "ich stelle mich in die Krankiepe, stecke mir einen Achter-Bolzen nebst Ringschlüssel in die Hosentasche und lasche den Draht dort oben in fünf Minuten wieder fest!"
Die Arbeitsschutzbedingungen der Deutschen Demokratischen Republik sind weltweit einmalig. Damit dokumentiert der Arbeiter und Bauernstaat die Sorge um den Menschen. Ein Hafenkran, der tagtäglich 10 Tonnen pro Hiev aus dem Schiff holt, ist viel zu labil, um meine 78 Kilogramm an den Antennenmast zu hieven, um in fünf Minuten den Bolzen einzuschrauben.
Reparatur per Hafenkran wird von dem gestrengen Sicherheitsinspektor nicht gestattet.
Der Mast muß eingerüstet werden!
Gerüste allerdings sind in der DDR unwahrscheinliche Mangelware. Der Bruch des Haltebolzens hätte so ca. 2 Jahre vorher angemeldet werden müssen, wenn für seine Auswechslung Einrüsten erforderlich ist.
Die "Reparatur" der Antenne wird in der Werft von Göteborg vorgesehen. Bis dorthin komme ich funkmäßig auch mit der defekten Antenne über die Runden.
Das Schiff fährt nun auf seinem Weg nach Murmansk mal eben rechts ran nach Göteborg. Der Revierlotse übergibt das Schiff dem Hafenlotsen, der fordert Kopf- und Heckschlepper an. An der Pier der Werft verdienen die Festmacher ihr Geld. Der Makler kommt kurz an Bord und legt dem Kapitän die Rechnungen zur Unterschrift vor: Werftkosten, Gebühren für Schlepper und Lotsen, Hafengebühren, Leuchtfeuergebühren und die für seine eigenen Dienste.
Der Makler muß sich sehr beeilen.
Die gelbschwarze Krankiepe senkt sich schon auf dem Peildeck zu der defekten Antenne herab. Die Befestigung des abgerissenen Drahtes dauert drei Minuten. Die zwei Schlepper, der Hafenlotse und der Revierlotse bringen das Schiff wieder auf die Kurslinie nach Murmansk.
Im Mittelpunkt steht nun mal im Sozialismus der Mensch. Das Schiff hat einen knappen Tag Fahrplanverzögerung und sicher einen Verlust von vielen zigtausend wertvollen Valutamark verursacht, aber dafür bin ich am Leben geblieben, nachdem ich mich leichtsinnigerweise erbot, meine 78 Kg Reparaturgewicht in Rostock mit einem Eberswalder Hafenkran an die Reparaturstelle hieven zu lassen.
![]() Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!
Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!
Nach Verlassen der Göteborger Schären brist es erwartungsgemäß zunehmend in den norwegischen Gewässern.
Ich verankere meinen Chefsessel mit der Spannschraube an der im Fußboden eingelassenen Öse und schreibe die Schiffspresse aus dem Kopfhörer in die Schreibmaschine. Bei dieser Arbeit sind beide Hände mit der Schreibmaschine beschäftigt. Holt der Dampfer nach Backbord über, lehnt man sich vertrauensvoll in die Sessellehne. Das ist dann so, wie wenn man mit dem Auto einen steilen Berg hinauf fährt. Geht's nach Steuerbord, drückt man das Knie gegen die Schreibtischkante, um nicht nach vorn aus dem Sessel zu rutschen.
Der Dampfer geht nach Backbord, mich drückt es in die Sessellehne und... plauz, liegen der Drehsessel und ich nach einer Rolle rückwärts in der Funkraumecke.
Die Öse im Estrichfußboden, die mittels der Spannschraube das Sitzmöbel gegen verrutschen sichern sollte, ist aus dem Fußboden gerissen.
Die verdammten Heinzis auf der Leningrader Werft, haben zur Befestigung der Platte mit der Öse nur "Madenschrauben" einfach so in den Estrichfußboden gedreht. Ein Wunder, daß das überhaupt fünf Minuten der Belastung standgehalten hat.
An Bord der sowjetischen Exportschiffe fährt ein Jahr lang, während der gesamten Garantiezeit, ein Leningrader Werftingenieur mit. Grischa halte ich nun wutschnaubend die drei Madenschrauben unter die Nase und verweise auf mein spontan aufgetretenes Bandscheibenleiden. Der Mann fährt aber nur mit, um Ansprüche an den Exporteur abzuwenden.
Nach Auslaufen Murmansk herrscht in der Nacht vor dem Nordkap dichtes Schneegestöber von der Sorte, das als Hauptfeind des Sozialismus das Leben in der DDR binnen drei Stunden zum Erliegen brächte.
 Plötzlich heult es ganz schrill im Schiff. Mein Fenster ist nicht fest verschraubt, durch den schmalen Spalt faucht die Luft herein. Ich habe das Gefühl, meine Trommelfelle wölben sich aus den Ohren, die Atemluft wird knapp.
Plötzlich heult es ganz schrill im Schiff. Mein Fenster ist nicht fest verschraubt, durch den schmalen Spalt faucht die Luft herein. Ich habe das Gefühl, meine Trommelfelle wölben sich aus den Ohren, die Atemluft wird knapp.
Unten im Hauptgang steht das schwere Eisenschott zum Maschinenschacht offen, durch dieses faucht es ganz tierisch. Der Bootsmann, der wie alle anderen auch, panisch aus seiner Kammer saust, schließt das Schott und dreht die Vorreiber dicht.
Das Licht geht aus, der Motor verstummt augenblicklich. Das Pfeifen ist schlagartig vorbei. Es herrscht tiefste Stille. Black out!
Das Schiff treibt verdunkelt, manövrierunfähig und blind durch das dichte Schneetreiben. Es geht die Notbeleuchtung an und in deren fahles Licht taucht der III. Ing. aus dem Maschinenraum auf. Er ist rabenschwarz mit Ruß überschüttet und nicht zu erkennen.
Ein großer Schiffsdiesel ist ein Verbrennungsmotor. Er benötigt für seinen Betrieb eine riesige Menge Sauerstoff. Diese beziehen auf diesem Schiff die Maschine und die Jockel durch zwei quadratische Lüftungsrohre. Die Gitter vor dem Lufteintritt sind während des Schneegestöbers an Oberdeck zugeweht. Jetzt ringt der Diesel nach Luft und besorgt sie sich, ganz asthmatisch pfeifend, auf Umwegen durch jede verfügbare Öffnung. Deshalb pfeift es an meinem Bulleye-Spalt so bärisch. Als der Bootsmann das Schott zum Maschinenraum schließt, schließt er den letzten dunklen Kanal, über den sich der Motor noch klammheimlich versorgt. Als allerletzten Atemzug holt er noch durch den Schornstein einmal tief Luft und haut dem gerade sehr ungünstig stehenden Wach-Ing. den ganzen dort anhaftenden Ruß über den Pelz.
Utz von Hallasch ist hier der Leitende Ingenieur. Er und seine Truppe haben nun wenigstens für den Spott der anderen Gewerke an Bord nicht zu sorgen. Das Freischaufeln der Lüftungsgitter beseitigt die Atemnot der Hauptmaschine und der Jockel. Der Dampfer kommt in Fahrt und Strom ist auch wieder verfügbar.
Auf dem Peildeck schmilzt der Schnee.
Im Funkraum tropft es aus der Leuchtstofflampe auf meinen Arbeitstisch. Ich ziehe Grischa zu Rate, den Leningrader Garantie-Ingenieur.
Seine Möglichkeiten beschränken sich in dem theoretischen Wissen, daß das Schmelzwasser nicht unbedingt im Funkraum zu Tage treten muß, wo es oben darüber auf dem Peildeck einsickert. Vom Peildeck werden die tauenden Schneemassen entfernt, das Tropfen ebbt danach allmählich ab.
Die Heinzis sind auf den DDR-Werften die pinschietrichsten Abnehmer ihrer hier in Auftrag gegebenen Schiffe. Sie bemängeln ständig die kleinsten Kleinigkeiten, obwohl sie mit den zu bezahlenden Warenlieferungen regelmäßig in Verzug sind und ihrerseits kaum einen Termin einhalten.
Von ihren Werften allerdings, werden uns Schiffe angedreht, für die eigentlich nur garantiert wird, daß sie schwimmen.
![]() Eine sehr kurze Reise
Eine sehr kurze Reise
Nach der Vertretungsrolle bei Steine & Erden folgt nach gewährtem Urlaub eine Einsatzzeit auf Tanker "HEINERSDORF" von sieben Monaten. Das ist sehr herb.
Unser Löschhafen ist Göteborg. In einen DDR-Hafen paßt der Tanker nicht hinein.
Wenn nun nach Schweden einfach keine Ablösung geschickt wird, kann unsereiner ganz einfach nicht absteigen. Also ziehe ich enttäuscht und wütend wieder los und stehe dennoch beim Kampf um unsere sozialistische Sache in der ersten Reihe, aber das ist Eigenlob und nicht die Sicht der Politoffiziere. Mir fehlt die Klarheit im Kopf, ich bin nicht Mitglied der Partei.
Nach dem siebenmonatigen Mammuteinsatz mache ich mir zwei fette Sommermonate. Zu fett, aus Sicht meiner Frau.
Ihrem tieferen Verhör entziehe ich mich durch Flucht auf See. Meine zurecht enttäuschte Gemahlin, die weiterhin mit Eifer sucht, was Leiden schafft, macht nun in Rostock einen derartigen Wirbel, der dem allgegenwärtigen Auge der Staatssicherheit natürlich nicht verborgen bleibt. Das verschafft mir diesmal eine sehr kurze Reise.
Ich komme nur bis zum Roten Meer.
wegen erkrankung ehefrau ablösung funkoffizier erforderlich
heißt die Stasiversion dieses Telegrammtextes, der mich nach Hause holt, weil ich aus deren Sicht ein Sicherheitsrisiko geworden bin.
Der Kapitän schaut sich in der Seekarte des Roten Meer nach einem passenden Hafen um, um meine Ablösung zu realisieren und dort auch die Ankunft eines Ersatzmannes abzuwarten.
Ich telefoniere nach Hause, wir fahren durch bis Kharg Island. Meine Frau ist nicht krank, sie ist im Dienst.
Funkoffizier Peters kämpft sich von Rostock den Schat-el-Arab zu uns herab und ich nach Ablösung durch ihn, in die entgegengesetzte Richtung nach Hause.
Meine Frau hat beim Rechtsanwalt schon alles gerichtet und die Scheidung eingereicht. "Bringen sie ihre Familienangelegenheiten in Ordnung, dann werden wir weiter sehen" erklärt mir die Kaderleiterin als Sprachrohr der Stasi.
In der ersten Scheidung des Jahres 1977 bringt das Kreisgericht Rostock meine Familienangelegenheiten in Ordnung.
Nach drei Monaten ist das Guthaben meiner freien Tage aufgebraucht. Danach schmore ich lustlos in einem Bürojob als Landei in der Verwaltung.
Meine Berufskollegen auf See aber bekommen keinen Urlaub. Nur wenn einer von ihnen einen falsch gefärbten Pups läßt, kommt sofort eine Ablösung.
Nur mein hübsches junges Gegenüber am Schreibtisch läßt mein Landei-Dasein in der Verwaltung erträglicher erscheinen.
![]() Ab nach Panama, fix muß' gehen
Ab nach Panama, fix muß' gehen
Wolfgang Nötzel, mein Funkinspektor kommt in das Büro. "Sieh' zu, daß du nach Hause kommst. Pack deine Klamotten, du mußt morgen früh nach Panama abdampfen. Dort liegt THEODOR KÖRNER mit einer rauchenden Bananenladung. Jonny Miller mußte ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hier ist dein Seefahrtsbuch, Flugticket und Übergepäckschein. Guten Flug!"
Ich mache einen Luftsprung und muß als dynamischer Leistungssportler aufpassen, daß ich mit meiner Rübe nicht die Sauerkrautplatten der Barackendecke durchstoße. Ich schmeiße meine angearbeiteten Papiere meinem hübschen Gegenüber auf den Schreibtisch, sie schaut nach dem Küßchen etwas traurig.
"Tschüß, machts gut und legt euch wieder hin!"
Mich ehrt das Vertrauen, daß mir die Stasi sofort nach dem Kriseln meiner Ehe entzog, die Reederei mir jetzt aber nach deren O.K. sofort bedenkenlos zurückgibt. Das Vertrauen dokumentiert ein OK-Flugticket nach Amsterdam mit Anschlußflug nach Panama nebst Blanko-Übergepäck-Schein.
Dafür hätte so mancher DDR-Bürger wer weiß was gegeben!
Ich fliege am nächsten Tag erst einmal mit schwerem Marschgepäck von Berlin-Schönefeld nach Amsterdam Sheepool.
Wegen der nicht vorhandenen Überflugrechte fliegt die Interflug-TU nach Holland über JWD. Holland wird von der Seeseite aus angeflogen, die Schleife über dem Land ist imposant. Es ist der 16. Mai 1977, in Holland blühen die Tulpen, nur die Straßen und Wasserarme sind Tulpen-Blüten-frei.
Der Flughafen Sheepool ist riesig und verfügt über 64 Terminals. Die DC 10 der KLM hat am Terminal 63 festgemacht.
Sie wartet auf mich, als letzten Passagier. Ich habe Paßschwierigkeiten. Ist doch klar! "He het een Seefahrtsbukje un een Dienstobdraach, geen Visum!" telefoniert die Paßbeamtin ihrem Chef.
Es werden höhere Chargen hinzugezogen.
Ich bekomme Ausmecker wie verrückt. "Sie werden abgeschoben", beschließen die Paßbehörden. "Das trifft doch genau meine Vorstellungen", begrüße ich den Beschluß des officers.
"Wenn sie dazu noch mein Flugticket für diese Maschine nach Panama nutzen, bin ich ihnen dafür sogar zutiefst dankbar!"
"Hauen sie ab, aber in Panama kriegen sie erhebliche Probleme", glaubt der paßgewaltige Holländer zu wissen.
Die Stewardeß drömmelte neben mir schon von einem Pumps auf den anderen und bringt mich freundlicherweise durch den Tunnel an Bord, damit ich mich nicht verlaufe. Die Gepäckleute wollten wissen, ob sie meine umfangreichen Klamotten wieder in dem Stauraum des Flugzeuges suchen und wieder herausräumen müssen.
Ich werde nach Panama abgeschoben.
Über Zürich, Madrid, Caracas und Curacao erreiche ich Panama-City.
Der Nachtflug über dem Atlantik gen Westen zieht sich in die Länge. Die lahme aufgehende Sonne kommt nur schleppend achtern auf und kann sich nicht zum Überholen entschließen.
Neben mir in der ersten Klasse auf der letzten leeren Mittelbank pennt die ganze Horde Stewardessen. Früh morgens sehen die Mädels ziemlich zerknittert aus.
Ich kann in Transportmitteln, wenn ich nicht liegen kann, nicht schlafen.
Ich schlafe im Sessel noch nicht einmal bei Feldmanns "Aktueller Kamera" ein.
Die dicke DC-10 setzt auf. Es staubt gewaltig auf dem merkwürdigen Feldflughafen von Panamas Hauptstadt. Die auf dem Flugfeld aufgestellten roten Blechfässer zeigen den Flugzeugführern wo sie hin müssen.
Bei der Paßkontrolle zücke ich kühn mein Seefahrtsbuch und werde durchgewunken, wie heute z. B. von Lindau nach Bregenz am Bodensee.
Der Makler holt mich ab. MS THEODOR KÖRNER hat den Kanal schon passiert und liegt vor Christobal auf Reede und wartet schon sehnsüchtig auf mich. Ich durchquere Panama auf dem Landweg. Ein Boot bringt mich zu meinem neuen Schiff.
Kapitän Schlegel drückt mir zur Begrüßung mit rechts die Hand und mit links einen Stapel Telegramme in die Hand. Ich bitte mir vier Stunden Verschnaufzeit aus, ich war 36 Stunden unterwegs.
Mein Berufskollege Jonny Miller hat es auf der Lunge. Der arme Kerl ist in dem Zustand, in dem ihn sein Schiff in Panama zurück läßt, nicht zu beneiden.
Die amerikanischen Mediziner der Panama-Kanalzone stellen seine Transportfähigkeit her. Er kehrt auf dem selben Weg, auf dem ich zu seinem Ersatz herbeieilte, nach Bad Kleinen zu Frau und zwei Kindern heim.
Nach einem Jahr, auf den Tag genau, als ich in Panama Jonny ersetzen mußte und in Holland die Tulpen blühten, nehme ich auf See ein Telegramm der Reederei auf:
funkoffizier miller in der rostocker universitaets-klinik verstorben
Wir flaggen halbmast und schicken per Fleurop nach Bad Kleinen einen letzten Gruß von See. Mir wäre ein anderer Grund für die Anmusterung auf diesem Schiff angenehmer gewesen.
![]() Jetzt wieder Bananen
Jetzt wieder Bananen
Das Schiff hat 3200 Tonnen Bananen aus Ecuador an Bord, die müssen schleunigst nach Hause.
Ich habe mein eingezogenes Seefahrtsbuch wieder. Als ich aus dem Funkraumfenster achteraus ins Kielwasser meines neuen Schiffes sehen kann, überkommt mich ein wahres Glücksgefühl.
Seeleute gehören wohl zu der Berufsgruppe, die, auch wenn sie gelegentlich noch so heftig ihren Job verfluchen, nur ganz schweren Herzens davon lassen können.
 MS THEODOR KÖRNER ist ein schönes komfortables Schiff, in Sandefjord / Norwegen gebaut. Es transportiert vornehmlich aus dem Karibischen Raum und Ecuador Bananen für die Republik. Diesmal in Kartons, mit immer voll Schiff.
MS THEODOR KÖRNER ist ein schönes komfortables Schiff, in Sandefjord / Norwegen gebaut. Es transportiert vornehmlich aus dem Karibischen Raum und Ecuador Bananen für die Republik. Diesmal in Kartons, mit immer voll Schiff.
Das ist nicht so eine belustigende Gurkerei, wie mit MS JOHN BRINCKMAN vor zehn Jahren nach Conakry.
Nach Art des Hauses hüpft die leichte Banane natürlich wieder jeden Wellenberg hinauf und danach auch wieder hinab. Die Umstellung von meinem vorherigen Achtzigtausend-Tonner, mit dem sechs monatigen Zwischenstop an Land, läßt mich jetzt erst einmal wieder so richtig auskotzen. Danach geht es aber wieder reibungslos.
![]() Viel Wetter verbraucht viel Papier
Viel Wetter verbraucht viel Papier
Kapitän Laasch ist der Stammkapitän des Schiffes und großer Fuchs in Wetternavigation. Es gelingt ihm immer in bewundernswerter Weise, unter Einsatz der 22 verfügbaren Knoten Marschfahrt des schnellen Schiffes, die Hurrikans auf dem Atlantik auszutricksen. Es gab Reisen, da füllten gleich drei solcher aktiver Wirbel die gesamte Wetterkarte aus. Die Rückseite von einem läßt sich eines Tages nicht ganz vermeiden. Wir erhalten einen Eindruck davon, wie es wäre, solch einen Wirbel ahnungslos in voller Breitseite abzufassen.
Das Schiff ist mit dem sowjetischen Erfolgsmodell des Wetterkartenschreibers Typ "Ladoga" ausgerüstet. Bei seiner Installation wurden sechs Rollen des dafür nötigen Spezialpapiers mitgeliefert. Danach nie wieder. Viele Sturmtiefs verbrauchen viel Papier. Drei Hurrikane gleichzeitig verbrauchen den gesamten Bordbestand.
Auf der Reede des Kolumbianischen Hafens Turbo liegt ein weißer Dampfer mit Werkzeug im Schornstein. Mit dem Glas identifizieren wir ihn als "Nikolai Kopernik".
Ich rufe ihn auf UKW und verbiege mir wieder auf russisch das Kreuz.
Ich frage an, ob er für unser wetterzerzaustes Schiff ein paar Rollen "Pumaga" für den Wetterkartenschreiber Typ "Ladoga" übrig hätte.
"Da moschno" sagen die Freunde ohne zu zögern. "THEODOR KÖRNER" läßt das Rettungsboot zu Wasser. Ich bekomme eine Begleiteskorte und von Marianne, der Oberstewardeß zwei Flaschen Wodka aus der Transitlast. Man kommt ja bei Freunden nicht mit leeren Händen zum Schnurren.
Aus der langjährigen Erfahrung solcher Besuche verordnet der Kapitän: "Ein Matrose und ein Maschinenmann verbleiben nach dem Anlegen beim Boot. Sie betreten maximal das Gangwaypodest des gastgebenden Schiffes!"
Wir gehen mit vier Mann bei "Nikolai Kopernik" an Bord und werden herzlich empfangen. Jeder wird von seinem sowjetischen Berufskollegen hereingebeten.
Ich würde mich ganz gerne mal auf der Brücke und im Funkraum umsehen. Aber dazu kommt es nicht. In der Kammer des Funkoffiziers treffe ich noch auf den Chiefmate und den Politoffizier. Ich übergebe meine zwei Flaschen Schilkin-Wodka und frage nach Wetterkarten Papier für den "Ladoga"-Pisatjel oder so ähnlich.
"Saditjes!" lautet der strenge Befehl. Gläser stehen ohnehin schon auf der Back!
Der Schraubverschluß der ersten Wodkaflasche ist gekonnt geöffnet, obwohl man dagelegentlich auch mal ein Taschenmesser benötigt, weil sich der Schraubverschluß mit dem Ring, der nach Öffnen an der Flasche verbleibt, gemeinsam dreht.
Erst mal Sto Gramm zum warm machen. "Na sdarowije!"
Du lieber Gott, ich habe an Bord von Marianne den Stoff direkt aus der Last bezogen. Die befindet sich unterhalb der Wasserlinie und ist nicht klimatisiert. Der blaue Würger ist ca. 35 Grad warm. Es rüttelt mich ganz bärisch.
Das findet keine Berücksichtigung, die Buddel ist nach dem zweiten ausschenken leer.
Mein Berufskollege versucht sich im Kaffeekochen. Es braucht eine Stunde, bis er alle dafür notwendigen Utensilien zusammen hat.
Kaffee pur belastet den Körper viel zu stark, es wird zur gesundheitlichen Stabilisierung meine zweite, in der klimatisierten Kammer geringfügig kälter gewordene Pulle Wodka aufgerissen.
Die Runde ist schweinisch gemütlich, aber dennoch blase ich zum Rückzug. Ich bekomme zwölf Rollen des begehrten Papiers und als Dreingabe eine Literflasche "Moskovskaja Wodka". Nach meinem Geschmack der beste Wodka der Welt. Die Flasche beschlägt sofort, sie ist eiskalt!
Die Heinzis sind ein herrliches Völkchen. Das beste in dieser Art. Nur ihre bisherigen Führer sind, von Gorbatschow abgesehen, die Oberbekloppten dieser Welt, die ihr Volk gar nicht verdient haben.
Ich rufe per deutscher Durchsage unsere verstreuten Truppenteile zum Boot.
Der Matrose und Maschinen-Assi sind nüchtern. Der Rest zeigt leichte Verschleiß-erscheinungen und kann, erstmalig nach der Schule, wieder Russisch. Der Stern am Himmel hat kein Verständnis für unsere körperlichen Gebrechen. Beim Ein- und Ausbooten wird noch einmal Zusammenreißen gefordert.
Nur auf diese Weise erhalten wir die Betriebsfähigkeit des Wetterkartenschreibers.
Daher unternehme ich derartige Hamstertouren in den nächsten drei Jahren des öfteren, aber nie wieder mit halb kochendem Wodka als kleines Kontaktgeschenk. Ich lasse mir, aus gesundheitlichen Gründen, den schön kalten vom Alten aus dem Kühlschrank geben.
![]() Die Palme mit der Rettichwurzel
Die Palme mit der Rettichwurzel
Kolumbien verschifft über die Häfen Santa Marta und Barranquilia mittels moderner Elevatoren sein riesiges Bananenaufkommen. Etwas langwieriger geht es hier in Turbo zu. Wir sind halt immer noch Sozialisten und brauchen nicht das hektische Profitmachen. Zeit läßt sich in unserem Wirtschaftssystem nicht zu Geld spinnen.
Das Schiff ankert im Reedehafen Turbo an der Urwaldkante vor einer Flußmündung. Des nachtens umschwirren die prächtigsten Schmetterlinge die Halogen-Decksleuchten.
Das Dörfchen bietet mit seinen in den Uferschlamm gebauten Pfahlbauten keinen berauschenden Anblick. Im Ristorante kann man einen Drink nehmen und evt. ein lukratives Tauschgeschäft, Klamotten gegen Neskaffee, abwickeln.
Schließlich kostet ein Kilo Kaffee mittelmäßiger Qualität in der DDR 80,- Mark.
Ein Pflanzer lädt uns zu einem Ausflug auf seine oberhalb der Flußmündung gelegene Plantage ein. Ein sehr großer Einbaum mit einem starken Außenbord-Motor holt unsere Reisegruppe auf Reede ab. Die Fahrt auf dem schmalen Urwaldfluß durch die wilde Vegetation hinterläßt Eindruck. Am Ufer einer gerodeten Waldfläche formiert sich ganz hastig beim Heranknattern unseres Bootes vor einer ärmlichen Indiohütte eine Großfamilie. Vater, Mutter und über zehn Gören stellen sich zerlumpt und rotznäsig wie die Orgelpfeifen am Ufer auf und freuen sich am Vorbeirauschen des seltenen Besuchs.
Unser Gastgeber, der freundliche Pflanzer ist ein junger intelligenter Mann. Er zeigt uns seine kleinere Pflanzung und schildert uns die Härte seines Überlebenskampfes gegen die Multis von Chiquita und Dole, von denen er sich nicht fressen lassen will.
Hans-Peter Grosse ist der Leitende Ingenieur der THEODOR KÖRNER. Er ist ganz scharf auf eine handliche Palme. Alle ausgegrabenen Versuche und auch das in einer Gärtnerei in Panama erworbenen Exemplar sind zu Hause, im trüben lichtarmen Germany vermickert. Der Pflanzer läßt ein ca. 1,20 Meter hohes Exemplar, samt der riesigen Pfahlwurzel sorgfältig ausgraben. Die gewaltige Wurzel umgibt ein daran belassener Erdballen, der in ein Tuch eingeschlagen wird. "Na jetzt muß das doch zu Hause was werden, mit der riesigen Wurzel an dem Gewächs", bestärken wir den Chief in seinen Einbürgerungsbemühungen der exotischen Botanik.
Wir treten mit dem schlanken schnellen Gefährt die Rückreise an. Der Indio-Bauer hat am Flußufer wieder seine Truppenteile antreten lassen aber nun, zu unserem Erstaunen, alle gewaschen, gekämmt und umgezogen. Auch das Kleinste hat jetzt die vorherige Rotznase geputzt. Alle Kinder und auch die stolzen Eltern sind nun sehr ordentlich gekleidet. Damit hatte Mammi während unseres Aufenthaltes beim Pflanzer aber gewißlich ihr Tun, um die ganze Truppe so aufzumotzen. Und das nur, um den vorbeifahrenden Ausländern voller Stolz vorzuführen, was man aufzuweisen hat. Andere Länder, andere Sitten. Von denen gibt es aber auch bei uns viel schlechtere, als die des armen Bauern am Ufer dieses Urwaldflusses.
Als wir in die offene See hinausfahren, hat es aufgebrist. Wir werden im Boot klitschnaß und müssen ausösen (schöpfen). Der Chief umsorgt sein Gewächs. Das überkommende Spritzwasser nagt an dem Erdreich des Wurzelballen. Der sorgende Besitzer schützt seine Errungenschaft mit seinem Körper gegen die zersetzenden Seewassergüsse. Das im Boot um unsere Füße schwabbelnde, übernommene Wasser ist schon ganz erdig. Das Anlegen am unteren Gangway-Podest gestaltet sich schwierig. Das leichte Boot jumpt beängstigend auf und ab. Wir springen, den richtigen Moment abpassend, alle recht behende auf das Podest. Der Chief hat es da schwerer. Er umklammert seine Palme mit dem vollgesoffenen verpackten Wurzelballen, paßt den richtigen Moment ab und.... springt mit seinem botanischen Schatz volle Kanne in den Bach. Von den beiden ragen kurzzeitig nur die oberen Palmwedel aus dem auf- und abschwellenden Wasser. Die Palme und der sie umklammernde Besitzer werden nach ihrem Wiedererscheinen ins Boot gezogen.
Das Tuch und der Wurzelballen sind verlustig gegangen. Das untere Ende des Bäumchens ziert nun eine lange, schneeweiße Pfahlwurzel nach Art eines langen bayrischen Radies. Mit einem kühnen Speerwurf schleudert Chief Grosse das hübsche Gewächs nun erbost außenbords und gibt diesem so die Chance, evt. am heimatlichen Ufer wieder neu Fuß zu fassen. Im tristen europäischen Norden bliebe ihm das erfahrungsgemäß mit der blanken Rübe unten dran ohnehin verwehrt.
![]() Puerto Bolivar
Puerto Bolivar
Nahezu zum zweiten Heimathafen für MS THEODOR KÖRNER avanciert am südlichsten Ende Ecuadors im Golfo de Guayaquil der Bananenumschlagplatz Puerto Bolivar. Der kleine Hafen ist über das trübe Wasser des Rio Jambeli zu erreichen.
Wer in Bolivar glimpflich behandelt werden möchte, zahlt am besten Eintritt. Bei seiner ersten Reise dort hin, hatte Kapitän Laasch die Geschenke vergessen. Als erster erinnerte bereits der Lotse den Kapitän daran, daß das eine Ausnahme bleiben muß. Er kratzte mit dem Dampfer so hart an der gebaggerten Unterwasserböschung der Fahrrinne, daß die aufgewühlte Heckwelle an Höhe das Achterschiff bei weitem überragte.
Der Obermafiosi des Hafens, ist wie in allen südamerikanischen Häfen, der Zollchef selbst. Er schickt seinen Dienst-Jeep zwecks Abtransport des zollfreien Schmuggelgutes. Kapitän Laasch hat mittlerweile einen für beide Seiten passablen Deal gefunden. Er schenkt nicht jedem Bedürftigen einen Karton Whiskey, sondern verkauft in größeren Posten zu den sagenhaft günstigen Preisen des VEB Schiffsversorgung Rostock, plus einen geringfügigen Aufschlag zur Deckung der Gestehungskosten. Der Zollchef trägt dann meist zwölf bis fünfzehn Kisten ganz kostengünstig ab, die übrigen Beamten der Immigration und der Lotse in etwas geringeren Dimensionen. Danach hat das Schiff keinerlei Probleme mehr. Jetzt könnten wir auch zehn Panzerwagen ein- oder ausführen und mit einem schweren Maschinengewehr auf dem Rücken durch das Zolltor marschieren. Beim Passieren mit einem Transporter voll Hasch, müßte man halt der Torwache eine Tüte voll abgeben. So wie es eben südamerikanischer Landessitte entspricht.
Wer sich an diese Gesetze hält, schafft sich keine Probleme.
Dem gestrengen DDR-Zoll und den Reederei-Gewaltigen ist dieses Geschäftsgebaren natürlich zähneknirschend aufgefallen. Aber sie verzichten lieber auf das Austesten der südamerikafeindlichen These: "Ehrlich währt am längsten!"
Mit den "Kleinvieh macht auch Mist" erwirtschafteten Dollars aus den Whiskeyverkäufen gönnt der Kapitän dann bei Gelegenheit der Besatzung ein Vergnügen, z. B. eine erlebnisreiche Inselrundfahrt auf Curacao.
Sofort nach dem Festmachen okkupiert die Schar der "Tschinscher" das Schiff. Nach ein paar Reisen kennt man sich. Jeder hat seinen Geschäftspartner, man pflegt die Beziehungen und macht sein kleines Geschäftchen. DDR-Leinwand-Turnschuhe, Textilien oder Koffer gegen ecuadoranische Sucre. 27 Sucre ergeben einen richtigen US-Dollar. Somit haben wir als valutamäßige Sozialhilfeempfänger hier unser Auskommen...
Nur einer kann gemäß seines Gelübdes damit schlecht leben und kommt in Teufels Küche, unser verehrter Politoffizier!
Eines Tages faßt er sich ein Herz und die Tschinscher am Schlawittchen. Er treibt sie alle von Bord. Aber mit mäßigem Erfolg, sehr bald sind alle wieder da. Mit dieser Maßnahme verstieß der Politnik ganz eklatant gegen das Grundgesetz Lateinamerikas. Diese Gesetzesübertretung wird demzufolge nach lateinamerikanischen Gesetz geahndet. Das ist schmerzlich für den Politoffizier und keiner von der Besatzung hat ihm das gegönnt.
Zweihundert Meter vom Hafentor entfernt, am hellichten Tag verspürt der Politoffizier im Leib einen stechenden Schmerz. Er hat seine Frau dabei, sie schleppt ihn und er sich selbst zur Hafenwache. Ein Negerbengel hat ihm auf dem Gehsteig im Vorbeigehen ein Stilett in den Leib gerammt. So eine gemeine Stichwaffe mit einer sehr langen dünnen, beidseitig geschliffenen, spitzen Klinge. Der Mann hat nach Aussage der Ärzte ein sagenhaftes Glück. Der lange Stich ging an Leber und Milz vorbei, aber tief in den Leib hinein. Der Schwerverletzte bleibt in Marcalla im Krankenhaus. Seine Frau muß mit uns, aber ohne ihren Mann, die Heimreise antreten.
Mir hängt in dem gleichen Straßenabschnitt plötzlich so ein dunkelhäutiger Typ am linken Arm und versucht die Armbanduhr abzustreifen.
Das Glashütter Gliederarmband hält dem Stand. Ich drehe mich um und renne in der ersten Anwandlung von Wut dem Flüchtenden auch noch hinterher. Er war noch in der Ausbildung, sonst hätte er mir kurzer Hand aber langstilettig per Pansenstich, die Wut aus dem Bauch gelassen.
Allerorts in Südamerika steht man in heißen Stiefeln!
Von einem Landgang in Panama kommt unser Kapitän mit abgefetzten Hosentaschen zurück. Am hellen Tag auf offener Straße wollten zwei Ganoven auf die Schnelle nachschauen, ob ihnen auf diese Weise nicht ein paar Dollars entgegenfielen.
Außer vielfältigen Ganovenaktivitäten ist in Bolivar nichts los.
Am schlammigen Ufer des Jambeli stehen ärmliche Hütten auf Stelzen. Das macht sich hygienisch äußerst günstig. Wer dort gleich durch den Fußboden ans Ufer kackt, hat die Gewißheit, daß die Flut alles bestens und kostengünstig entsorgt.
Der zweistöckige einzige Amüsierschuppen am Ort steht gleichfalls auf Stelzen. Er ist über einen sehr schmalen Brettersteg mit wackeliger Reling zu erreichen.
Wem abends dort nach Entspannung gelüstet, der muß an Bord einen Konvoi zusammenstellen. Unter zehn Mann Truppenstärke ist die sichere Rückkehr in Frage gestellt.
E.-Ing. Mutschmann schneidet zur besseren Absicherung des Unternehmens handliche Kabelenden von der Trommel.
Die Stewardessen Annelie und Sandra führen wir im Troß mit.
In dem Schuppen kommt Freude auf. Gelegentlich ist die life-music südamerikanisch schrill, aber sonst törnt das Ambiente an. Das Bier und erst recht der Rum munden, el mundo.
Toiletten sollen auch gerüchtemäßig vorhanden sein. Wir Männer pinkeln im kühnen Strahl vom Brettersteg, die Mädels kriegen dabei auf Grund ihrer diesbezüglichen anatomischen Fehlkonstruktion Probleme. Sandra wendet sich vertrauensvoll an die Chefnutte des Etablissements. Sie ist mit ihrem deutschen Zuhälter liiert und kann mit der Sprache ganz gut üm. Ihre Verschnaufpausen verbringt sie vorzugsweise inmitten unserer Sitzgruppe.
Sie ist der Meinung, daß die öffentliche Toilette leichte hygienische Mängel aufweist und lädt Annelie und Sandra zum komfortableren Pipimachen in ihr Arbeitszimmer im ersten Stock ein. Die Mädels pischern dort in eine Schüssel und die hilfsbereite Gastgeberin schüttet dann das Ergebnis in einen Trichter, der auf einem Gummischlauch steckt. Der Abwasserzweckverband Jambeli-Pacifik erledigt die weitere gebührenfreie Abwasserentsorgung.
Bevor die Blasen sich erneut melden, blasen wir zum geordneten Rückzug. Die Mädels in dem Schuppen haben mit uns kaum Geschäfte gemacht, dennoch sind sie uns gewogen. Sie hauen plötzlich Flaschen kaputt und drücken jedem von uns einen splitterstrotzenden abgeschlagenen Flaschenhals zum Abschied in die Hand.
Draußen auf und zwischen den Bretterstegen murmeln in dunkler Nacht dunkle Gestalten. Im geschlossenen Konvoi, mit Kabelenden und splitterstrotzendem Flaschenhals wehrhaft gerüstet, erreichen wir im Hafen sicher unser Schiff.
![]() Moskitos und Holzkohle "light"
Moskitos und Holzkohle "light"
K.-H. Pöschmann, der II. Ing. hat den Bootsmotor der Barkasse gründlich überholt und durchgesehen. Zu der ausgedehnten Probefahrt komme ich mit. Außerdem Matrose Kaiser und der Kochsmaat.
In Sichtweite des Hafens breitet sich eine flache Insel aus. Neben den meist mit Mangroven bewachsenen Ufern bietet sie auch einen schönen Sandstrand. Die Insel bewohnt nur ein Köhler mit seiner unübersichtlichen Kinderschar.
Die kleine Bretterhütte der Großfamilie steht gleichfalls auf Stelzen. Es pfeifen kreuz und quer der Wind und die Moskitos durch das luftige Bauwerk.
Im Laufe der Reisen nach Bolivar hat es sich auf THEODOR KÖRNER eingebürgert, beim Öffnen eines der gewaltigen Putzlappenballen im Maschinenraum, ein Auge auf verwertbare Kinderkleidung zu werfen. Hier finden sich oft absolut tadellose Stücke, für dessen Verschenken sich niemand schämen muß. Die Kleidersammlung nehmen wir von Zeit zu Zeit dem Köhler mit. Auch Tropentage- und vor allem Nächte können kühl werden.
Während der Überfahrt kreuzt eine Walherde unseren Kurs. Die Tiere sind nur vier, fünf Meter lang. Pöschi verfolgt sie und fährt mit ausgekuppeltem Getriebe in das Rudel.
Ich möchte einem Wal das Blasloch zuhalten. Kurz vor unserem Bootssteven winken sie noch elegant mit der Heckflosse und tauchen ab. Zehn Meter hinter dem Boot schauen sie wieder aus dem Wasser und lachen uns deutlich hörbar aus.
Der Sandstrand vor uns ist leuchtend karminrot. Pöschi klappt den Heckbord-Motor hoch, das Boot läuft auf dem flachen Strand auf. Jetzt ist zwanzig Meter nach jeder Seite der Sand schön weiß. Von weitem winken uns in Millionenverbänden rote Winkerkrabben zu. Dort wo man auf sie zugeht, bilden sie eine Schneise, weil sie sich bei Annäherung blitzschnell in ihre Löcher verkrümeln.
Wir entblößen den Oberkörper und tragen nur Shorts und Gummistiefel. Als erstes ist das Imprägnieren unserer Alabasterkörper zwingend erforderlich.
Jeder hat ein Fläschchen "Mückin" dabei. Das wird in die hohle Hand geschüttet und jede freie Stelle des Körpers damit gebeizt. Wird ein Ohrläppchen beispielsweise vergessen, stürzen da augenblicklich zehn Moskitos drauf los.
Daher ist das Tragen der Hemden oder T-Shirts nicht angeraten. Die sind sofort durchgeschwitzt und tausend Moskitos treiben ihren Stachel durch das anliegende Gewebe in die Poren. Die Moskitos aus den hiesigen Mangroven-Sümpfen kennen keine Verwandten. Die machen keine langen Probeanflüge oder drehen etwa noch unentschlossen eine Warteschleife. Die stürzen herbei, Landeklappen und Stachel raus und hinein damit in die erst beste Pore ihres Claims. Viel Platz bleibt nicht, die Biester stehen ja Schulter an Schulter. Während man hundert mit einem Streich auf dem Bauch totschlägt, fallen fünfhundert über den Rücken her.
Unser Mückentötolin ist ganz hervorragend. Jetzt stürzen sich zwar mit tropfenden Lefzen gleichfalls die Moskitos auf uns, aber einen Zentimeter vor dem angepeilten Landeplatz fahren sie herb enttäuscht die Landeklappen wieder ein und starten angewidert durch.
"Touch and go" heißt das, glaube ich, in Pilotenkreisen.
So können wir es hier aushalten.
Ich bewerfe mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht "Pöschi" mit einem riesigen Baumstamm, von der Art des Riesen beim tapferen Schneiderlein. Der Beworfene entgeht durch einen Hechtsprung seinem Zerschmettern.
Der gewaltige Stamm ist Balsaholz und wiegt ungefähr soviel, wie die Schaumstoff-Ummantelung einer Einbau-Badewanne.
Das Holz ist so leicht, daß hier Postkarten daraus gefertigt werden.
Auf einem hohen Baum, im Inneren der Insel, kreischen herzzerreißend kleine grüne Papageien. Der Kochsmaat und ich wollen sie näher betrachten. An den Strand schließt sich niedriges Buschwerk an. Der Boden ist mit so einer Art Gurkenranken bedeckt. Daran wachsen gelbe eierförmige Früchte mit weichen Stacheln. Eine Ranke macht sich vor uns auf einmal davon. Es ist eine grüne Schlange, mit schlankem Hals und großem Kopf. Sie schlingt sich um das Geäst auf einem Busch und wir betrachten sie respektvoll. Kurz darauf treffen wir auf ein braunes Schlangentier. Jetzt kehren wir wieder um und suchen am Strand einen langen Knüppel. Mit dem schlagen wir bei unseren Streifzügen vor uns im Takt auf den Boden. So arrangieren wir uns mit den Schlangen und geben diesen Gelegenheit, sich vorher diskret zurückzuziehen.
Wir winken den Papageien zu aber die lärmen nur noch mehr. Als wir den Baum erreichen, flattern sie wie ein Schwarm Fledermäuse davon.
Auf dem Rückweg begegnen wir einer mittleren Abordnung der Köhlerkinder. Sie gehen zu siebent im Gänsemarsch zum Strand. Zu vorderst ein großes Mädchen, zuletzt ein noch ganz kleines. Das große Mädchen bekam vom Vater auf einem kehlig gehämmerten Blechdeckel eine Handvoll glösternde Holzkohlestücke aus seinem rauchenden Meiler. An einem Drahtbügel schwenkt sie nun an der Spitze der Prozession die rauchende Schale so, wie Hochwürden den Weihraucheimer beim Fronleichnahm-Ümgang. Nur so können sich die geplagten Kinder einigermaßen der Moskitos erwehren, die sie in dichten Myraden umschwirren. Die kleine Arbeitskolonne sucht nun am Strand das Treibholz zusammen, woraus ihr Vater die Holzkohle meilert, damit sie alle satt werden. Aus Balsaholz wird wahrscheinlich Holzkohle "light" gebrannt.
Wir schenken dem großen Mädchen die zwei Tüten Kindersachen.
Nach diesem ungleichen Kampf der Kinder gegen die erbarmungslosen Stechmücken, nehme ich mir fest vor, beim nächsten Inselbesuch den Kindern eine Schachtel mit 50 Flaschen Mückentötolin vom VEB Schiffsversorgung mitzubringen.
Aber dazu komme ich nicht mehr.
Matrose Kaiser hat eine Methode entwickelt, die roten Winkerkrabben zu überlisten. Wir kringeln uns vor Lachen. Er schleicht sich leise bis an die Grenze der Fluchtdistanz des riesigen Rudels. Dann peest er wie ein Besengter in das überraschte Rudel. Gelegentlich schafft es dann eine Krabbe nicht mehr bis zu ihrer Behausung. Dann stellt sie sich, als Manöver des letzten Augenblicks, auf die Hinterhufe und schwenkt ganz furchterregend drohend ihre eine gewaltige Schere. Matrose Kaiser haut ihr dann eine Handvoll Sand vor den Latz, das wirft sie um. Sie kommt zu den übrigen in den Eimer.
Er schwitzt und keult immer wieder keuchend auf die Krabben zu.
Auf dem großen Baumstamm vom Riesen machen wir Picknick. Es gibt unter anderem Bockwürstchen. Danach lege ich an einem stillen Ort eine Bockwurstschale zwischen besonders große Krabbenunterkünfte und verharre geduldig, wie die Katze vor dem Mauseloch. Zuerst taucht die große Schere auf, dann sondieren, wie ein U-Boot-Periskop, die Stielaugen die Umgebung. Aber die taugen anscheinend nicht viel. Die Nachbarn glotzen gleichsam aus ihren Höhlen. Jetzt beginnt am Strand von Ecuador der 'run' auf die Rostocker Bockwurst. Der zarte Saitling ist von hervorragender Festigkeit, er übersteht das verbissene Tauziehen der Krabben. Die verbiegen sich daran ihre Greifarme.
Schließlich gelingt es dem größten und verfressensten Alpha-Männchen das gefundene Fressen in seine Höhle zu zerren.
Die Flut setzt ein, der breite Strand wird schmaler. Die Krabben verrammeln von innen ganz sorgfältig ihre Unterkünfte. Jetzt hauen sie sich darin aufs Ohr und färben dann bei Ebbe den Strand wieder knallrot.
![]() Ich sprenge einen Hai
Ich sprenge einen Hai
Tanker "ZEITZ" liegt auf Warteposition im tropischen Gewässer.
Unser Schiff umkreisen die Haie.
Die Jungs an Deck basteln die wildesten Angel- und Fanggeräte.
Mein bester Kumpel an Bord ist Siggi Edel, der 3. Nautische Offizier. Wir kennen uns seit Jahren von vielen Reisen auf verschieden Schiffen. Jeder weiß von jedem alles. ZumPlauschen und Herz ausschütten bietet die Seefahrt, in Ermangelung anderer Attraktionen, reichlich Gelegenheit.
Siggi hat an dem warmen Tropenabend die Wache, wir stehen zusammen auf der Brückennock.
Die Gang unten auf dem Hauptdeck will Haie angeln. Zu diesem Zweck werden Sonnenbrenner über die Wasseroberfläche gehängt, unter deren Schein sich große und kleine Fische tummeln. Dwarslöpper (Taschenkrebse) lassen sich leicht mit nur einem Stück Wurst, am Faden auf die Wasserlinie herabgelassen, an Deck holen. Sie hauen gierig ihre gefräßige Schere in die Wurst und wollen diese nie wieder hergeben. Auf JOHN BRINCKMAN hakelte dann die Katze nach ihnen, bis sich einer an der Katzenpfote festklammerte, bis sie ihn, auf das Eisendeck donnernd, klappernd mühevoll wieder abschüttelt.
Der Storekeeper sammelt die solcherart "geangelten" Tiere in einer Blechpütz und kocht sie dann mit dem Schweißbrenner. Sie sind von geringem lukullischen Wert.
Keiner bekommt einen Hai die hohe Bordwand herauf.
(Damals, als ich zu See fuhr, hielt ich von Haien, wie die meisten Seeleute, nicht so viel.)
Ich plaudere an dem warmen Tropenabend mit Siggi auf der Nock. Er hört aufmerksam zu, während wir dem Treiben an Deck zuschauen, sage ich: "Ich sprenge einen Hai"!
Ich war als Bengel und später als überdurchschnittlich begabter Oberschüler der größte Pyromane der Warschauer Vertragsstaaten. Nach dem Krieg habe ich locker jede Flakgranate zerlegt. "Vorn mußt du anfangen", haben mich die großen Hitlerjungen gelehrt. "Vorn passiert gar nichts, hinten ist der Zünder, von dem mußt du wegbleiben." Ich brachte es bei dieser interessanten Freizeitbeschäftigung zur Perfektion. Wir warfen Gurte von SMG-Munni ins lodernde Kartoffelkrautfeuer und lauschten, in eine Furche gepreßt, den führungslos durch die Luft jaulenden Projektilen. Als die Munni durch übertriebenes Absammeln schließlich knapper wurde, stellten mein Kumpel und ich das Schwarzpulver selbst her. Schießpulver für Hobbyzwecke besteht aus Salpeter, Schwefel und Kohlenstoff. Schwefel gab es zu kaufen, den brauchte man auf dem Dorf zum Ausräuchern von Wildkaninchen oder Weinballons.
An feuchten Hauswänden und besonders auf unserem Donnerbalken wuchs prächtig der Mauersalpeter. Der funktionierte auch. Als Kohlenstoff diente Holzkohle. Lindenholz sollte laut meinem Rezept die besten Ergebnisse zeigen. Also sägte ich von der Dorflinde einen trockenen Ast, stopfte Holzsplitter davon in eine verschließbare Blechbüchse und diese in die Glut von Mutters Küchenherd. Nach zermürbendem Warten entstand so auch brauchbare Holzkohle. Diese verteilte ich noch heiß, meist juckig unter Zeitdruck stehend, auf einer Zeitung auf dem Küchentisch. Dann stampfte und walzte ich mit einer Flasche so lange darauf herum, bis sie schön pulverisiert war. Diese Methode brachte aber erhebliche Gewichtsverluste, denn ein hoher Prozentsatz meines benötigten Kohlenstoffs fand beim Nachhause kommen meine Mutter als schwarzen, noch warmen Niederschlag auf den Küchenmöbeln und besonders ins Auge stechend, auf dem einst weißen Lampenschirm über dem Küchentisch.
Mammi hielt nichts von antiautoritärer Erziehung. So knallte es doppelt, erst zu Hause und dann im Dorf mit dem frisch gemixten Schießpulver.
Heranwachsend genügte das recht harmlose Schießpulver nicht mehr unseren anspruchsvolleren Unternehmungen. Kaliumchlorat langt da, fachmännisch aufbereitet, schon anders hin und das benutzte Vater als "Wegerein"-haltendes Unkrautbekämpfungsmittel.
Mein Kumpel hing die damit Sprengstoff-chemisch getränkten, vollgesoffenen Löschblatt- und Zeitungsseiten über den ordentlich strahlenden Küchenherd auf, weil's halt auch wieder pressierte. Im thermischen Aufwind fiel ihm eine fast trockene Seite auf die glühende Herdplatte. Das war erst ein Gaudi!
Später kamen dann aus dem Chemielabor meiner Oberschule noch roter Phosphor und andere Raritäten hinzu. Selbstverständlich war ich engagiertes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Chemie der Adolf-Reichwein-Oberschule!
Ich hatte des öfteren eine Audienz bei unserem Abschnittsbevollmächtigten im Dorf, Gustav Tanneberg. Dem schwante bei dem dauernden Geschützdonner in seinem Revier ja zurecht etwas, aber greifbare Ermittlungserfolge waren damals schon eine Seltenheit.
Mein Freund Siggi hört auf der Brückennock an dem warmen Tropenabend meinen Jugendstreichen interessiert zu.
"Siggi"" sage ich zu ihm, "ich baue, wie in alten Zeiten, einen ordentlichen Knaller und sprenge einen Hai. Als Zünder feile ich den Glaskolben einer Taschenlampen-Birne durch und streue Blitz-Beutel-Magnesium auf den Wolframdraht. Das gibt den elektrischen Zünder für die Kaliumchlorat-Packung. Das ganze muß natürlich in einem "Pariser" wasserdicht und dann in eine handliche Roulade Hai-appetitlich gebettet werden. Angelleine sind 50 Meter Klingeldraht. Über eine Flachbatterie am Ende der Angelleine zünde ich den Knallfrosch, wenn ihn ein Hai beschnuppert. Wenn dem gerade das Wasser im Mund zusammenläuft und er das Ding abfaßt, fliegt ihm das Gulasch um die Kiemen. Bestimmt muß er dann zum Zahnarzt schwimmen. Aber Hai-Zähne wachsen ja nach!"
(Zu meiner heutigen eigenen und anderer Tierfreunde Beruhigung habe ich den Gedanken nicht verwirklicht.)
"So einen Knaller müßte man den Eierdieben und SED-Bonzen der Reederei gelegentlich in die Briefkästen stecken oder an ihr Auto backen. Vielleicht macht an Bord noch einer mit" habe ich da sinngemäß wohl auch noch gesagt, zu meinem damaligen besten Freund an Bord, dem III. Offizier Siegfried Edel; und der ist IMV des Ministeriums für Staatssicherheit, "inoffizieller Mitarbeiter mit vertraulichen Beziehungen"!
Wer stasimäßig einen solchen IMV wie Rotz am Ärmel kleben hat, steht völlig nackig und aus Glas vor der Staatsmacht.
IMV sind der eigene Ehegatte, Bruder, Schwester oder eben der beste Freund, so wie meiner. Eben jemand mit "vertraulichen Beziehungen"!
IMV, der fieseste Abschaum zwischenmenschlicher Beziehungen.
Der IMV "Willi Schomburg", so sein Deckname, berichtet haarklein, er vergißt auch nicht den letzten Pups zu erwähnen, der mir auf hoher See entfleucht.
Die Quelle, IM "Willi Schomburg", mein Freund Siegfried Edel, ringt sich zu der Erkenntnis und einer Sofortinformation an seinen Stasi-Hauptmann Jarosch durch, daß ich zu terroristischen Anschlägen gegenüber leitenden Funktionären neige und zu diesem Vorhaben nach seiner Meinung eine sogenannte "Rächergruppe" unter Offizieren der DDR-Handelsflotte rekrutiere.
Er schildert in seitenlangen Berichten seinem Brötchengeber - gegen Belohnung - mein Insider-Wissen, wie man einen ordentlichen Knaller mit dazugehörigem Zünder konzipiert.
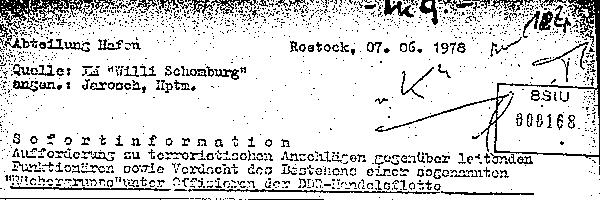
Ein gigantischer Stasi-Apparat setzt sich in Bewegung. Der Aufwand ist phänomenal!
Ich erhalte den Decknamen "Frequenz", werde zum "Objekt" erklärt und fortan auch an Land per "operativer Personenkontrolle" Tag und Nacht überwacht, ohne daß ich Depp das Geringste davon merke. Das liegt an meinem reinen Gewissen.
"Willi Schomburg" ruft mich bei meiner Lebensgefährtin während der Hafenliegezeit an und muß sich mit mir unbedingt um 10.00 Uhr am Alten Friedhof treffen.
Die Abteilung - 26 - der Stasi hört auch dieses Gespräch ab:
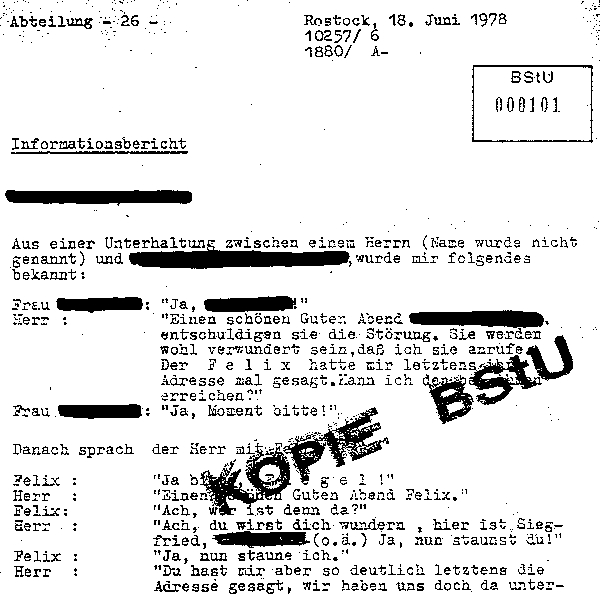
Ich Depp trete prompt um 10.00 Uhr am alten Friedhof bei Siggi an und die Stasi ist mit Richtmikrofon und Kamera vor Ort. Natürlich konspirativ!
10.05 Uhr Die Beobachtung wurde durch Absperren weitergeführt
weist der minuziöse Beobachtungsbericht aus.
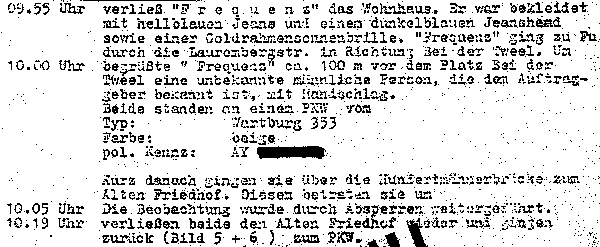
Ich bin zu so einer VIP avanciert, daß der ganze Friedhof gesperrt wird, damit nicht etwa eine laut trauernde Witwe die Aufnahmen vom Richtmikrofon unbrauchbar macht.
Tag und Nacht wird während der Hafenliegezeiten jetzt jeder meiner Schritte überwacht und akribisch festgehalten, operative Personenkontrolle heißt das.
Meine damalige Lebensgefährtin wird stasimäßig "Phase" getauft. Ihr Vater erhält den Namen "Pol". Ich heiße "Frequenz".
"Frequenz" und "Phase" fahren ins Grüne. Ist doch logisch, wenn man monatelang nur blau gesehen hat.
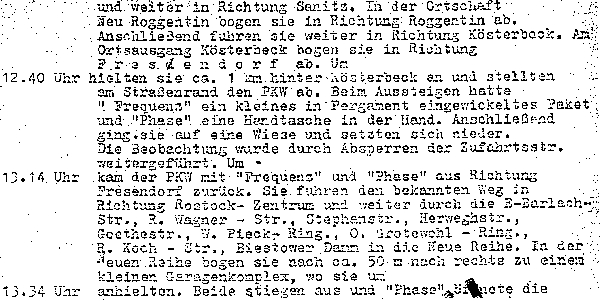
12.40 Uhr ... Anschließend gingen sie auf eine Wiese und setzten sich nieder. Die Beobachtung wurde durch Absperren der Zufahrtstr. weitergeführt.
Die Wiese von Kösterbeck ist riesig. Diese besucherfrei zu halten, stelle ich mir recht aufwendig vor. Nur gut, daß "Phase" und "Frequenz" durch die freundlicherweise geschaffene, idyllische Menschenleere dazu inspiriert, auf der Wiese den Stasi-Voyeuren nicht noch andere Leckerbissen boten. Dann hätten sich die Herren außer einem Auge auch noch einen Stehpuller geholt.
Die tagelangen Beobachtungen weisen auf die Minute genau aus, wann und wo wir oder ich in der Stadt ein Eis lecken. Wann im Haus das Licht aus- und morgens wieder angeht. Wer mit welcher Autonummer wann zu Besuch kommt. Wann ich den Mülleimer herausbringe.
"Frequenz" und "Phase" besuchen den Botanischen Garten.
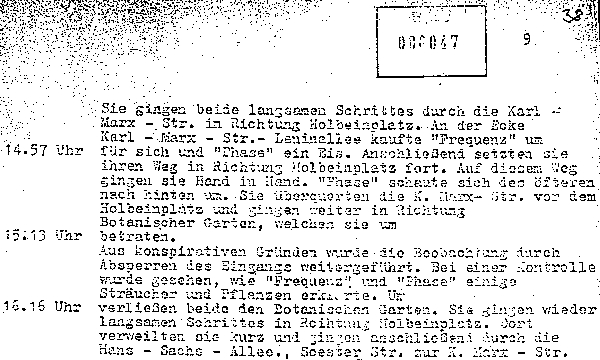
An der Ecke Karl-Marx-Str. – Leninallee kaufte "Frequenz" um
14.57 Uhr für sich und "Phase" ein Eis....... und gingen weiter in Richtung Botanischer Garten, welchen sie um
15.13 Uhr betraten. Aus konspirativen Gründen wurde die Beobachtung durch Absperren des Eingangs weitergeführt.
Ich bin jetzt so eine VIP, daß während meiner Anwesenheit der Rostocker Friedhof, der Botanische Garten und die riesige Wiese von Kösterbeck ausschließlich für mich und meine Begleitung freigehalten wird!
Mir fällt nichts auf.
Außer VIP bin ich auch Depp, eine Paarung die öfter vorkommt.
Zusätzlich zu dem getriebenen Aufwand wird lückenlos das Telefon von "Phase" abgehört. Die Abhör-Berichte der Abt. 26 sind sehr ausführlich und gewissenhaft angefertigt.
Konspirativ wird meine Garage durchsucht.
Der nimmermüde "Willi Schomburg" bringt die Genossen auf den Gedanken.
Die schriftliche Aufstellung der dort gelagerten Belanglosigkeiten ist akribisch und findet sich auch in den Stasiakten.
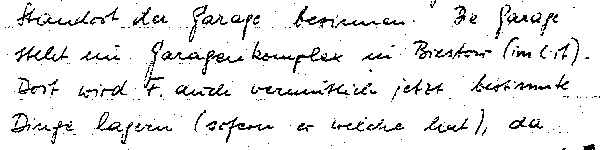
Da kein Sprengstoff gefunden wird, kommt konspirativ mein Wochenendhaus dran.
Zumindest an dem Tag geht das aber nicht so glatt:
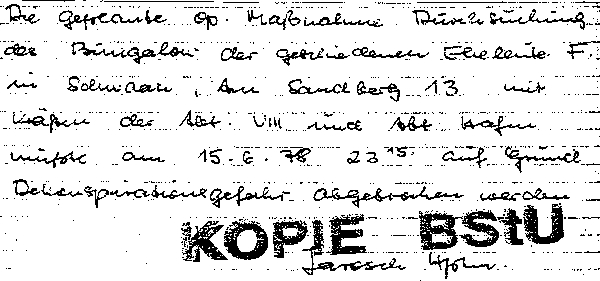
.... Durchsuchung des Bungalows .... mit Kräften der Abt. VIII und Abt. Hafen mußte... auf Grund Dekonspirationsgefahr abgebrochen werden
Wohl dem, wer Nachbarn hat, die eine "Dekonspirationsgefahr" darstellen.
Sicher haben die "Kräfte der Abt. VIII" das später erfolgreicher nachgeholt.
Jetzt erteilt Hptm. Jarosch auch den Befehl: "Vorbereitung konspirative Hausdurchsuchung"
Wie die "Kräfte der Abt. VIII und Abt. Hafen" damit dann zurecht gekommen sind, weiß ich nicht. Auch die Aufstellung des Inhalts meines Nachtschränkchens bleibt mir leider vorenthalten, denn an der Stelle schließt der eine vorhandene Aktendeckel bei der Gauck-Behörde. Zwei Jahre meiner paarunddreißig-jährigen Stasi-Betreuung hatten darin nur Platz. Der weit größere Teil meiner akribisch erfaßten Vergangenheitsdokumente hat wohl noch den Reißwolf erreicht.
Da nirgendwo weder meine "Rächergruppe" noch die staatsfeindliche Gruppierung aufgestöbert wird und der dazugehörige Sprengstoff auch verborgen bleibt, wird gegen mich ein Zollvergehen konstruiert.
Die Aktion ist so gewaltig, daß dazu ein Oberstleutnant das Zepter schwingt.
An diesen erging der :
Antrag auf Durchsuchung einer zielgerichteten Zollkontrolle des MS "Theodor Körner" während der Einklarierung des Schiffes am 17.6.1978 im Überseehafen Rostock durch Kräfte der Zollfahndung Rostock.....
...durch die Intensivkontrolle des Zolls bei der Einklarierung des MS "Theodor Körner" soll folgende Zielstellung erreicht werden:
- Feststellung von Schundmaterial bzw. Schriftmaterial mit staatsfeindlichem Charakter deren Besitzer,
- Feststellung eingeführter Waren und Gegenstände, deren Wert zuständige Valutageld übersteigt bei den Seeleuten,
- Erarbeitung belastenden Materials zu Funkoffizier Flegel bei evtl. Verstößen gegen Zollbestimmungen sowie die gesamten Offiziere.
THEODOR KÖRNER kommt aus der Werft Götheborg. Für die geplante Zollaktion wird das Schiff extra nach Wismar umgeleitet.
Ein Autobus voller MfS-Mitarbeiter in Zolluniform ergießt sich über das Schiff. Der Dampfer wird stundenlang nahezu zerlegt.
Befehlsgemäß erarbeiten die Genossen nun belastendes Material gegen mich.
Meine Kemenate und der Funkraum werden völlig links gemacht. Nur mit der Zerlegung des russischen Wetterkartenschreibers "Ladoga" kommen die Jungs nicht ganz klar. Am Hafentor wird nochmals jede Naht in meinen Kleidungsstücken umgekrempelt.
In meinem Schreibtisch liegen 4 US-$ und drei Kassetten Pop-Musik vom Klassenfeind. Beides nicht angemeldet. Das reicht!
Befehl erfolgreich ausgeführt. Belastendes Material "erarbeitet".
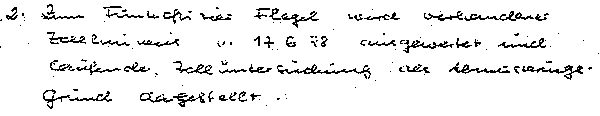
Zum Funkoffizier Flegel wird vorhandener Zollhinweis v. 17.6.78 ausgewertet und laufende Zolluntersuchung als Abmusterungsgrund dargestellt.
folgt jetzt als entsprechende Maßnahme gegen mich.
Jetzt darf ich wieder ganz lange Urlaub machen und danach als Arbeitskräftelenker in der Verwaltung der Reederei als Landei abgammeln. Natürlich stasimäßig bestens umsorgt.
Mein Kumpel Siegfried Edel alias "Willi Schomburg" fährt nun auch nicht zur See. Er ist Hafenspringer und läuft mir aller Nase lang über den Weg und ich gebe ihm noch dauernde ein Bier aus. Während er weiterhin tief in mich hinein leuchtet.
Nach zwei Jahren und wahrscheinlich mit Millionen-Aufwand haben sich aber die verdeckten Ermittler dann doch zu der Erkenntnis durchgerungen, daß ich ernsthaft weder SED-Bonzen noch Haie sprengen will. Hätten die "Kräfte der Abt. VIII" auf ihren konspirativen Streifzügen durch meine Privatsphäre auch nur ein Krümelchen Wegerein, Phosphor, Salpeter oder auch nur 10 Pakete Streichholzkuppen gefunden, hätte ich gewiß im Bautzener Strafvollzug Schimmel angesetzt, dank meines guten Freundes, dem IMV-Fiesling Siegfried Edel.
Ich fahre wieder glücklich auf das weite Meer hinaus.
Nur zwei Jahre meines klassenfeindlichen DDR-Daseins sind gauckbehördlich noch vorhanden. In den äußerst miserablen Kopien ist noch ein Drittel von der Behörde geschwärzt. Die zwei Jahre füllen einen dicken LEITZ-Ordner.
Mir laufen beim Lesen Schauer über den Rücken. Dreizehn IM, IMS, IMK hängen allein in diesem kurzen Zeitraum an mir dran, kleben wie Rotz am Ärmel.
Der "IMS" (inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit) "Erwin" hier auf THEODOR KÖRNER ist aber fast ein Netter. Anbei auszugsweise sein proktologischer Bordbericht:
Er hat zur gesamten Besatzung ein gutes Verhältnis gleichermaßen zu Offizieren und Mannschaften und ist als Kumpel beliebt.
F. wird als real denkender Mensch eingeschätzt, der ohne Scheuklappen die Verhältnisse in der DDR und an Bord sieht. Er sagt diesbezüglich offen seine Meinung und würde den Kapitän und den Politoffizier Stoff geben, d. h. gegen die offizielle Bordlinie angehen. Dies würde von der Mannschaft an F. besonders geachtet. So z. B. trat F. bei einer Versammlung aller Nichtparteimitglieder zur Frage "Schiff der sozialistischen Arbeit" auf und hatte kritische Hinweise zu......
Bei Besuchen im Funkraum des F. ergaben sich keine Feststellungen besonderer Art. Weltliteratur wurde nicht festgestellt
F. betreibt regelmäßig Kraftsport und hält sich körperlich fit.
Feststellungen auf Streit und Auseinandersetzungen des F. mit Besatzungsangehörigen ergaben sich nicht.
Zum Landgangsverhalten des F. wurden keine Besonderheiten wie Kontakte, Schmuggel, Verbindungen bekannt. Er geht meistens mit mehreren Seeleuten an Land.
So erledigt der IMS "Erwin" in seinem 3 Seiten Bericht den Auftrag seines Herren und bessert solcherart seine Heuer mit dem Judaslohn der Stasi auf. Diesen Zusatzverdienst gönnten sich alleine zu meiner Person nur im erfaßten Zeitraum von zwei Jahren 12 weitere inoffizielle Mitarbeiter.
Aber auch an Land werde ich von den Genossen des Ministeriums für Staatssicherheit bestens umsorgt. In einem 17-Seiten-Bericht(!) weiß Utln. Richter u.a. folgendes von mir zu berichten:
Wegen der schlechten Lesbarkeit der Gauckschen Kopien hier die Abschrift der ersten beiden Seiten des 17-Seiten-Werkes.
Zu Staatsfeiertagen und anderen politischen Ereignissen erfolgt eine Beflaggung der Wohnung. Sendungen des BRD-Fernsehens werden bei der Familie nicht empfangen.
Wenn F. zu Hause weilt, so beteiligt er sich an den Maßnahmen der Hausgemeinschaft. Diese belaufen sich nur auf Pflegearbeiten am Haus.
F. wurde in charakterlicher Hinsicht als ruhig, ausgeglichen und aufgeschlossen eingeschätzt. Im Haus tritt er stets höflich und freundlich auf und ist zu Hilfeleistungen bereit. Dadurch genießt F. einen guten Ruf.
F. führt einen sauberen moralischen Lebenswandel. Er nimmt keine übermäßigen alkoholischen Getränke zu sich und verhält sich gegenüber weiblichen Personen korrekt. Außereheliche Beziehungen unterhält er nicht.
F. verbringt seine Freizeit überwiegend im Kreise der Familie. Er besitzt handwerkliche Fähigkeiten und führt Bastelarbeiten und Reparaturen in der Wohnung selbst durch. Mit seinen Kenntnissen auf diesem Gebiet unterstützt er auch andere Hausbewohner.
- 3 -
Das eheliche Zusammenleben beider Ehepartner verläuft harmonisch. Zwischen den Ehepartnern sind keine Streitigkeiten bekannt. F., Karl-Heinz unterstützt seine Ehefrau bei der Erledigung der Hausarbeit und beteiligt sich seinen Möglichkeiten entsprechend an der Erziehung der Kinder.
Aus der Ehe gingen 4 Kinder hervor.
Die Kinder gelten als gut erzogen und treten im Haus höflich auf. In der Schule zeigen sie gute bis sehr gute Leistungen. Unter ihnen registrierten die Quellen keine Streitigkeiten. Das familiäre Zusammenleben verläuft in geordneten Bahnen. Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Familie F. werden stets in ruhigem Ton beglichen. Wenn F., Karl-Heinz zu Hause ist, unternimmt die Familie F. gemeinsame Ausflüge mit dem PKW.
Die finanzielle Lage der Familie F. ist gut. An größerem materiellem Besitz ist eine moderne Wohnungseinrichtung, ein PKW vom Typ "Polski-Fiat" und ein Bungalow in Schwaan bekannt. Familie F. führt einen durchschnittlichen Lebensstandard. Alle Familienangehörigen gehen sauber und ordentlich gekleidet. Die Kinder erhalten ein angemessenes Taschengeld.
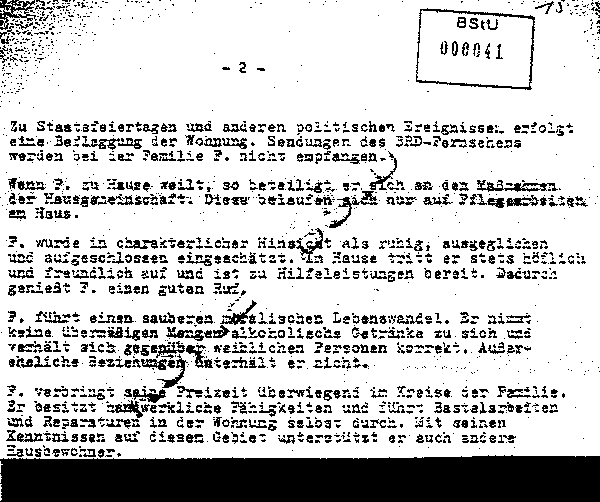
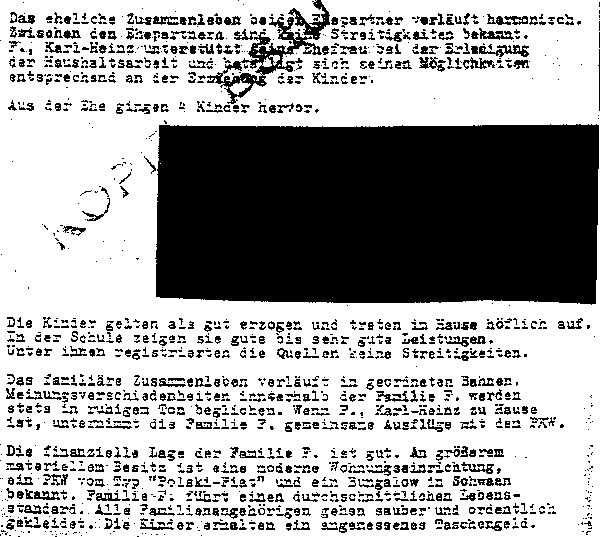
Diese Details hat der Ultn. Richter der Bezirksverwaltung des MINISTERRATES DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK, Ministerium für Staatssicherheit in seiner 17 Seiten umfassenden Fleißarbeit zusammengetragen. Welch ein Aufwand! Das Schild und Schwert der Partei war wohl die größte Beschäftigungsgesellschaft des Arbeiter- und Bauernstaates.
Obwohl mich der Ultn. Richter als reinsten Musterknaben erscheinen läßt, geben meine Betreuer vom MfS keine Ruhe. Nach ein paar erholsamen Seereisen haben sie mich schon wieder am Schlawittchen.
![]() Dabei tue ich mein Möglichstes
Dabei tue ich mein Möglichstes
Nach dem Verlassen von Puerto Bolivar empfange ich an der Küste Ecuadors vor Santa Elena auf der Notfrequenz 500 KHz ein SOS. Die Lautstärke ist gerade noch verwertbar. Ich vermute den Dampfer JWD, schreibe aber mit:
MS GLENN PARVA benötigt dringend ärztliche Hilfe. Einem Mann auf dem Schiff hat es beide Beine abgerissen: "both legs cut off" schreibe ich im Funktagebuch mit.
Der Wach-Offizier schaut wegen der Position in die Seekarte. Das Schiff steht nur 60 Meilen entfernt. Der Kollege muß wegen der äußerst mickrigen Lautstärke in der Aufregung einen Fehler gemacht haben. Es beantwortet auch kein Schiff diesen Notruf.
Ich wuchte meinen starken Sender an. Münze sein MAYDAY in ein PAN PAN PAN um, da für das MAYDAY kein triftiger Grund vorhanden ist und haue seine Meldung mit großer Lautstärke vertretungsweise für GLENN PARVA noch einmal hinaus.
Bei Guayaquil-Radio müßten die Antennenmasten zittern, aber leider: no reaction! Einige Schiffe im Seegebiet äußern ihre Betroffenheit, aber ärztliche Assistenz kann keiner bieten.
Kapitän Laasch schaut in die Seekarte. Inzwischen habe ich eine Grenzwellen-Sprechverbindung zu den Unglücksraben. Ich telefoniere mit dem Kapitän, er scheint sehr aufgeregt und spricht ein spanisch akzentuiertes Englisch. Kapitän Laasch gibt seinem Kollegen nun den Rat, den Hafen Manta anzulaufen. Dafür fehlt dem Schiff die entsprechende Seekarte. "Wir helfen ihnen" beruhigen wir den aufgeregten Mann am anderen Ende unserer Verbindung. Der WO hat die Revierkarte von Manta herausgesucht. Wir breiten sie im Funkraum auf dem Fußboden aus.
Kapitän Laasch trägt die Position der GLENN PARVA nun in seine Karte, informiert sich über die Wassertiefen und Hindernisse und sagt dem Hilfsbedürftigen die Kurse rüber, die sein Schiff gefahrlos nach Manta bringen. Inzwischen habe ich nun auch auf dem UKW-Kanal 16 mit PAN PAN PAN riesigen Alarm geschlagen und das Hilfeersuchen an alle Funkstationen Ecuadors gerichtet. Völlig überraschend meldet sich nun ein Ölterminal querab an der Küste, 50 Meilen südlich von Manta. Dem Kameraden schildere ich nun die Situation mit der Bitte, den Hafen von Manta zu mobilisieren, um dem Schiff ein Boot oder einen Heli entgegenzuschicken, Krankentransport, Notarzt und OP bereit zu halten. "I will do my best" verspricht der einzige Ecuadorianer, der von dem Drama im Küstengewässer des Landes nun Kenntnis hat, obwohl ich auf drei Notfrequenzen mehrfach die Meldung ausgestrahlt habe.
GLENN PARVA hat mittlerweile die Hafenbefeuerung in Sichtweite. Dort rührt sich nichts. Der Mann vom Ölterminal erklärt nochmals nach meinem Anruf, telefonisch in Manta entsprechend informiert zu haben.
Ich rate dem GLENN PARVA-Kapitän seinen Vorrat an roten Raketen gen Manta abzufeuern.
Kapitän Laasch leitet im Blindflug seinen Kollegen mit den Daten der Revierkarte bis dicht vor die Mole von Manta.
Unsere Hilfsmöglichkeiten sind nun ausgeschöpft, wir laufen in der Weiterfahrt aus der Funkreichweite des schwachbrüstigen Senders.
MS GLENN PARVA ist in allen uns zugängigen Schiffsregistern und Nachschlagewerken nicht aufgeführt, aber letztendlich ist das auch nicht so wichtig.
In wieweit wir mit unserem Engagement einen Beitrag für das Überleben des verunglückten Seemanns leisten konnten, bleibt uns verborgen.
![]() Die letzten Seemeilen
Die letzten Seemeilen
Mein Vater allerdings ist zu Hause gestorben. Ich empfange Mutters Telegramm und spreche mir selbst mein Beileid aus. Ansonsten übergebe ich solche Telegramme dem Kapitän, der die traurige Aufgabe dann übernimmt.
Eine medizinische Betreuung vor seinem Tod wurde meinem Vater verwehrt.
Nach einem Hirnschlag kam der Krankenwagen nach zweieinhalb Tagen. Er klapperte mit dem Hilfsbedürftigen sämtliche Krankenhäuser im Bezirk Halle ab. Keines nahm den geistig Umnachteten auf. Wieder zu Hause, starb er dann und erlöste sich und meine völlig überforderte Mutter von dem schrecklichen Schicksal.
Während der Hafenliegezeit besuche ich meine Mutter in ihrem Dorf bei Halle. Sie möchte alleine, so mäßig umsorgt nicht bleiben. Ein Altersheimplatz wird ihr erst in etwa fünfzig Jahren in Aussicht gestellt, der Zuzug nach Rostock, um den ich mich nebst einer Wohnung bemühe, wird im Rathaus verwehrt.
Sie spielt mit dem Gedanken, nach Bayern auszureisen. Meine Schwester lebt dort seit 1953.
Nach zweijähriger Wartezeit gönnt mir Obdachlosen die AWG Schiffahrt-Hafen wieder eine Einraumwohnung. Mittlerweile habe ich mich mit Oberstewardeß Sandra zusammengeschmissen.
Nach einigen getrennten Reisen fahren wir zusammen jetzt nach Mocambique, nach Maputo und zum Limpopo nach Beira. Vom Fluß Limpopo gefällt mir nur der Name.
Das Schiff geht ausreisend unter Ladung bei offenem Suez-Kanal um das Kap der guten Hoffnung. Diese Reiseroute wird immer dann vorgeschrieben, wenn das Schiff "grüne Kisten" geladen hat. Darin sind zwar nur 'Safety Matches', Jagdmunition, Tischfeuerwerk oder Knallerbschen. Ganz harmlose Sachen eigentlich, aber es erscheint doch zweckmäßiger, im Suez-Kanal niemanden in die Kisten schauen zu lassen oder Ladungspapiere vorzulegen.
Die Frelimo und die vielen anderen marodierenden "Freiheitsbewegungen" schießen ja nur mit Blasrohren und Fensterkitt. Schalck-Golotkowski liefert dafür den Kitt, den wir jetzt anscheinend konspirativ transportieren.
In Mocambique liegt der Sassnitzer Fischdampfer MALANGEN. Für die Jungens haben wir Bier in der Kühlluke mitgebracht. Sie kommen bei uns längsseits und holen sich die vierhundert Kisten "Hafenbräu" ab. Das sind angenehme Kumpel, wir pflegen den kleinen Grenzverkehr.
Die MALANGEN fängt auf 400 Meter Wassertiefe Shrimps. Im Gegensatz zu den Schlammbeizgern, aus dem Reriker Haff oder dem Nordsee-Watt, sind diese großen Tiefseegarnelen von hervorragendem Geschmack. Der Koch der MALANGEN kann damit klassisch umgehen, mit Curry zubereitet, sind seine vor kurzem noch zappelnden Shrimps das Erlebnis!
Sandra und ich sitzen beim Funkoffizier mit dem Chiefmate und dem Second zusammen und zischen einen. Die lustigen Gesellen hauen uns Fisher-man-mäßig die Taschen voll.
Möwen verscheißern ist in diesen Kreisen eine verbreitete Freizeitgestaltung. Wir werden ausführlich in dieses uns fremde Sachgebiet eingewiesen:
"Mußt mal zwei Makrelen mit zwei Metern Schiemanns-Garn zusammenbändseln und außenbords werfen. Da gieren sich garantiert zwei doofe Auguste drauf und versuchen danach im Parallelflug sich gegenseitig den verschluckten Fisch wieder aus dem Schlunks zu zerren", ist die erste Empfehlung.
"Oder", fällt der nächste Veranstalter ein, "du bläst einen Pariser auf. Bindest einen handlichen Fisch mit einem Meter Garn daran. Das wirfst du außenbords. Das sieht auf dem Fangplatz ganz lustig aus, wenn ein doofer August mit einem aufgepusteten Pariser im Schlepp seine Törns dreht."
"Manchmal fliegt zwischen dem ganzen Möwenpulk auch hin und wieder ein Papagei. Da hat sich dann einer mit der Augustpeitsche einen August gefangen und den papageimäßig angepönt. Schön bunt, mit rotem Kopf, blauem Stert und grünen Flügeln oder so."
"Was ist denn eine Augustpeitsche?" fragt Sandra: Man erklärt ihr sofort ganz ausführlich die Anfertigung einer Augustpeitsche, falls sie sich demnächst auch mit einer solchen am Möwenfang beteiligen möchte: "Also, du nimmst einen Besenstiel oder einen von der Farbrolle und bindest daran als Peitsche so ca. drei bis vier Meter Schiemannsgarn. An dem Ende von dem Bändsel befestigst du eine schwere Mutter, oder einen Bolzen oder eben was Schweres. Wenn die Auguste im Aufwind vor der Brückennock stehen, weil sie so vollgefressen sowieso zu faul sind zum Flattern, schleuderst du deine Peitschenschnur einen vor den Latz. Das beschwerte Ende der Schnur nuddelt sich dann um den Vogel und du brauchst ihn nur noch an Deck holen!" "Ach, ich glaube nicht, daß ich mich am Möwenfang begeistern könnte" meint Sandra, "außerdem umschwirren die Möwen unser Fruchtschiff ja nicht so, wie euch Fischer."
Der Chiefmate ist der perfekte Ornithologe: "Wenn du einen vollgefressenen August an Deck stellst, kann der nicht wieder starten. Er braucht beim Start von einem Wellenkamm den Aufwind unter den Flügeln. Wenn er an Deck steht, kotzt er sich vollkommen aus, um mit geringerem Startgewicht davonzukommen. Ich hab mal meinem Second vier vollgefressene doofe Auguste in die Kammer gesetzt, weil er mich angeschissen hatte. Nach seiner Wache konnten die Viecher in der Kammer sogar fliegen, da kam aber Freude auf."
Der Funkoffizier ist Tierfreund. "Ich mache so etwas ja nicht, aber einmal, muß ich zu meiner Schande gestehen, habe ich einen August auch geschmückt. Ich habe an einem zehn Meter langen Lochstreifen vom Funkfernschreiber eine Schlaufe geklebt und den langen gelben Papierstreifen einem August um den Hals gehängt und ihn damit losfliegen lassen.
Was denkst du, wie der damit auf dem Fangplatz angegeben hat.
Immer nach zwei Flügelschlägen hat er sich erst einmal umgedreht, ob das Ding auch wirklich noch dranhängt."
![]() Jetzt kommt die ganz heiße Phase
Jetzt kommt die ganz heiße Phase
Nachdem wir in Rostock festgemacht haben, muß ich schon wieder mein Seefahrtsbuch abgeben.
Meine Mutter ist von dem würdelosen Ableben meines Vaters nachhaltig mitgenommen. Mit 77 Jahren hat sie einen Ausreiseantrag gestellt. Sie hätte auch besuchsweise bei meiner Schwester in Bayern bleiben können. Sie macht es korrekt, in der Hoffnung, die Stasi wird mich in Rostock verschonen.
Sie verschont nicht!
Mich trifft die Sippenhaft der Diktatoren des Proletariats!
Jetzt bin ich wieder Landei, Reparaturinspektor der Reederei. Sandra fährt auf das weite Meer hinaus, ich muß an der Pier zurück bleiben. Obwohl mein Berufskollege bei ihr an Bord sich furchtbar gerne von mir in Urlaub schicken ließe! Aber er bekommt keinen. Keine Leute, keine Leute!
Sandras ZWICKAU läuft ein und nach drei Tagen wieder aus, nach Lulea/Schweden. Ich bin bei ihr an Bord mit meinem Dienstausweis. Der Dampfer gehört ohnehin zu meinem Reparaturbereich. Mein Dienstausweis ist an der Gangway abgegeben, mein Besuch im Besucherbuch vom Gangwayposten eingetragen. Ein seegehendes Schiff ist Grenzsperrgebiet, höchster Sicherheitsstandard.
Ich warte vor dem Auslaufen des Schiffes auf die übliche Durchsage: Besucher von Bord. Die Aufforderung kommt nicht, aber es kommt die Ausklarierung:
"Jetzt wird´s aber Zeit", sagt ein Genosse, der leider nichts zu sagen hatte. Ich schnappe meine Lederjacke, Schuhe habe ich schon lange an. Küßchen, "gute Reise", weg bin ich, komme aber nur bis zur Gangway. Die Kiste für die Besucherscheine hat der Gangway-Posten beim Seeklarmachen schon weggestaut, samt meines Dienstausweises.
Wäre ich bloß weitergelaufen und hätte auf mein Ausweisdokument verzichtet. Bis der triefige Wachmatrose mein Dokument wieder hervor mölt, bin ich von einem höheren Genossen Dienstgrad verhaftet. Später werde ich abtransportiert.
Ein Rolltor fährt beiseite, von Stahlhelm und Kalaschnikow bedient. "Steigen sie aus"!
Von der Vorderfassade her kenne ich den monströsen Bau: Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksdirektion Rostock. Ein Einblick in den Hinterhof, hinter dem eisernen Rolltor, war bisher nur Auserwählten vergönnt.
Die Autonummern der auf dem Hof parkenden Fahrzeuge sind verklebt.
"Gehen sie links, gerade, rechts. Halt!" Ich stehe vor einem Eisengitter. Wer oder wie viel hinter mir gehen, weiß ich nicht. Die Gittertür öffnet sich von Geisterhand. Kameras an den Wänden und gespannte Drähte. "Treppe hoch, hoch, links, gerade. Tür öffnen!"
"Nehmen sie Platz". Jetzt ist auch einer vor mir, in einem spärlich dekorierten Raum.
"Wo sie jetzt gelandet sind, wissen sie ja sicherlich" fragt der am Sprelacard-Tisch gegenüber. Er trägt Schlips und rote Haare.
Ich weiß, das Gebäude ist ja nun wirklich nicht zu tarnen und kann mir auch erklären warum. Schließlich kenne ich die hochbrisante Seegrenze der Deutschen Demokratischen
Republik und weiß auch, mit welchen Kanonen auf derartige Vaterlandsverräter geschossen wird.
"Versuchte Republikflucht" dröhnt es mir als Klassenfeind auch schon entgegen!
Das Gequassel ist endlos. Es ist Sonntag nach Mitternacht: "Wir werden das überprüfen". Tod und Teufel wird überprüft, am Sonntag in der Frühe. Wie macht der Typ das bloß, geht mir dauernd durch den Kopf. Jahrelang zurückliegende alte Kamellen werden aufgewärmt. Der Besitz von 4 US-Dollar, ohne entsprechenden Nachweis und 3 vom Zoll vor 3 Jahren gefundene Tonbandkassetten. Was der alles weiß, alles das belastet mich.
Wenn ich endlich ein Geständnis ablege, erleichtert das meine Lage, wird mir ständig wärmstens empfohlen.
Ich möchte schon meine Lage erleichtern, entgegne ich, denn ich muß kacken.
Eine für diese Aufgaben ausgebildete Begleitperson erscheint. "Gehen sie links, rechts, halt!" Ich erleichtere mich und gucke ihm dabei auf das Koppelschloß mit dem Zirkel und Ährenkranz und seine Selbstverteidigungsmittel, die er elegant am Koppel trägt.
Die Fronten verhärten sich, auch mein genabel zurückbehaltener Stuhl. Ich soll endlich etwas gestehen, verlangt der Andere von mir. Ich weiß aber nicht was. "Na gut", die Toilettenaufsicht erscheint wieder: "Gehen sie links, nach unten, halt". Eisentür. "Rechts, nach unten, nach unten." Da unten ist wieder ein Anderer. Leutemangel haben die nicht, sonntagfrüh um vier. "Taschen entleeren, Armbanduhr abgeben, ausziehen, alles!" Meine Ranger-Ausrüstung wird gewissenhaft erfaßt und kommt in eine Tüte.
Ein Taschentuch
Fahrerlaubnis, Autopapiere
Ein Taschenmesser
Auto- und Wohnungsschlüssel
Ein Röhrchen Natrontabletten
Eine Armbanduhr, Marke UMF
Brieftasche: Inhalt 32,57 Mark der Deutschen Notenbank der DDR
"Einweisung in die UHA" lese ich auf der Kladde, in der meine mitgeführten Reichtümer gewissenhaft aufgelistet werden. Als ich den letzten Socken ausziehe, komme ich drauf: "Untersuchungs-Haft-Anstalt". In meiner Blöße auf dem kalten Linoleum wird es mir zunehmend mulmiger. Machen die hier eine Übung mit mir, bin ich bei versteckter Kamera, Außenseiter-Spitzenreiter. Ich verstehe die Welt nicht mehr, den Genossen aber schon: " Hände vor - Finger spreizen - Zehen spreizen (kann ich nicht) - Mund auf - Zunge raus - Vorhaut zurück - Bücken - Gesäßbacken auseinander!" Der Genosse Proktologe nimmt im Schein seiner gebündelten Taschenlampe ein sachkundiges Auge und leuchtet auch sonst noch in alle Nischen meines Alabasterkörpers.
Es klingelt das Telefon, murmelnde Kommunikation. "Anziehen! Gehen sie links, nach oben, nach oben, Gittertür, nach oben, rechts."
Der Rothaarige mit dem Schlips bekniet mich weiter. Zwei Stunden Pause, zwei Wurststullen, Kaffee, leider ohne alles.
Danach beginnt das Verhör wieder und mein Sodbrennen. Ich bitte um meine eingetüteten Natron-Tabletten. Der Toiletten-Aufsichts-Genosse bringt auf einem Porzellanlöffel eine "Simagel". Die wirkt bei mir nur 10 Minuten.
Das Verhör dauert aber noch erheblich länger, aber immer wieder mit Pausen.
Die ein- oder andere Aussage läßt sich nicht nachprüfen, das Schiff ist bereits auf See. "Bis ihre Oberstewardeß zurückkommt, behalten wir sie sowieso hier".
Der andere wird zunehmend fies, ich merke, der will mich einlochen.
Ich halte mein Plädoyer: "20 Jahre fahre ich zur See und kenne die Schiffe unserer Flotte und alle ihre Winkel. Ihre ausklarierenden Genossen treffen mich aufbruchbereit in der Kammer der Oberstewardeß und nicht etwa versteckt. Jedermann wußte, daß ich an Bord bin. Ich habe meinen Dienstausweis abgegeben und bin im Besucherbuch registriert. Das hätte ich als Insider wirklich locker umgehen können. Ich will ausbüchsen und nehme 32,57 Mark und ein Röhrchen Natrontabletten mit? Keine Ausweise, Zeugnisse, Dokumente? Vor dem Hafentor steht mein "Polski Fiat" für vierundzwanzigtausend Mark. Schätzen sie mich für so dusselig ein?"
Wieder Pause. Ich frage nach der Uhrzeit, meine Armbanduhr ist eingetütet. Der Raum hat keine Fenster. Mir kommt alles eine Ewigkeit vor.
"Mitkommen, links, nach unten, halt." Ich werde in einen Raum gebracht, den ich dem kalten kargen Gemäuer nicht zugetraut hätte, richtig kuschelig. Schrankwand, Couch und Sessel, Blumenbank mit Grünpflanzen in Erde.
Ein Bild von Honni, Mielke oder so einem anderen Schild und Schwert der Partei an der Wand.
Sandra wird hereingebracht, man läßt uns allein.
"Ich denke du bist in Lulea"? staune ich los. Ehe wir uns in die Arme fallen, fällt uns etwas anderes ein: Die Bude ist verwanzt, daher die kuschelige Ausstattung, für Mikros und Kameras. Statt Sandra, drücke ich Ruhe gebietend den Finger auf die Lippen und Sandra mich auch nicht etwa ans Herz sondern beiseite. Sie kniet, wie Ali Achmed zum Freitagsgebet vor der Blumenbank nieder und wühlt dort im humösen Substrat. 120 Westmark steckt sie mit verdreckten Fingern schnell in den BH.
Nach meinem Abtransport von Bord, mußte auch sie schnellstens und nur das Dringlichste zusammenpacken, Seefahrtsbuch, DPA, Haustürschlüssel und Zahnbürste. Der Rest ihrer Habe bleibt an Bord und fährt mit nach Lulea. 120 DM-West sind unsere stille, nicht angemeldete Reserve und ein DDR-Vermögen!
Aus der Sicht des Zolls: Devisenschmuggel!
Sandra folgt im Stasi-Lada unauffällig meiner Spur und nimmt die geschmuggelten Devisen mit von Bord und in das gemütliche Zimmer, in dem man uns jetzt nach den getrennten Verhören zu unserer Verblüffung zusammengeführt hat. Hier vergrub sie schnell die "wertvollen Valuta", wie diese in der devisengeilen DDR genannt werden. Sie hatte vor 13 Stunden dafür überhaupt nur Gelegenheit, weil für sie eine weibliche Stasi-Prokto-und Gynäkologin in der Nacht erst ranbesorgt werden mußte. Ich hatte keine Wartezeit, männliche diensthabende Arschgucker waren genügend vor Ort.
Nach dem Eintreffen der Trude wird Sandra ebenfalls in sämtliche Körperöffnungen geleuchtet, noch einer mehr als bei mir.
Hätte die Stasi-Ziege dabei die 120 DM gefunden, hätten wir wohl eine Weile als Logiergäste den Service des gastfreundlichen Hauses genießen dürfen; den fanden wir aber als Stundenhotel schon bescheiden.
Die vielen Pausen in den Verhören dienen zum Vergleich unserer Aussagen, die sich natürlich völlig decken. Der Gedanke einer so dilettantisch geplanten Republik-Flucht ist doch noch bescheuerter als die Stasi selbst.
Sandra erbringt demzufolge im Verhör auch nicht die gewünschten Ergebnisse. Sie wird daher im Keller erst einmal ein wenig eingelocht. Im Stockfinstern stehend, mit Händen an der Hosennaht, mehr Bewegungsfreiheit bietet der "Raum" nicht. Eine Stunde, fünf, oder zehn? In dem Bau gibt es kein Zeitmaß und keine Fenster mit Mond- oder Sonnenschein. Auch ihre eigene Uhr ist in der Tüte.
Jetzt ist aber erst einmal das Geld wieder im BH.
Das Reinwaschen ihrer zwar nur humös beschmutzten Finger ist das gegenwärtige Problem. Taschentücher sind auch abgegeben in der Tüte. Während sich Sandra verzweifelt um ihre Fingerreinigung müht, entfalte ich den Ehrgeiz, wenigstens eins von den konspirativen Überwachungsmitteln zu entdecken. Ich vermute sie hinter dem Pokerface vom überlegen lächelnden Schild und Schwert der Partei.
"Wenn die von draußen zugucken, ist Sandras Putzfimmel ohnehin für die Katz" denke ich.
Da geht die Tür auf!
Unsere Tüten werden hereingebracht. Sandra wird mit meinem Sparringspartner bekannt gemacht, ich lerne ihren kennen. Beides herrliche Menschen.
"Nehmen sie Platz". Schreibgerät wird ausgeteilt, na besser als Handschellen denke ich. Kleines Protoköllchen noch, nur Formsache! "Ich diktiere, sie schreiben!" Sandras Interviewer diktiert: Keinerlei Forderungen, Interhotel-mäßige Behandlung, keine prozesssualen Maßnahmen. "Prozessual mit drei "S" oder wie?!" frage ich "So ähnlich reicht", meinen die Genossen.
Das wär's dann. Sandras Schleimi verkneift sich gerade noch einen Handkuß. "Können wir nun weiter zur See fahren?" frage ich. "Von uns werden sie nur nach Hause gefahren" war darauf die Antwort. "Ich muß zum Hafen, dort steht mein Auto" lehne ich das Angebot ab. "Sie fahren jetzt nach Hause, sie können selbst nicht Autofahren" bestimmt mein "Betreuer". Der Psychologe kennt genau die Wirkung seines 13-stündigen Psychoterrors, der machte das nicht zum ersten Mal.
Er hat recht und ganze Arbeit geleistet. Sandra und ich sind fix und fertig. "Gehen sie links, gerade, rechts, nach unten, halt!" Eine Tür, Sprelacard, wie jede andere in dem langen Gang: "Öffnen"!, wir stehen im hellen Sonnenlicht vor dem blauen "Lada" mit Fahrer.
"Auf Wiedersehen" sagen zwei Morskieker hinter uns auch noch.
Ich gehe nach dem versuchten Ausschlafen am nächsten Tag zum Arzt, mein nervöser Magen spielt total verrückt.
Sandra kauft von dem ausgegrabenen Geld eine "Schatz-Uhr" im Intershop.
Jede Umdrehung des Pendels hat für uns symbolische Bedeutung.
![]() Das bittere Ende
Das bittere Ende
Mein Seefahrtsbuch wird eingezogen und um mein Seefunkzeugnis I. Klasse brauche ich mir gleichfalls keine Gedanken zu machen, es verliert automatisch seine Gültigkeit, wenn ich innerhalb von 5 Jahren nicht zwei Jahre praktischen Funkdienst nachweisen kann. Ich bekäme mit meiner Stasiakte jetzt nicht einmal eine Lizenz für den Taxifunk oder ein funkgesteuertes Spielzeugauto. Denn auch Funkwellen sind grenzüberschreitend und benötigen einen Sichtvermerk.
Ich bin mit meinem Beruf total erledigt.
Auch Sandra wird zur Reederei bestellt. "Sagen sie sich von Herrn Flegel los, sonst ist für sie auch Schluß" bestimmt die Kaderleiterin als IM der Stasi.
Sandra gibt ihr Seefahrtsbuch ab. Sie bleibt mit mir an Land und ist jetzt meine Frau.
Ich habe meinen Job mit viel Liebe und Engagement erfüllt und wollte nie etwas anderes machen. Hätte mich der Klassenfeind im Ausland zurückbehalten, wäre ich über den Drahtverhau wieder in die DDR zurückgekrochen, auch auf die Gefahr hin, daß ich beim Betreten von "DDR - unser Vaterland" auf eine Tellermine trete.
Abschließend eine Beurteilung meines Schaffens aus dem Bericht des IM Richter.
Hinter diesem Decknamen verbarg sich mein Berufskollege Helmut Wacker. Da Eigenlob bekanntlich stinkt, lasse ich ihn mich lobpreisen. Sein Bericht findet sich in meiner Stasiakte:
Zu Flegel ist bekannt, daß er in Rechtssachen (Gesetze etc.) sehr bewandert ist. Sein Sieg im Prozeß 1967 machte ihn damals in der gesamten Flotte bekannt. F. ist redegewandt, hat gute Umgangsformen und ist intelligent. Er wird als guter Fachmann eingeschätzt und ist als solcher anerkannt. Er zeigt eine hohe Arbeitsmoral, viel Eigeninitiative bei Reparaturen und hat eine gute Arbeitsintensität.
1970 hatte ich persönlichen Kontakt zu Flegel. Er löste damals an Bord des MS "Thale" den FO ab (Urlaubsvertretung). Die Reise war damals die erste Brasilienreise und F. zeigte großes Interesse daran. Es gelang ihm sogar seine Ehefrau mit an Bord zu bekommen.........
Später fuhr Flegel längere Zeit (mehrere Jahre) auf MS "John Brinkman". Als ich dort eine Vertretungsreise fuhr – es war 1972 – sprachen die naut. und techn. Offiziere mit einer gewissen Hochachtung von Flegel.
F. hatte an Bord ein sehr gutes Verhältnis zu .... Flegel wurde von den Offizieren vor allem deshalb geschätzt, weil er ein guter Fachmann war und in seinem Beruf aufging. Darüber hinaus besaß er charakterliche Vorzüge, die innerhalb der Besatzung ankamen. Er liebte Geselligkeit, Späße und Humor.
Was für ein Proletariat wünschten sich die Diktatoren des selben denn noch?
Wie viele wackere Streiter auf den Schiffen unserer Flotte, bemühte auch ich mich in den vorderen Reihen für unsere gemeinsame sozialistische Sache. Aber die, die mich pausenlos aus den hinteren Reihen aus voller Deckung heraus in den Hintern traten, trugen mit ihren Bataillonen ganz erheblich dazu bei, daß das staatliche Contergan-Gebilde DDR, daß sie mit ihrem Panzerfahrer-Horizont so menschenverachtend schützen wollten, 1989 sang- und klanglos auf dem Globus sein Erscheinen einstellte.
Die falschen "Kameraden" die generell auf jedem Schiff ihre Ausdünstungen hinterließen, sollten sich schämend in die Ecke stellen und weiterhin rot anlaufen, wenn ihnen pünktlich der einstmalige Klassenfeind die fetten Pensionen überweist, die sie sich, im Gegensatz zu mir, ohne Berufsverbot "erarbeiten" konnten.
Nach der Wende und meiner amtlichen Rehabilitierung bewerbe ich mich schüchtern bei der Seereederei um meine Wiedereinstellung. Der IM "Taste", mein früherer Inspektor, bekleidet das Amt nun auch nachwendisch. "Hätte damals die Stasi dein Seefahrtsbuch nicht eingezogen, hättest du dich jetzt beim Arbeitsamt melden dürfen. Wir verramschen doch nur noch einen Dampfer nach dem anderen" lautet der abschlägige Bescheid auf meinen Antrag zur Wiedereinstellung.
Aber die Bundesrepublik zeigt sich nun äußerst generös! Auf dem Papier! Das kostet ja nichts.
Und mehr ist das Gesetz zur beruflichen Rehabilitierung –BerRehaG- in meinem Fall auch nicht wert!
Ich habe in die Rentenkasse dieses Landes nicht eingezahlt und erwarte daher auch keine großartigen Versorgungsleistungen aber auch nicht, daß sich der Staat mit Potemkinschen Dörfern in der Welt präsentiert, den neu Hinzugekommenen aber nur die Hinterhöfe zeigt!
Meine Rente wird nun, auf Grund meiner Rehabilitierung, so ausgerechnet, als ob es meine
Berufsverbote nicht gegeben hat. Somit bin ich -rein theoretisch- bis zum Datum der Wende zur See gefahren. Nach der Wende standen mir ja (mit verfallenem Patent) wieder alle Wege offen! Auf Schiffen die zu ihrer Verschrottung oder zum Heimathafen Monrovia überführt werden?
Die BfA rechnet zum Vergleich meine Rente mit und ohne Rehabilitierung durch. Einen Mehrbetrag von 50 DM monatlich bekomme ich dafür, daß mir knapp 10 Jahre theoretische Seefahrt mehr angerechnet werden.
Die Ausrechner dieser Beträge bekommen monatlich 2000 DM "Buschzulage", damit sie sich aufopfernd diesen Mühen in den neuen Bundesländern unterziehen. Und vor allen Dingen die eingelegten Widersprüche abschlägig bescheiden. Aber das ist ein anderes Thema.
Die Stasi hat mit ihren Berufsverboten, der Menschenverachtung und dem Terror viel Leid und Ungemach verbreitet und so manches Berufsverbot verhängt. In dieser Hinsicht hat sie aber dennoch nur gekleckert, die Treuhand mit der Hochinnovativ-Marktwirschaftslehre der Frau Breuel hingegen klotzt nach der Wende.
Jetzt wird flächendeckend "abgewickelt"!
Den Heimathafen "Rostock" am Heck trägt nach kurzer Zeit kein einziges Handelsschiff mehr in die Welt hinaus. Zeitweise waren die schönen Schiffe dieser Reederei für 8000 Seeleute die zweite Heimat.
Nach 46 Jahren ihres Bestehens wird im Februar 1999 die Flagge der Deutschen Seereederei Rostock eingeholt.
Kleines Nachwort:
Ich bitte den Leser, dieses Zeitdokument nicht als ein Gewebe aus Seemannsgarn zu betrachten. Bis auf drei Ausnahmen sind die genannten Personen authentisch.
Anders als sonst, sind entstehende Ähnlichkeiten nicht rein zufällig, sondern als Tatsache höchstens hier abgeschrieben.
Jeden der alten Kameraden, den ich nebst seinem längst verschrotteten Schiff hier nannte, will ich mit diesem bescheidenen Mittel noch einmal kameradschaftlich auf die Schultern klopfen.
Nur unter diesem Aspekt bitte ich, die Verletzung des heute so gepflegten "Persönlichkeitsschutzes" zu betrachten.
Schließlich haben wir alle auf unseren Schiffen rund um den Erdball Spuren hinterlassen, für die wir uns nicht schämen müssen. (Die inoffiziellen Dazuverdiener mal ausgenommen.)
All den genannten und nicht genannten alten Kumpelinen und Kumpels, die durch ihr Vorhandensein das Bordleben angenehm bereicherten und durch ihre Arbeit dazu beitrugen, daß wir zum größten Teil stets wohlbehalten heimkehrten, gelten heute noch meine Gedanken.
Bleibt alle gesund, wünscht
Funker Felix